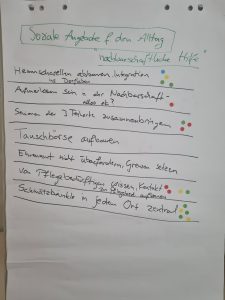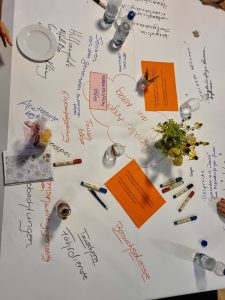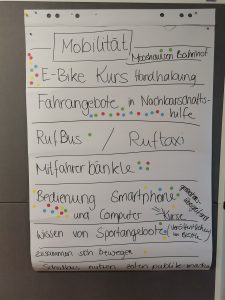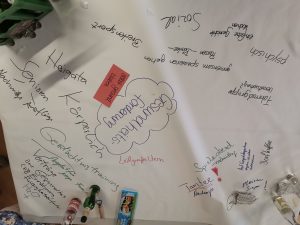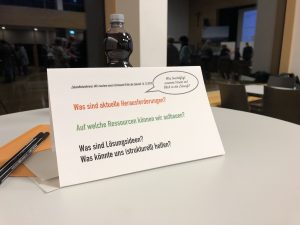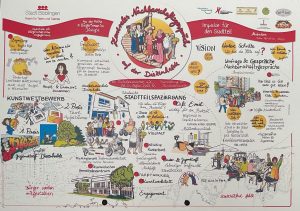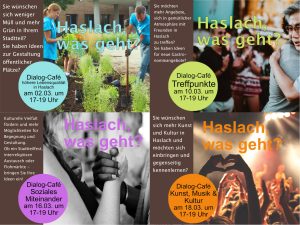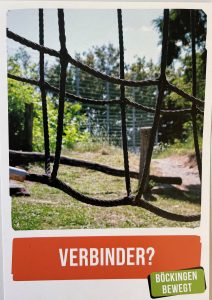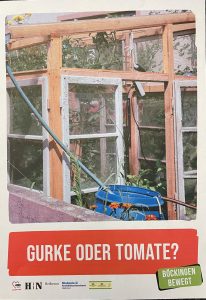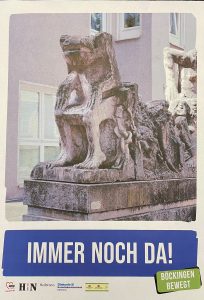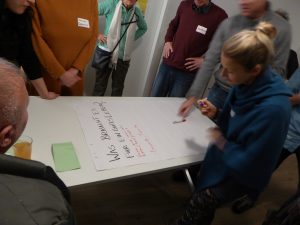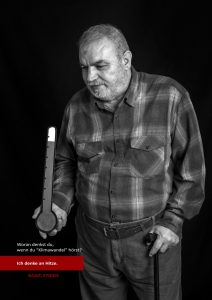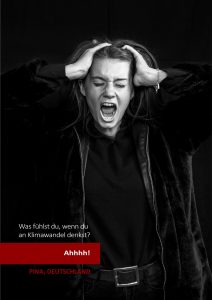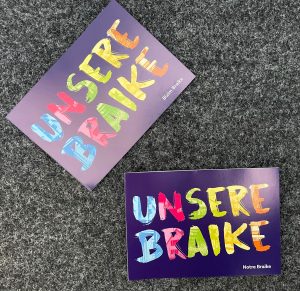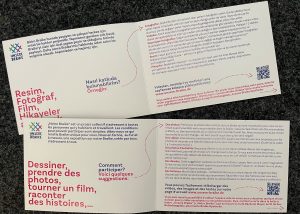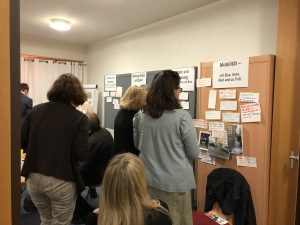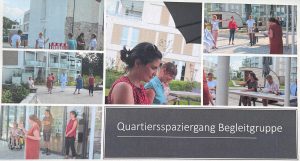Beteiligungsnetzwerk Listenansicht
Das Frauen-Sprach-Café Perle im Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof schafft zwei Mal im Monat einen geschützten Raum für Frauen, die durch eine Behinderung oder Fluchterfahrung von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Die Perle ist als offener Nachbarschaftstreff konzipiert und findet in barrierefreien Räumen des Gemeindezentrums der Bonhoefferkirche statt. Dieser Treffpunkt wird nun im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche genutzt, um mit den Frauen über aktuelle Vorhaben der Stadt Stuttgart im Bereich Städtebau und Wohnraumverdichtung zu diskutieren. Ebenso wird die feministische Stadtplanung und deren Perspektive erklärt und mit in die Gespräche eibezogen. Herzstück des Beteiligungsprozesses wird eine mehrtägige Zukunftswerkstatt in Leichter Sprache sein, deren Ergebnisse in die städtische Bürgerbeteiligung zur Entwicklung des Stadtteils Fasanenhof einfließen. Langfristiges Ziel ist es, eine kontinuierlich tagende Projektwerkstatt zu weiteren Themen im Stadtteil zu verankern.
Auf der Schwäbischen Alb gibt es seit Jahren rege Auseinandersetzung mit Windkraftenergie. Die Gegner sind sehr engagiert. Das geplante Beteiligungsprojekt „Forum Energie“ soll ein Lernformat sein, das alle Formen von Erneuerbaren Energien in den Blick nimmt und den Austausch zwischen der Kommune und der Bürgerschaft rund um dieses Thema ermöglicht. Das Format soll auf andere Kommunen übertragbar sein. Der Beratungsgutschein wird zur Entwicklung des Beteiligungs- und Kommunikationsformats benötigt.
Das soziokulturelle Zentrum Kulturhaus Karlstorbahnhof vereint unter seinem Dach die Vereine Kulturcafé, Theaterverein, Eine-Welt-Zentrum und Medienforum. Die Programmarbeit orientiert sich an den Wirkungsfelder der Soziokultur: Inter- und Transkultur, Teilhabe, Kulturelle Bildung und Erinnerungskultur.
Mit dem Projekt "Gegen das Vergessen" hat Luigi Toscano über 400 Überlebende der NS-Verfolgung besucht und porträtiert. Diese Portraits werden überlebensgroß im öffentlichen Raum auf dem Universitätsplatz in Heidelberg ausgestellt. Diese Ausstellung bietet Anlass eine große Tafel für ca. 20 Personen aufzubauen, an der die Bürger und Besucher der Stadt über ihre kulturellen und religiösen Grenzen hinweg ins Gespräch zu kommen. Dazu sind offene und angeleitete Formate vorgesehen, um durch Impulse in Dialog zu kommen. Zudem sind Gespräche mit dem Künstler geplant sowie ein Diskussionsforum mit verschiedenen Perspektiven vulnerabler Gruppen. Die Gespräche werden entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung analog, hybrid und digital geplant.
Im Projekt „Mittelbau Marmorwerk“ entsteht ein multifunktionaler Veranstaltungsraum für Horb, bei dem durch entsprechende Umbaumaßnahmen die bestehende Infrastruktur vom Bestandsgebäude genutzt werden soll. Die Stadt als Eigentümerin nutzt bisher die Fläche als Lagerraum. In einem Beteiligungsformat mit der Stadt, der engagierten Bürgerschaft und zahlreichen Kooperationspartnern wie der Musikschule, der Bücherei und ortsansässigen Vereinen wird ein tragfähiges Konzept entwickelt. Dabei werden die Bedarfe ermittelt sowie die Motivation zur aktiven inhaltlichen Mitgestaltung gefördert. Die Beratung erhält die Initiative für den konzeptionellen Aufbau einer Beteiligungswerkstatt.
Der FAM e.V. ist Träger von zwei Kitas und einem angegliederten Familienzentrum, das für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt. Mit niedrigschwelligen Angeboten sind sie ein Ort für Teilhabe und Chancengleichheit. Mit dem Fachtag zu "Teilhabe und Chancengleichheit" macht FAM e.V. sichtbar, dass eine ganzheitliche und individuelle Begleitung und Beteiligung in allen Lebensphasen nötig ist, um Benachteiligung und Diskriminierung in allen Gesellschaftsbereichen entgegenzuwirken. Sie thematisieren die Notwendigkeit von familiengerechten Rahmenbedingungen als Grundlage für Teilhabe. Der Fachtag richtet sich an Beteiligte und Interessierte aus dem Elementarbereich, sowie Menschen, die an der Gestaltung einer teilhabefreundlichen Gesellschaft Interesse haben.
Das Klimateam Schöntal bringt mit Projekten den lokalen Klimaschutz unter Beteiligung der Bürger*innnen voran. Mit einer Klima-Vortragsreihe werden Bürger*innen für die Veränderungen der Klimakrise sensibilisiert und Handlungsoptionen aufgezeigt. Folgende Vorträge sind geplant: Unser Wald, Erneuerbare Energien, Eigenheim nachhaltig, welche Ernährung tut mir und dem Klima gut, Wassermanagement in der Klimakrise.
Die Bürgerstiftung Gomaringen führt zahlreiche Projekte bürgerschaftlichem Engagement durch, z.B. Spielplatzbau, Bänklesgruppe, Wildbienen, Bürgermobil u.a. Ihr neues Projekt ist die Pflanzung von 100 Bäumen, um das Mikroklima im Ortsinneren zu verbessern und CO2 zu binden. Entlang von Straßen und an Parkplätzen werden die neue Bäume gepflanzt, die passend für diese Standorte ausgewählt wurden. Eine ehrenamtliche Gruppe pflanzt die Bäume, der Obst- und Gartenbauverein begleitet die Pflanzungen.
Das Klimaforum Schallstadt arbeitet in vier Arbeitsgruppe daran, den Klimaschutz lokal voranzubringen. Um noch mehr Bürger*innen für den Klimaschutz zu begeistern, findet das Schallstadter Klimafest statt. Ziel ist es, Bürger*innen durch Fachinput zu Fragen des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit zu sensibilisieren, zum aktiven Handeln anzuregen und gute Bespiele sichtbar machen. Kernelement ist ein Markt der Möglichkeiten sowie eine Vortragsreihe zu aktuellen Klimaschutzthemen und konkreten Umsetzungsbeispielen aus der Region.
Die Initiative WohnWandel organisiert in Lörrach Stammtische, Exkursionen und Kinovorstellungen zum Thema gemeinschaftliche Wohnformen. Ein weiteres Format ist das Symposium WohnWandel. Beim zweiten Symposium wird im „Theatersaal Nellie Nashorn“ in Lörrach die praktische Umsetzung von gemeinschaftlichen Wohnformen diskutiert. Interessierte Gruppen erhalten dazu das erforderliche Handwerkszeug zur Umsetzung sowie Ansprechpartner zu Unterstützung für ihre Projektideen. Die Referenten kommen aus den benachbarten Städten Basel und Freiburg und berichten von umgesetzten Beispielen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Honorare von Referenten des Symposiums sowie für die Raummiete des Theatersaals anfallen.
Ziel des 3. Schallstadter Klimafestes ist es, die globale Verantwortung für Klimaschutz mit konkretem Handeln vor Ort zu verbinden und zu leben. Dafür werden die Bürger*innen zu Fragen des Klimaschutzes und Klimagerechtigkeit sensibilisiert, ihnen Raum zum Austausch geboten sowie durch Best Practice Beispiele und Information zum aktiven Handeln motiviert. Angeboten werden Gesprächsinseln mit sieben verschiedenen Themen (Lebensmittel, Versorgung, Wald und Biodiversität, Zivilschutz, Energie, Mobilität, Zukunftsvisionen Schallstadt 2030). Das Kinderprogramm bietet u.a. mit der Sonne backen, Saftpressen oder Insektenhotels bauen. Ergänzt wird das Klimafest durch eine Kleidertauschbörse.
Eine lokale Gruppe in und um Schönwald im Schwarzwald reagiert auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und fertigt mit Hilfe von 3D-Druck so genannte Face Shields, die Gesichtsschilder zum Schutz vor der Übertragung durch Tröpfchen. Die Gesichtsschilder wurden bisher in Eigenregie hergestellt, zusammengebaut und an Bildungseinrichtungen, Arztpraxen, Kliniken und Altersheime unentgeltlich verteilt. Nach mehreren hundert Schildern übersteigen die Kosten private finanzielle Möglichkeiten, die Nachfrage bleibt aber bestehen. Das Projekt sieht vor, die Kinder in der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe (Schönwald) sowie in den umliegenden Schulen mit der Technik des 3D-Drucks vertraut zu machen. Dies beinhaltet einfaches 3D Zeichnen, Gestaltung, Entwicklung, Druck und Nachbehandlung der Teile. Das Erlernen dieser Technologie und der Druck mit biologisch abbaubarer Maistärke, hilft bei der Herstellung von Schutz- und Schulmaterialien. Außerdem erhöht es die Zukunftsperspektiven bei der beruflichen Orientierung. Die Kinder werden dabei gestärkt und können ihr Wissen direkt praktisch umsetzten.
Die studentische Initiative Nachhaltigkeitsbüro hat sich an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit dem Ziel gegründet, die Nachhaltigkeit in allen Leistungsdimensionen der Universität strategisch zu verankern. Dafür entwickelt sie eigene Ideen, bringt sich in den Nachhaltigkeitsdiskurs in Gremien der Universität ein und vernetzt studentisches Engagement. Außerdem beteiligt sich die Initiative an Kooperationsprojekten im Nachhaltigkeitsbereich außerhalb der Universität. 4netzen ist ein Vernetzungsprojekt, bei dem in monatlichen Treffen zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche, politische und gemeinwohlorientierte Organisationen zusammenkommen. Ziel ist der Aufbau von kooperativen Netzwerken, um zum gesellschaftlichen Wandel im Sinnen nachhaltiger Entwicklung beizutragen und viele Menschen zum eigenen Handel zu motivieren. 4netzen wird in Kooperation mit dem Haus des Engagements, Eine Welt Forum Freiburg und dem Treffpunkt Freiburg organisiert.
Inklusion behinderter Menschen, Beratung nach der Peer councelling Methode: Menschen mit Behinderung, die eine qualifizierte Ausbildung absolviert haben, beraten, begleiten und unterstützen andere Menschen und deren Angehörige rund um alle Fragen zum Thema Behinderung, damit die Menschen mit Behinderung selbstbestimmt am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Der JugendKunstParkour ist ein soziokulturelles Angebot der Projektpartner*innen Kubus und ArTik e.V. für junge Menschen. Die Orga-Gruppe besteht aus kunstinteressierten jungen Erwachsenen, u.a. auch Kunststudierende, die das spartenübergreifende Kunstangebot konzipieren und entwickeln. Von April bis Juli 2021 wird an dezentralen Orten in Freiburg künstlerisch gearbeitet um somit coronakonform zu agieren. Nach einem gemeinsamen Startschuss und der Vernetzungsmöglichkeit der Teilnehmenden wird über drei Monate in den Sparten Videokunst, Musik, Theater, Maskenbau/Maskenspiel und Bildhauerei gearbeitet. Zum Abschluss des Projekts werden die entstandenen Produktionen gemeinsam aufgeführt und die Kunstwerke ausgestellt.
Africa Culture Rhein-Neckar e.V. ist ein Verein zur Förderung der Völkerverständigung und des interkulturellen Dialogs. Wir wurden 2004 in Mannheim gegründet und haben über viele Jahre verschiedene Aktivitäten durchgeführt.
African Women 4 Empowerment e.V. ist eine gemeinnützige Verein, die sich auf Empowerment und Erhebung der Gemeinschaft konzentriert.
African Women 4 Empowerment e.V. bedeutet, Frauen zu befähigen und ihnen zu ermöglichen, lebensbestimmende Entscheidungen über die verschiedenen Probleme in der Gesellschaft zu treffen.
Die Stärkung von Frauen, insbesondere von Frauen auf dem Land, ist zu einem wichtigen Thema in den Strategien für eine ausgewogene Entwicklung mit sozialer Gerechtigkeit geworden.
Wirtschaftliche Befähigung führt dazu, dass Frauen Einfluss nehmen oder eine richtige Entscheidung treffen können, das Selbstvertrauen stärken, den Status und die Rolle im Haushalt verbessern usw.
Der Elternbeirat der kaufmännischen Schule in Nagold setzt sich ein, die sozialen Fähigkeiten der Schüler zu stärken. Durch die Corona-Pandemie sind die Schüler in ihrer Kommunikation eingeschränkt und brauchen Unterstützung, um selbstsicher auftreten zu können.
In drei Tagesseminaren vermittelt eine Schauspielerin den Schülern das Thema Auftreten und Wirkung durch Wahrnehmung von Körpersprache, Kennenlernen von Gestik, Atmung und Stimme.
Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich zusammen aus Akteuren in der Kinder- und Jugendarbeit aus den Kommunen im Landkreis Lörrach. Sie setzt sich ein für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene und hat zum Ziel das diese Beteiligungsformate im gesamten Landkreis etabliert werden. Die AG Jugend konzipiert selbst Konzepte der Beteiligung, organisiert diese und führt sie auch durch.
LOKALE AGENDA 21 IN BRUCHSAL: Netzwerk von Ehrenamtlichen zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt. Hierzu bringen wir uns mit Ideen und Vorschlägen zu Planungen ein und setzen selbst Projekte um.
Das Projektteam der NWT-Klasse 10d des Gymnasiums Achern realisiert eine kontrollierte hocheffiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Rotationswärmetauscher. Diese spart Energie, sorgt für ein besseres Klima, eine zirkulierende Nachtkühlung und somit für eine bessere Lernatmosphäre. Die Initiative wird hierbei finanziell bei den Sachkosten und der professionellen Planung unterstützt.
Auf dem Weg zum Bioenergiedorf mit Bürgerbeteiligung
Der AK Inklusion arbeitet im Freiburger Stadtteil Vauban seit 2008 kontinuierlich an einer inklusiven Quartiersentwicklung und einer Vernetzung aller relevanten Akteure zum Thema. Der Arbeitskreis verantwortet verschiedene inklusive Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gründung der Arbeitsgruppe "Gute Orte im Quartier". Die Gruppe hat zum Beispiel eine Auflistung von inklusiven Arbeits- und Praktikumsplätzen im Vauban erstellt. Durch den Beteiligungstaler werden einerseits Sachkosten finanziert, die mit der Erstellung neuer Flyer für die Öffentlichkeitsarbeit des Arbeitskreises anfallen. Dazu wird ein Gebärdendolmetscher finanziert, um verschiedene Arbeitskreissitzungen im Stadtteil inklusiv zu gestalten.
Wir möchten mittels Bürgerbeteiligungsprozessen in Stegen den Weg zu einer umweltverträglichen und zukunftsfähigen Mobilität beschreiten. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und in enger Kooperation mit der Verwaltung wollen wir mit einem E-CarSharing-Auto als Pilot starten. Nach Möglichkeit soll der Standort auch mit einem E-Lastenfahrrad ausgestattet werden und in Richtung einer Mobilitätsstation für Pedelecs weiterentwickelt werden. Außerdem arbeiten wir an Angebotsergänzungen bei dem Bürgerbus \"Dreisamstromer\" mit, um mit Bürgerengagement Lücken im bestehenden Angebot des ÖPNV zu schließen. Die besonderen Herausforderungen in einer Gemeinde im ländlichen Raum machen das Projekt anspruchsvoll und besonders interessant.
Das Projekt „Von Anfang an gemeinsam – Quartiersentwicklung“ greift den Wunsch vieler Bürger*innen der Gemeinde Gomaringen auf, sich aktiv in Quartiersentwicklungsprozesse vor Ort einbringen zu können. Das Projekt beinhaltet die Informationsformate für alternative Wohn- und Pflegemodelle, ein Erfassen der Bedarfe der Bürger*innen für lebenswerte Quartiere sowie die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu Prozessen der Quartiersentwicklung. Die Beratung ist dazu da, damit der Arbeitskreis von bereits erfolgten gemeinsamen Prozessen anderen Initiativen und Gemeinden lernen kann.
Die Bürgerinitiative B31 West Nein Danke möchte den Ausbau einer Bundesstraße verhindern, zum Schutz einer einzigartigen Landschaft und als CO2-Speicher. Zugleich zeigen sie Mobilitätsalternativen auf und setzen sich für den Ausbau des ÖPNV und von Radschnellwegen ein.
Mit einem Aktionstag können Bürger Stimme gegen den Ausbau ergreifen und sich zu alternativer Mobilität und Klimaschutz informieren sowie die Bedeutung des betroffenen Niedermoors kennenlernen. Ziel der Veranstaltung ist es in einen Dialog mit Bürgern zu kommen, die Wechselwirkung von Mobilität und Klimaveränderung aufzeigen und alternative Mobilität erlebbar machen. Zudem gibt es Vorträge zu den Themen und Dialog- und Infostände.
Ein Ziel des „aktiven Hotzenwaldes“ besteht darin, die Lebensqualität in den drei Hotzenwaldgemeinden Herrischried, Görwihl und Rickenbach zu erhalten und weiter zu fördern. Die Bürgerbewegung bietet ein Forum, um Bürgerinteressen anzusprechen, und eingebrachte Ideen in Arbeitskreisen zu bündeln und umzusetzen.
Das Ziel des Arbeitskreises ist es, einen öffentlichen Tag mit Rundgängen um Unterensingen zu initiieren, um sichtbar zu machen, wie unterschiedlich Menschen Ihre Stadt erleben. An verschiedenen Stationen können Fragen gestellt, Geschichten erzählt, persönliche Erfahrungen und Erlebnisse geteilt werden. Der Tag wird kreativ und partizipativ von vielen Unterensingern und Geflüchteten gestaltet, die genaue Form entsteht durch eine breite Beteiligung. Die Aktion wird später visualisiert (z. B. eine Postkarte oder eine Ausstellung). Beratung zu folgenden Themen: Ideenfindung, Entwicklung von Beteiligungsformaten, Projektmanagement und Konzeption.
Als gemeinnütziger Verein engagiert sich die Allianz für werteorientierte Demokratie e.V. seit 2017 durch professionelle Formate für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte. Unsere bislang fünf Formate richten sich hierbei an ganz verschiedene Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Unternehmen, aber auch die Politik, die im Rahmen der Veranstaltungen mit Bürgern zusammentritt. Gezielt soll es dadurch zu mehr Engagement in der Gesellschaft, interkulturellen Austausch und verstärkter Bürgerbeteiligung kommen. Alle haben ein sehr positives Echo erhalten und ein wertvolles Netzwerk in Freiburg und darüber hinaus aufgebaut. Etwa im Rahmen des "Demokratiefrische"-Netzwerks ist die AllWeDo e.V. auch überregional stark vernetzt.
Der Nachbarschaftshilfeverein Lauf e.V. verfolgt gemeinsam mit der Gemeinde das Ziel, eine Kommune für alle Generationen zu sein. Zusammen wollen sie vor Ort den demographischen Wandel gestalten. Hierzu gehört die Versorgung älterer Gemeindemitglieder, aber auch die Betreuung und Integration von Flüchtlingen. Beratung erhält die Initiative zu steuerrechtlichen Fragen, zur Betreuung von Flüchtlingen unter Berücksichtigung kultureller Besonderheiten und zur Basisqualifizierung von Alltagsgestalter.
Die Initiative „Alt werden in Blochingen“ engagiert sich für den Verbleib älterer Menschen in ihrer vertrauten Umgebung sowie eine lebenswerte Gemeinschaft von Jung und Alt. Beratung wird zum Thema Kommunikation/Teambildung benötigt, um den Verein zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.
Der Bürgerverein arbeitet an dem Auf- und Ausbau eines bürgerschaftlichen Netzwerkes in Blochingen. Dadurch werden die Lebensbedingungen für Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf deutlich gestärkt. Aktuell soll die fehlende Dorfmitte (der Lindenplatz) in Kooperation mit der Gemeinde hergerichtet werden. Außerdem ist die Eröffnung eines offenen Treffpunkts für Jung und Alt im alten Rathaus nahe dem Lindenplatz geplant. Der Beratungsgutschein wird zur Konzeptentwicklung und zur Umsetzung von Projekten genutzt.
Das Familienzentrum Rheinfelden e.V. bietet bedarfsgerecht und bedürfnisorientiert Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten, Hilfe zur Selbsthilfe, niederschwellige Beratung, erziehungs- und familienstärkende Bildungsangebote. In den Räumlichkeiten der "Alten Apotheke" entsteht ein Familien- / Generationentreff / Begegnungszentrum im Ortsteil Grenzach-Wyhlen. Die Bürgerschaft wird gleich zu Beginn aktiv in die inhaltliche Gestaltung des Treffs eingebunden. Die konzeptionelle Neugestaltung bietet eine ideale Plattform um selbst aktiv zu werden, mitzugestalten und Ideen einzubringen. Das Begegnungszentrum bietet zentrale Räume zur Beteiligung und Meinungsbildung vor Ort sowie fördert die Vernetzung und Partizipation.
Das Elternforum Marbach ist von ehrenamtlich engagierten Menschen jeden Alters getragen, deren Ziel es ist, Erziehungsarbeit zu verbessern und zu erleichtern. Sie tragen Informationen zusammen, welche schnell und unbürokratisch Eltern zugänglich sind und organisieren Aktivitäten und Vorträge.
Die Angebote und Treffen des Elternforum Marbach finden im Familienzentrum statt. Im Sinne einer generationenübergreifenden Begegnungsstätte ist Jede und Jeder herzlich willkommen, die kostenfreien Angebote zu nutzen, egal welchen Alters.
Das Familienzentrum war aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen. Damit es schnell wieder öffnen kann sind Hygiene-Maßnahmen notwendig. Dazu muss die Küche kindersicher gemacht werden und in diesem Zuge auch die Geräte energieeffizient erneuert werden.
Die Initiative „Mühlwerk Sinneswandel“ setzt sich für die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein und wurde von Eltern behinderter Kinder gegründet. Das Sozialwerk Bethesda lässt rund um die Alte Mühle Fleningen ein Seniorenwohnpark und ein Pflegeheim entstehen. Dieses Quartier eröffnet neue berufliche und persönliche Perspektiven für Menschen mit Behinderung. Beratung wird für die Wirtschaftsanalyse sowie für die Öffentlichkeitsarbeit benötigt.
Die Gemeinde Klettgau mit ihren sieben eigenständigen Ortsteilen liegt direkt an der Grenze zur Schweiz und ist nach Landesentwicklungsplan ländlicher Raum im engeren Sinne. Durch eine möglichst umfängliche Nutzung als Kultur-und Begegnungsstätte wird der alte Pfarrhof Erzingen als anspruchsvolles Bürgerprojekt nachhaltig zur Umsetzung gelangen. Das Areal Erzinger Pfarrhof mit seinen drei Gebäuden bietet der Bevölkerung einen idealen Platz zur Wiederbelebung des Ober-Erzinger Ortszentrums. Es dient als Pilotprojekt für weitere Vorhaben in anderen ländlich geprägten Klettgauer Ortsteilen. Der respektvolle Umgang mit diesem historischen Kulturdenkmal unter enger Bürgerbeteiligung und Zusammenarbeit der Gemeinde Klettgau stehen hierbei im Vordergrund. Die Beratung erfolgt zur Rettung/Wiederbelebung denkmalgeschützter Räume im ländlichen Ortskern.
Der Arbeitskreis „Älter werden in Schuttertal“ möchte vor Ort eine Pflegewohngruppe und eine Tagesbetreuung einrichten, damit Bürger der Gemeinde in vertrauter Umgebung älter werden können. Für dieses Vorhaben soll eine alte Pfarrscheune umgebaut und angepasst werden. Beratung erhält der Arbeitskreis zu den Themen: Klärung der Rechtsform sowie Klärung von Strukturen der Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zur Gründung einer Organisation.
Waldangelloch Aktiv hat sich im Rahmen der Quartiersentwicklung gegründet und betreibt einen Dorftreff und stellt Engagierten organisatorischen und rechtlichen Rahmen für die Umsetzung von niedrigschwelligen Angeboten zur Verfügung.
Ein neues Angebot für Kinder soll das Thema Erneuerbare Energien erfahrbar machen. Mit Experimentierkästen soll spielerisch ein Zugang zum Thema geschaffen werden. In Kooperation mit einer Schule können Kindern an dem Angebot als AG oder als Ferienprogramm teilnehmen.
Betreuer*innen werden dazu in einem Workshop für die Anleitung des Angebots vorbereitet. Am Ende des Projekts stellen die Kinder ihre Ergebnisse im Dorftreff vor und regen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Solarenergie an.
Verpackungsfreies Einkaufen soll allen Bürger*innen ermöglicht werden. Dafür werden möglichst viele Menschen, Einrichtungen und Unternehmen in das Projekt involviert - als Multiplikatoren und zur Förderung des Gemeinschaftssinns. Zur Sensibilisierung und Wissensvermittlung werden mehrere Workshops & Vorträge angeboten. Ziele sind: Durch gebündelte Belieferung C02 einzusparen, alles komplett verpackungsfrei durch Verwendung von Pfand- und/oder eigenen Behältnissen sowie die Unterstützung regionaler Produzenten.
Das BürgerNetzwerk hat ein Theaterprojekt mit Geflüchteten unter Anleitung einer professionellen Regisseurin umgesetzt. Dabei hat die Gruppe Migranten, die bereits länger in Deutschland leben, in das Theaterprojekt integriert.
Bürgerbeteiligung und Mitsprache der Bürger in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
Im Frühjahr 2017 fand eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung im Dorf Weiler statt, die sich mit Fragen zur Zukunftsgestaltung auseinandersetzte. Im Projekt zeigte sich, dass sich die Bürger einen Dorfplatz wünschen, der als gesellschaftlicher Treffpunkt fungieren kann. Beratung erhält die Initiative zum Prozessauftakt und zu den Fragen, welche baulichen Maßnahmen von den Bürger angenommen werden. Dazu sollen Maßnahmen identifiziert werden, die den Platz als Treffpunkt fördern.
Der Seniorenbeirat in Au am Rhein will mit dem Projekt „Pflege und Alltagsbewältigung“ ein integriertes Gesamtkonzept für Menschen im Rentenalter in Au erstellen. Das Konzept dreht sich um die Frage, wie die Teilhabe der Menschen im Rentenalter in der Gemeinschaft vorangetrieben werden kann. Die Gruppe möchte informieren und aufzeigen, wie durch Hilfestellungen wie barrierefreie Einrichtungen das Leben im Alter in den eigenen vier Wänden unterstützt werden kann. Beratung erfolgt zur Konzepterstellung und im Zuge der Unterstützung durch eine professionelle Moderation in Workshops und Arbeitskreisen.
Zivilgesellschaftliche Initiativen erarbeiteten in zahlreichen Treffen eine Lösung zur weiteren Nutzung der Pfarrscheune in Schuttertal, die nun auf Beschluss des Gemeinderates umgebaut werden soll. Auf Wunsch der Bürger soll hier vor allem eine selbstverantwortete Wohngruppe für pflegebedürftige sowie Tagesbetreuung für ältere Menschen entstehen - ein Ort der Begegnung. Beratung wird zur Gründung einer Bürgergenossenschaft als Dach für die zivilgesellschaftlichen Initiativen vor Ort benötigt, um eine tragfähige Struktur für diese Initiativen zu entwickeln, sie zu etablieren, um die Lebensqualität im Ort zu erhalten bzw. zu steigern. Als positives Beispiel dient die Eröffnung eines Dorfladens in Form einer Genossenschaft in Schuttertal Schweighausen.
HAUSWÄRME FÜR KÖNIGSBRONNWir möchten erreichen, dass die Königsbronner Gebäude mit natürlicher, umwelt- und klimafreundlicher Energie versorgt werden. Zuerst soll es um Heizwärme gehen. Es ist eine anerkannte Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu verringern, um den Klimawandel zu bremsen.
Zuerst können die Abwärmemengen der Gießereien genutzt werden. Wenn dadurch viele Einzelheizungen entfallen, reduziert das die Abgase in Königsbronn schon ganz erheblich. Regenerative Energie soll dazukommen und eine langfristig stabile und preisgünstige Versorgung Königsbronns sichern.
Wir begleiten und unterstützen die Untersuchung zur Quartiersanierung, die die Gemeinde beschlossen hat.
Die Arbeitsgruppe möchte für Einwohner*innen und Gäste die Gemeinde "Erlebbar" machen. Das heißt, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe daran arbeiten über die Schönheit und Besonderheiten unserer Dörfer und Landschaft zu informieren.
So tragen die Mitglieder des Arbeitskreises beispielsweise historische Informationen über die Gebäude oder Begebenheiten in den Dörfern zusammen, arbeiten (Rad-) Wandertouren aus und organisieren zum Beispiel Lesungen und geführte Ortsrundgänge.
Dadurch wird die Attraktivität der Gemeinde gerade auch für Kurzurlauber, Wochenendausflügler, Tagestouristen und nicht zuletzt für die Bürger von Wiernsheim kontinuierlich verbessert.
Gemeinsam mit den Mitglieder*innen, sowie Kindern und Jugendlichen vor Ort, realisiert die Initiative zahlreiche Maßnahmen rund um die Obstbäume und die Kulturlandschaft. Hierzu erweitern die Projektbeteiligten die bestehenden Streuobstwiesen um neue Sorten und erhalten im selben Atemzug die älteren Bäume, damit diese auch in Zukunft als Brutstätten für Vögel und Lebensraum für Insekten dienen. Durch das Projekt erhalten Bürger*innen zudem die Möglichkeit selbst zu ernten und mehr über die Streuobstwiesen zu lernen.
Der Verein Lebensqualität beschäftigt sich mit dem Thema „Sorgende Gemeinschaft“. Aufbau einer Dienstleistungsbörse, die nachhaltig die Bedürfnisse von älteren und hilfebedürftigen Menschen und die Interessen der engagierten Bürger*innen berücksichtigt, ist geplant. Beratung wird zur Entwicklung und Umsetzung des Planungsprozesses genutzt.
Ziel der Initiative ist es, in Herdwangen-Schönach eine umfassende Rundum-Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Güter des täglichen Bedarfs, mit verschiedenen Dienstleistungen sowie sozialen, kulturellen und medizinischen Angeboten zu initiieren. Ein multifunktionales DORV-Zentrum dient als Ort der Kommunikation und der Begegnung. Eine Basisanalyse dazu wurde bereits durchgeführt. Die Beratung erhält die Initiative zur Vorbereitung und Durchführung des Bürgerforums mit Gründung eines DORV-Teams, um die Bürger zu informieren und zu aktivieren sowie um die Ergebnisse der Analyse vorzustellen und das Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln.
In Herdwangen-Schönach soll eine umfassende Rundum-Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs, mit verschiedenen Dienstleistungen sowie sozialen, kulturellen und medizinischen Angeboten initiiert werden. Ein multifunktionales DORV-Zentrum dient als Ort der Kommunikation und der Begegnung. Eine Basisanalyse dazu wurde bereits durchgeführt. Ein Bürgerforum zur Information und Aktivierung der Bürger ist geplant, um die Ergebnisse der Analyse vorzustellen und das Projekt gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Beratung zur Vorbereitung und Durchführung des Bürgerforums mit Gründung eines DORV-Teams.
In Herdwangen-Schönach soll eine umfassende Rundum-Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs, mit verschiedenen Dienstleistungen sowie sozialen, kulturellen und medizinischen Angeboten initiiert werden. Eine Basisanalyse sowie der 1. Bürgerdialog Nahversorgung zur Aktivierung der Bürgerschaft wurden bereits durchgeführt. Die Beratung erhält die Initiative zur Vorbereitung und Durchführung der aktivierenden Befragung.
In einer Gesprächsreihe teilen Nachbarn ihre Erfahrungen aus der Corona-Zeit. Gemeinsam erarbeitet die Gruppe Lösungsansätze für die gegenseitige Unterstützung - sowohl in der Ehinger Kernstadt als auch im Neubaugebiet Rosengarten. Um möglichst breit zu beteiligen, gibt es niedrigschwellige, dezentrale Gesprächsformate, die im übersichtlichen Rahmen stattfinden. Unter dem Motto: "die Gespräche kommen in die Nachbarschaft".
Für den Verein „Lesewelt Ortenau e.V.“ aus Offenburg bedeutet Lesen eine zentrale Grundkompetenz und Schlüsselqualifikation für den späteren Bildungs- und Karriereweg von Kindern. Mehr als 150 ehrenamtliche Vorleser engagieren sich bereits für den Verein. Um die Strukturen weiter auszubauen und ein Netzwerk zur Leseförderung im Ortenaukreis zu etablieren, erhält der Verein Beratung zum Thema Fundraising, Organisationsentwicklung und Datenbankeinführung.
Das Forum zukunftsfähiges Nürtingen versteht sich als ein öffentliches Forum, in dem Referentinnen und Referenten vor allem aus der Region und interessierte Bürger aus Nürtingen und Umgebung modellhaft Perspektiven für eine zukunftsfähige Kommune entwickeln. Im Projekt sollen die Erfahrungen des Bürgerentscheids 2017 aufgearbeitet und in einer Erfahrungsgeschichte allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Beratung erfolgt zur Prozessplanung und der Vorbereitung und Auswertung der Interviews.
Die Bürgerinitiative bietet kostenlose PV-Beratung für interessierte Bürger*innen an und sorgt somit für einen wichtigen Beitrag, um Göppingen bis 2035 klimaneutral zu gestalten. Beratungsleistung erhält die Initiative für Workshops und Schulungen zum Thema Energieberatung.
Der gemeinnützige Verein Waldangelloch Aktiv umfasst eine Gruppe engagierter Bürger, die sich während des örtlichen Quartiersentwicklungsprozesses gebildet hat. Der Verein wird Träger und Betreiber einer Begegnungsstätte im Dorf Waldangelloch, das zur Stadt Sinsheim gehört. In der Begegnungsstätte werden verschiedene Angebote wie zum Beispiel ein offenes Café oder Spielenachmittage etabliert, um dem dörflichen Wandel und der Abwanderung zu begegnen. Die niederschwelligen Angebote schaffen Begegnungs- und Vernetzungsmöglichkeiten. Um weitere Angebote zu organisieren, finden für die Bürgerschaft offene Planungsworkshops statt. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die durch die Workshops und den Eröffnungstag der Begegnungsstätte anfallen.
Die Initiative "Runder Tisch Klima Lörrach" bildet mit ihrem Projekt 15 technisch versierte Bürger*innen aus, über die eine Beratung der Bewohner*innen in Anspruch genommen werden kann. Dabei versteht sich das Projekt nicht als Konkurrenz zu zertifizierten Energieberatern, sondern vielmehr sind die "Bürger-Solar-Berater" als Nachbarschaftshilfe und niederschwelliges Angebot angedacht. Beratung erhält die Gruppe zu dem Aufbau einer Gruppe von "Bürger-Solar-Beratern", zur Förderung des Erfahrungsaustauschs und zur Bürgerbeteiligung.
In der Stadt Schopfheim gibt es zahlreiche Initiativen, die in Teilaspekten des sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandels aktiv sind, jedoch nicht voneinander wissen. Ein Treffen letztes Jahr zeigte den Bedarf an Vernetzung und an Strukturen, die zum Mitmachen anregen. Folgetreffen sind geplant, um einen Netzwerk zu koordinieren und in der Stadt sichtbar zu machen. Mit der Initiative "fairNETZt Wiesental" soll eine Kommunikationsplattform für bestehende und im Aufbau befinden Initiativen und Projekte geschaffen werden, um diese zum aktiven Mitmachen zu mobilisieren. Der Schwerpunk liegt dabei auf ressourcenschonendem Handeln im regionalen Umfeld. Die Beratung in der Aufbau- und Anfangsphase, nachhaltige Strukturen für eine Plattform zu etablieren.
In der Stadt Schopfheim gibt es zahlreiche Initiativen, die in Teilaspekten des sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wandels aktiv sind, jedoch nicht voneinander wissen. Mit der Initiative "fairNETZt Wiesental" entsteht eine Kommunikationsplattform für bestehende und im Aufbau befinden Initiativen und Projekte, um diese zu vernetzen, zu koordinieren, in der Stadt sichtbar zu machen und zum aktiven Mitmachen zu mobilisieren. Der Schwerpunk liegt dabei auf ressourcenschonendem Handeln im regionalen Umfeld. Der Beratungsgutschein wurde in der Aufbau- und Anfangsphase eingesetzt, um nachhaltige Strukturen für eine tragfähige Plattform zu etablieren.
Engagierte Bürger haben sich zum AK Leben im Alter in Gomaringen zusammengeschlossen, um sich aktiv in die Gemeindepolitik einzubringen. In einem Workshop hat der Arbeitskreis folgende Handlungsfelder für sich definiert: Selbstbestimmung, Soziale Teilhabe, Versorgung, Mobilität, Wohnen, Interessensvertretung. Mit dem Aufbau einer nachhaltigen Vernetzungsstruktur verfolgt der Arbeitskreis folgende Ziele: Effizientere Kommunikationsstrukturen, Gewinnung weiterer Bürger*innen, Entscheidungsprozess über Organisationsstrukturen initiieren.
Initiierung einer selbstverwalteten Jugendeinrichtung in Önsbach. Die Jugendlichen sollen Verantwortung für den Raum und für die Angebote übernehmen. Die Jugendinitiative hat dazu beigetragen, dass das ehemalige Vereinszentrum zum Jugendraum dank Spenden umgebaut wurde. Der Beratungsgutschein wird für den Aufbau einer Struktur, die Organisation eines regelmäßigen Betriebs sowie für das Erarbeiten einer Hausordnung und die Organisation einer Jugendversammlung benötigt.
Eine Gruppe von Jugendlichen nutzt im Acherner Ortsteil Önsbach den umgebauten Jugendraum intensiv. Dazu arbeitet die Gruppe an der selbstverwalteten Führung des Raums in Zusammenarbeit mit der lokalen Verwaltung. Freiwillige können dem Team jederzeit beitreten, um zukünftig selbst Verantwortung im Jugendraum zu übernehmen und das Angebot mitzugestalten. In drei Workshops legt die Jugendgruppe ihre zukünftige Arbeitsstruktur und den geplanten neuen Jugendraumbetrieb gemeinsam fest. Durch den Beteiligungstaler werden zum Beispiel Sachkosten finanziert, die für die Verpflegung an den Workshops und zur öffentlich wirksamen Bewerbung der Workshops anfallen.
Die „Projektgruppe Familien-Gesundheits-Zentrum Herrenberg" arbeitet an einem Gesundheitszentrum mit Hebammenpraxis für alle Generationen. Das Zentrum soll eine Reihe von nachhaltigen Gesundheitsangeboten für die Herrenberger Bürger bieten, gerade auch für Alleinerziehende, Migranten oder Pflege-/ und Betreuungsbedürftige. Ein Miteinander leben und lernen aller Generationen und Kulturen im Quartier ist ein weiteres Oberziel der Gruppe. Das Projekt wird mit verschiedenen Akteuren vor Ort ausgearbeitet, zum Beispiel mit Gemeinderäten, Mitarbeitern aus dem Gleichstellungsbüro und dem Gesundheitsamt oder dem Gebäudemanagement der Stadt. Durch die Austauschtreffen will die Gruppe auch Synergieeffekte schaffen, die zur Beteiligung und Kooperation mit weiteren Gruppen vor Ort führen können. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Erstellung und den Druck eines Projektflyers anfallen.
2016 gab es eine erste Veranstaltung in Steinen, um Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg vorzustellen sowie auszuloten, wie groß die Bereitschaft der Bürger in Steinen ist, sich aktiv in ihrer Gemeinde einzubringen. Daraus hat sich die Gruppe „Soziales“ formiert, die sich ein Gemeinschaftshaus mit sozialem Treffpunkt wünscht. Im Projekt sollen der Umbau der alten Weberei zu einem öffentlichen Raum und Wohnraum sowie die Einrichtung einer Zeitbank erfolgen. Beratung erhält die Initiative bei der Projekt- und Prozessberatung.
Der Verein Jung & Alt ist in Stühlingen und in der Umgebung in der Nachbarschaftshilfe aktiv. Dem Verein ist es ein Anliegen, das Dorfleben wieder attraktiver zu gestalten. Die Idee des Projekts ist die Umnutzung einer ehemaligen Gaststätte in einen sozialen Treffpunkt. In diesen Prozess soll die Bevölkerung miteinbezogen werden. Beratung erhält die Initiative zur Konzeptentwicklung, zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie zur Beteiligung der Bürger.
Das Bürgerforum Mengen ist ein Zusammenschluss von Bürgern, der sich für eine nachhaltige Zukunft des Schallstadter Ortsteils Mengen einsetzt. Die Gruppe arbeitet im Ortsteil an einer umweltverträglichen und autoreduzierten Mobilität. Nach mehreren Sitzungen, die durch eine externe Beratung aus dem Förderprogramm "Gut Beraten!" unterstützt wurden, verfolgt die Gruppe verschiedene Maßnahmen: Vor Ort wird ein Standort für ein E-Carsharing Auto in Kooperation mit der Kommune gesucht. Dazu wird ein Lastenfahrrad etabliert. Als begleitende Bürgerbeteiligungsformate finden Befragungen, Infostände und öffentliche Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität vor Ort statt. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die in der Anfangsphase durch die Veranstaltungen und die Ausweisung der Mobilitätsangebote anfallen.
Der "Lobin Karlsruhe e.V." entwickelt eine Strategie zur Sichtbarkeit und Finanzierung der Kulturküche in Karlsruhe, die ein Bürgerbeteiligungszentrum mit angeschlossener Gastronomie im Quartier Innenstadt-Ost ist. Die Wirkungsfelder erstrecken sich über Soziales, Kunst & Kultur, und Nachhaltigkeit. Mit der Kulturküche wird der gesellschaftliche Zusammenhalt durch Bürgerbeteiligung und Mitmach-Projekte gestärkt. Der Verein erhält die Beratung zu den Themen Finanzierung und Fördermittel.
Die Gruppe "Aufgeklärt?!" engagiert sich für die Durchführung einer ehrenamtlich organisierten Veranstaltungsreihe, die Fragen nach Sexualität, sexueller Bildung und Aufklärung im feministischen Kontext thematisiert. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus dem Bereich Kulturpädagogik, Literatur, Gesundheit und Forschung. Die Formate der Veranstaltungsreihe sind Vorträge, interaktive und interdisziplinäre Workshops, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Die Teilnehmer lernen dabei sich über sogenannte Tabuthemen auszutauschen und eine Sprache zu erlernen, die sie befähigt über ihren Körper und ihre Bedürfnisse zu entscheiden.
Die Gruppe ""Aufgeklärt?!" engagiert sich für die Durchführung einer ehrenamtlich organisierten Veranstaltungsreihe, die Fragen nach Sexualität, sexueller Bildung und Aufklärung im feministischen Kontext thematisiert. Die Mitglieder der Gruppe kommen aus dem Bereich Kulturpädagogik, Literatur, Gesundheit und Forschung. Die Formate der Veranstaltungsreihe sind Vorträge, interaktive und interdisziplinäre Workshops, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Die Teilnehmer*innen lernen dabei sich über sogenannte Tabuthemen auszutauschen und eine Sprache zu erlernen, die sie befähigt über ihren Körper und ihre Bedürfnisse zu entscheiden.
Die Gruppe engagiert sich seit längerer Zeit für die nachhaltige Dorfentwicklung und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagement abseits der bestehenden Strukturen wie Ortschaftsrat oder Vereine. Die Bevölkerung signalisiert ein großes Interesse sich an diesen Prozessen zu beteiligen, allerdings fehlt bisher der passenden Rahmen dazu. Eine professionell moderierte Auftaktveranstaltung wird als Plattform für die beteiligungsorientierte Ortsentwicklung genutzt, um hierfür erste Impulse zu setzen. Relevante Themen wie Leben im Alter, Nachbarschaftshilfe, Kinderbetreuung, Jugend im Dorf, regionale Nahversorgung, Dorfgestaltung, klimafreundliche Energieversorgung werden gemeinsam eingegangen.
Der Verein engagiert sich für die Bedürfnisse der Bürgerschaft im Freiburger Stadtteil Weingarten, um dem negativen Trend im Stadtteil mit ihren Ideen und ihrem Engagement entgegen zu wirken. Das Ziel des Projekts ist es, ein partizipatives Planspiel mit dem Titel „Aus dem Alltag von Superhelden“ im öffentlichen Raum zu entwickeln und Teile davon nachhaltig zu verankern. Das Potenzial und die Bedürfnisse des Stadtteils Weingarten, in dem 90 verschiedene Sprachen gesprochen werden, werden dabei entfaltet und gemeinsam weiterentwickelt. Das künstlerische Format wird von einem interdisziplinären Zusammenschluss aus Einzelpersonen und Organisationen aus dem Kulturbereich, der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Quartiersarbeit initiiert. Der Beratungsgutschein wird zur Prozessgestaltung und Projektplanung eingesetzt.
Die Initiative bietet Workshops zum PV-Ausbau an. Aufgrund der hohen Nachfrage aus der Bevölkerung liegt der Schwerpunkt auf Balkonkraftwerken. Zudem werden Gerätschaften zur Montage unentgeltlich verliehen und den Bürger*innen beratend zur Seite gestanden. Dadurch werden die Teilnehmenden zur eigenständigen Montage von Balkon-PV befähigt und unterstützt.
Der Kulturparkett Rhein-Neckar e.V setzt sich für kulturelle und soziale Teilhabe-Gerechtigkeit ein. Mit der Vision "Kultur für alle" stellt die Initiative Kartenkontingente interessierten Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung. Mit der Kartenvermittlung eröffnet der Verein neue niedrigschwellige Räume für Austausch und Begegnung.
Das Beteiligungsprojekt Kultur-Tandem setzt hier an und ermöglicht Begegnungen von Menschen, die sonst nicht zusammen kommen würden. Mit über 10 Kooperationspartnern werden Menschen aus sozial und finanziell benachteiligten Lebenslagen eingebunden. Das Kulturparkett matched Tandem-Paare anhand ihrer kulturellen Interessen aus einem Pool und begleitet sie beim Veranstaltungsbesuch.
ICH ZEIGE DIR - DU ZEIGST MIRAuf Augenhöhe voneinander lernen.
Die Sprache soll dabei vorerst noch nicht im Mittelpunkt stehen.
Durch die Initiative entsteht ein gemeinschaftliches Wohnprojekte, welche durch neun Parteien initiiert wurde und andere Menschen inspirieren soll, auf Einzelbesitz zu verzichten und in Gemeinschaft zu leben, wobei jede*r einen eigenen Rückzugsort weiter für sich hat. Das Konzept basiert auf der Idee, dass Gemeinschaft und geteilte Ressourcen die Lebensqualität erhöhen, soziale Bindungen stärken und nachhaltiges Wohnen fördern. Beraten wird die Initiative zu Themen der Umsetzung des Projekts, u.a. zur Rechtsform, der anvisierten Mieten, sowie Plänen und Kostenkalkulation.
Der Arbeitskreis Asyl Bad Boll möchte das Dorf als interaktives Wörterbuch gestalten: Gegenstände, Gebäude usw. sollen gemeinsam mit Menschen mit Fluchterfahrung unter anderem in Deutsch, Arabisch und weiteren Sprachen beschriftet werden. Bedeutung und Bedeutungsinhalte sollen allen Personen in Bad Boll zugänglich gemacht werden und es soll zum "Lernen im Vorübergehen" anregen. Zusätzlich sollen Fotografieren der Aktion ausgestellt sowie Gesprächsrunden dazu organisiert werden.
Zunächst kam es zur Bildung einer Projektgruppe mit Hilfe des Stadtseniorenrates aus Betroffenen und interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in Bad Liebenzell verantwortlich ist. Anschließend erfolgt die Aufnahme des derzeitigen Ist-Zustandes, die Auswertung und die Information über bereits bestehende Barrierefreiheit. Gemeinsam soll in weiteren Schritten besprochen und geplant werden, wie die Umsetzung der Barrierefreiheit für die Bürger in Bad Liebenzell gestaltet werden soll, damit die Menschen in allen Lebenslagen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können.
Die zivilgesellschaftliche Gruppe "Bürger aktiv für Fellbach" (kurz: BAFF) arbeitet seit 15 Jahren eng mit der Stadt zu verschiedenen Themenstellungen. In der Coronakrise und aufgrund des Shutdowns hat sich eine digital arbeitende Arbeitsgruppe gebildet, die auch gemeinsam am bundesweiten Hackathon gegen die Coronakrise mit dem Titel "WirVsVirus" teilgenommen hat. In Fellbach möchten die Engagierten nach den Krisenerfahrungen, in denen auch andere Bürgergruppen nicht in den direkten Kontakt treten konnten, eine Beteiligungsplattform ins Leben rufen, um vor Ort die digitale Vernetzung von Ehrenamt und Bürgerbeteiligung zu unterstützen. Angelehnt werden könnte die Plattform an den "Gerlinger Online Manager" mit dem in Gerlingen die Aktivitäten der Mitmachzentrale digitalisiert wurden. Die Fellbacher Gruppe will diese Plattform nun auch vor Ort als "digitales Vereinsheim" zur Vernetzung unterschiedlicher Bürgergruppen etablieren. Dabei soll der Raum explizit nicht nur den BAFF-Gruppen offen stehen, sondern der ganzen aktiven Bürgerschaft zugänglich gemacht werden. Ehrenamtliche aus der Gruppe des Antragstellers wollen dabei laut Antrag interessierten anderen Gruppen eine Einführung in die Plattform geben.
Das Ziel des Projektes ist die Bereitstellung einer Beteiligungsplattform zur digitalen Vernetzung von Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in Fellbach. Mit einem Online-Portal werden nicht nur eigene Projekte und Gruppen online abgebildet, sondern auch anderen Gruppen, Vereinen und Verbänden aus Fellbach wird die Möglichkeit der digitalen Vernetzung geboten. Ein digitales Bürgerengagement funktioniert nur durch aktives mitmachen. Beratung zur erfolgreichen Projektumsetzung.
Die Initiative bildet zu regenerativen Energien weiter, informiert in Veranstaltungen zu aktuellen Klima-und Energiethemen und unterstützt bei der Umsetzung. Durch Werbemaßnahmen und Kino-Veranstaltungen erhält die Initiative eine höhere Aufmerksamkeit und streut somit das Wissen in die Bevölkerung. Finanzielle Unterstützung erhält die Initiative neben den Werbemaßnahmen ebenfalls für die Anschaffung einer Balkon PV-Anlage und Messgeräten.
In der Gemeinde Horben gibt es aktuell keine direkte Nahversorgung, daher ist ein Bürgerladen mit den Waren des täglichen Bedarfs essentiell. Die Initiative erhält die Fachberatung zur Erstellung der Machbarkeitsstudie und zur Entwicklung der Umsetzungsstrategie für ein DORV-Zentrum.
Der Arbeitskreis „Genossenschaft Naturenergie Gaildorf“ möchte sich am geplanten Bau von vier Windrädern in Gaildorf beteiligen. Beratung erhält der Arbeitskreis zur möglichen Ausgestaltung der Beteiligungsstrukturen in Form einer Prozessbegleitung.
Der Verein Freundeskreis Mensch e.V. strebt die Errichtung von Hochbeeten sowie eines Gemeinschaftsgartens an. Hierfür wird eine Außenfläche zwischen der Loretto-Werkstatt und dem Familienzentrum in Tübingen gemeinsam mit Menschen mit Behinderung umgestaltet. Der Bereich soll zukünftig auch als Treffpunkt und zur Wissensvermittlung genutzt werden, wobei vier Themen im Fokus stehen: Erlernen des Umgangs mit Umwelt und Natur, die Übernahme von Verantwortung, unterschiedliche Sinneserfahrungen erleben sowie das Erleben, woher das Gemüse aus dem Supermarkt kommt. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen, am Gemeinschaftsgarten mitzuwirken und diesen dauerhaft zu pflegen.
Das Klimaforum Ihringen-Wasenweiler ist entstanden, um konkrete Maßnahmen zum Klima- und Naturschutz vor Ort zu finden und umzusetzen. Hauptthema des Bürgerforums ist die Dekarbonisierung durch nachhaltigen Klimaschutz. Die Gruppe trifft sich regelmäßig und steht im Kontakt mit dem Gemeinderat.
Mit dem Projekt Baumpatenschaft erklären sich Bürger bereit, für die ersten drei Jahre nach Baumpflanzung die Bewässerung des gepflanzten Baums zu übernehmen. Die Versorgung mit Wasser (200 Liter/Woche) erfolgt größtenteils mit dem Fahrrad oder zukünftig mit dem Lastenrad. Die Baumpflanzung verbessert die globale CO2-Klimabilanz, bietet Lebensraum für Insekten und Vögel und sorgt für Beschattung und Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.
Die Global Marshall Plan Lokalgruppe Freudenberg schafft seit 2012 in Freudenberg Räume für die Bürger, um über das Thema gerechte Globalisierung zu diskutieren. Die Gruppenmitglieder engagieren sich darüber hinaus im Rahmen der Initiative „Plant-for-the-Planet" und für die lokale Fair-Trade-Kampagne. Durch das lokale Engagement wurde Freudenberg am Main auch zur ersten „Fairtraide-Stadt“ im Main-Tauber-Kreis. In diesem Umfeld möchte die Gruppe mit ihrer Arbeit vor Ort einen Beitrag zur weltumspannenden Transformation von Wirtschaft und Gesellschaften mit ökologischem und sozialem Leitbild leisten. Mit dem Beteiligungsprojekt „Bäume pflanzen für Klimagerechtigkeit " in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Revierförster werden Bürger für das Thema Generationengerechtigkeit sensibilisiert. Bei der Baumpflanzaktion können die Bürger direkt im Stadtwald ihren Nachhaltigkeitsbeitrag leisten. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Anschaffung der Baumsetzlinge anfallen.
Die Bürger:innen-Initiative setzt sich dafür ein, dass die Klimakrise und das Artensterben verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und lokal Lösungen gefunden werden. Die Initiative verbindet drei Kommunen (Lauf, Ottersweier und Sasbach) und hat bereits ein Klimagespräch durchgeführt. Daraus haben sich diese beiden Themen herausgebildet, die nun durch die Initiative umgesetzt werden. Zum einen die Begrünung der Gemeinden, dazu wird eine Baumpflanzaktion durchgeführt. Zum anderen das Thema Wasser, zu dem zwei Referenten eingeladen werden, um über das Thema mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die beiden Themen beziehen sich aufeinander und verfolgen zum einen den praktischen und zum anderen den theoretischen Ansatz.
Die Gartenfreunde Weidenfeld möchten durch die Erstellung eines nachhaltigen Wildbienen-Themengartens am Eingang ihrer Kleingartenanlage die Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit der Wildbienen und Hummeln aufmerksam machen. Besucher*innen, Wander*innen und Vereinsmitglieder sind dazu eingeladen, sich mit dem Thema zu befassen und durch Pflanzaktionen, Bienennisthilfen, Infotafeln, Vorträgen vom BUND und weiteren Aktionen vor Ort sich für das Thema zu engagieren.
Die Gruppe setzt sich für die Quartiersentwicklung des Ortsteils Kau ein. In einer Papier- und Onlinebefragung werden Ideen für die zukünftige Ortsentwicklung gesammelt und ausgewertet. Beratung zu Entwicklung des Fragebogens gemeinsam mit der „Zukunftswerkstatt Kau“.
Unter dem Motto "Begegnung im Musikerviertel" richtet der Ettlinger Frauen- und Familientreff einen Bürgerbeteiligungsprozess im gleichnamigen Ettlinger Stadtviertel aus. Der Prozess ist eng angedockt an das im Quartier bereits gut vernetzte Familienzentrum. Weitere Begegnungsmöglichkeiten und gut besuchte Treffpunkte existieren bisher jedoch nicht. Das soll sich im Beteiligungsprozess nun ändern, der mit einer Pflanzentauschbörse im Frühjahr eingeläutet wird. Hier besteht die erste Gelegenheit für eine Begegnung von Nachbarn aus dem Viertel unabhängig von ihrem Alter, der Religion oder der Sprache. Im Anschluss geht die Breite Beteiligung in einen generationenübergreifenden Bürgerdialog über. Im Prozess erarbeiten die Teilnehmer spezifische Bedarfe für das Musikerviertel, die zu einer weiteren Belebung des Viertels beitragen. Die Bedarfe sowie erste Maßnahmenvorschläge werden von der Moderation zusammen mit einem vereinbarten Zeitplan zur Umsetzung dokumentiert. Ein Schaukasten sowie eine Chat-Gruppe halten alle Interessierte über den aktuellen Prozessstand auf dem Laufenden.
Hoffnungsträger Stiftung

In einem neu entstehenden Wohngebiet sollten die Bewohner des "Hoffnungsorts" pünktlich zum Einzug in Austausch gebracht werden. Das Vorhaben war so geplant, dass Veranstaltungen mit einer Befragung gemischt angeboten werden. Über die Fragebögen sollten Angebote ermittelt werden, die vor Ort gebraucht werden.
Der Verein Miteinander Stegen e.V. hat das Ziel durch Bürgerengagement und Bürgernetzwerke soziale Problemlagen zu erkennen und hierfür Hilfestellung zu leisten. Zur Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde soll das Projekt „Begegnungshaus Lebensräume“ umgesetzt werden. Beratung erhält der Verein zu Fragen eines möglichen Betreibermodells.
Das Lebensmittelkollektiv Ettenheim richtet eine Ideenwerkstatt aus, um vor Ort einen Treffpunkt in zentraler Lage zu schaffen, der verschiedene Gruppen anspricht. Im „LebensMittelpunkt“ will die Gruppe Veranstaltungsangebote zum Thema bewusste Lebensmittelversorgung und Ernährungssouveränität anbieten. Auch ein Café ohne Konsumzwang ist vorgesehen. Ziel ist die Belebung der Innenstadt und die Stärkung bereits vorhandener Geschäfte. In der Ideenwerkstatt können interessierte Bürger weitere Nutzungen für den Treffpunkt einbringen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für den Druck von Flyern und Plakaten zur Bewerbung der Ideenwerkstatt anfallen.
Der Begegnungsraum ist seit 2016 ein Treffpunkt in Stuttgart Mitte für alle dauerhaft oder nur vorübergehend in Stuttgart lebenden Menschen. Er ist geschaffen, um den Austausch zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern und friedliches Zusammenleben und Solidarität innerhalb einer diversen Gesellschaft zu stärken. Es ist ein Erfahrungsraum, der durch unterschiedliche Angebotsformate das Selbstverständnis einer offenen Gesellschaft im urbanen Raum verankert. Die Beratung wird für einen Analyse-/Reflexionsprozess der bisherigen Arbeit, des Profils und der Organisationsstruktur benötigt, um den Begegnungsraum zukunftsfähig zu machen und zu stärken. Der „Begegnungsraum“ ist im Rahmen der Förderung bei "Vielfalt gefällt! Orte des Miteinanders“ entstanden. Es ging dabei um die Bespielung des Raumes mit integrativen Angeboten.
Die Initiative besteht aus Studierenden, Geflüchteten und Engagierten, die gemeinsam einen Begegnungsraum in Stuttgart gebaut haben. Dieser Raum soll nun durch einen partizipativen und prozessorientierten Ansatz mit Inhalten gefüllt werden. Gemeinsam mit der Abteilung Integration wurden von April - Mai 2017 die Bedarfe abgefragt. Geflüchtete erhalten die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen.
Ziel ist es, Begegnungen zwischen alten und jungen Menschen zu ermöglichen und die Bewohnerinnen und Bewohner beim Gestalten ihres Stadtteils hin zu einer verbesserten Wohn- und Lebensqualität zu begleiten. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Quartiersarbeit und der Anpassung der Organisation des Projekts an zukünftige Herausforderungen soll ein Runder Tisch eingerichtet werden. Mit am Tisch sitzen sollen Bewohner des Quartiers sowie Initiativen vor Ort und Vertreter des Quartiersmanagements und der Stadt Kirchheim.
Q-PRINTS&SERVICE gGmbH



Die Pforzheimer Weststadt liegt zentral, angrenzend an die Innenstadt und an das Enzufer und bietet Lebens- und Wohnraum für viele Menschen.
Das erste Nachbarschaftsgespräch fand in einer temporären Spielstraße statt. Etwa 16 Personen zwischen 16 und 84 Jahren waren der Zufallseinladung gefolgt. Nach einem gemeinsamen Essen wurde eine Kennenlernrunde durchgeführt und Erwartungen formuliert. So wurde zum Beispiel genannt: vermüllte Plätze sollen beseitigt werden, Ehrenamt soll entstehen und der Stadtteil soll für alle attraktiv sein. In einem anschließenden Workshop wurden weitere Ideen zum Stadtteil gesammelt. Die Teilnehmenden sollten herausarbeiten, was sie an ihrem Stadtteil besonders mögen, was sie kritisch sehen und was sie sich noch für die Weststadt wünschen.
In einem weiteren Nachbarschaftsgespräch wurde zunächst zu einem Essen und Ankommen in lockerer Runde eingeladen. Trotz des nasskalten Wetters an diesem Tag starteten die Teilnehmenden motiviert zum Stadtteilspaziergang. Ein Mitarbeiter der Technischen Dienste und der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung begleiteten die Begehung und hatten ein offenes Ohr für die Bewohner. Während des Spaziergangs konnten Anregungen für die entsprechenden Stationen an die anwesenden Akteure weitergeben. Nach dem einstündigen Spaziergang folgte ein Workshop im Lukaszentrum. Es ging um konkrete Ideen zur Aufwertung des Stadtteils, die dann auf Plakaten in kleinen Gruppen ausgearbeitet und im Plenum vorgestellt wurden.
Ein weiteres Treffen konnte mit dem ersten Bürgermeister vor Ort stattfinden. Nach einem gemeinsamen Essen und Ankommens-Gesprächen stellte die Moderatorin vor, was von der Stadtverwaltung als Anregungen bereits umgesetzt wurde. So konnte ein Müllplatz von Sperrmüll und Unrat geräumt werden, sodass der Platz ordentlich und aufgeräumt ist. Insgesamt war aufgrund der ausgerufenen Corona-Alarmstufe und hohen Inzidenzzahlen eine spürbar geringere Teilnehmerzahl an diesem letzten Treffen anwesend. Trotzdem konnten alle vier erarbeiteten Plakate von den Teilnehmenden selbst vorgestellt werden. Anschließend wurde darüber diskutiert, welche Ideen weiter umgesetzt werden sollen.
Die Sozialgemeinschaft Herrenzimmer initiiert in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen direkt am Dorfplatz einen Begegnungsort, insbesondere für ältere, einsame Menschen und entwickelt entsprechende Angebote und Nutzungsmöglichkeiten. Als Ankernutzung wird die Pfarrbücherei in die Begegnungsräume umziehen. Die Beratung gibt es für die Konzeption und Vorbereitung eines Beteiligungstages, für gemeinsame Entwicklung von Angeboten mit der Bürgerschaft sowie zur Neukonzeptionierung der Bücherei.
Aufbau eines Begegnungszentrums nach dem Konzept der Mehrgenerationenhäuser (MGH) mit einem Café in Form eines offenen Treffs und verschiedenen Angeboten. Beratung zu Konzeptentwicklung.
Ehrenamtliche Helfer haben sich im Arbeitskreis Migration Achern (AMA) mit dem angegliederten Verein "VAMA" e.V. zusammengefunden, um Geflüchtete und Migranten in Achern bei ihrer Alltagsbewältigung und Integration zu unterstützen. Zur Organisation der Aufgaben wurden folgende Bereiche gegründet: Café International, Hausaufgabenbetreuung, Deutschkurse, Geschirr- und Kleiderladen, Fahrradwerkstatt, Möbellager, Beratungscafé. Ein Begegnungszentrum für alle Acherner ermöglicht die Teilhabe an der Gestaltung des Zugsamenlebens in der Gemeinde und bietet Unterstützung für Menschen in ökonomischen oder sozial schwierigen Situation. Zu diesen Gruppen zählen Geflüchtete, Migranten, Alleinerziehende, Senioren, Arbeitssuchende, Menschen mit Behinderung. Das bürgerschaftliche Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Begegnungszentrums. Die Ehrenamtlichen werden aktiv in die Arbeit miteinbezogen. In einem Beteiligungsworkshop werden zudem weitere Ideen und Aktivitäten für das Begegnungszentrum mit den Beteiligten entwickelt.
Eine Initiativgruppe will in der Kirchzartener Innenstadt das „alte Rathaus“ neu beleben. Mit Beteiligung der Bürgerschaft sollen verschiedenste Nutzungen für das Gebäude eruiert werden. Die Basis allen Handelns soll eine Bürgergenossenschaft sein, die den finanziellen Grundstock des Projekts bilden soll. Beratung erhält die Initiative zur Gründung einer Bürgergenossenschaft sowie zur Wirtschaftlichkeitsberechnung des Gastronomie- und Boardinghousebetriebs.
Die Initiative „Bemerkenswerte Lebenserinnerungen, Ausstellung“ möchte zur Erinnerungsarbeit beitragen, indem Sie Personen darstellt, die vom Leben und Arbeiten in ländlichen Dörfern berichten. Daneben soll ein interaktives Begleitprogramm neben Schulklassen, Erwachsenen die Geschichte wirtschaftlich und kulturell erfahrbar machen. Beratung erhält die Initiative zu Fragen der Prozessausgestaltung.
In Baiersbronn wurde eine Veranstaltungsreihe zum Thema: „Vom Flüchtling zum Mitbürger – Integration gemeinsam gestalten!“ durchgeführt. Dabei wurde zum einen bearbeitet, wie es um die Arbeit im Freundeskreis steht; dazu wurden Personen mit Fluchterfahrung zum Thema Integration befragt. Im Projekt sollen diese Ergebnisse nun in den verschiedenen Gremien der Gemeinde Baiersbronn präsentiert werden. Anschließend soll gemeinsam erarbeitet werden, wie mit den Ergebnissen weiter verfahren werden soll.
Der Freundeskreis plant eine Vereinsgründung und wünscht sich in diesem Zuge Beratung zu Aspekten des Vereinsrechts und Vereinszwecks. Dazu soll eine Rechtsberatung zur Unterstützung der Geflüchteten in den jeweiligen Asylverfahren Teil der Beratungsleistung sein.
Bürger für Bürger eG tritt durch ihre Tätigkeit in der Nachbarschaftshilfe als kompetenter Ansprechpartner und Beratungsstelle für Menschen auf, die Fragen rund um die Themen Alter, Pflege und Betreuung haben. Eine solche Beratungsstelle wird in Form eine Seniorenbüros aufgebaut. Die Beratung erfolgt zu der Bildung einer Beratungsstelle und der Integration in die bestehende Organisation. Zudem besteht Interesse darin zu wissen, welche Beratungsthemen direkt angeboten werden und welche über das Netzwerk abgewickelt werden. Außerdem ergänzt die Beratung die Themen Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, Projektfinanzierung und Projektförderung.
Das Anliegen des Stadtseniorenrats e. V. in Heimsheim ist es, den Menschen in ihrer Stadt die Möglichkeit zu geben, solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Dazu gehört vor allem eine barrierefreie Infrastruktur wie Gehwege, Radwege, Straßenübergänge, etc. für alle Bürger. Diese dient neben der Sicherung der Lebensstandards und der Mobilität auch dem kommunikativen Austausch der Bürger in den unterschiedlichen Lebensphasen und -stadien. In diesem Projekt geht es um die Erfassung des Ist-Zustandes und der Ausarbeitung möglicher Lösungen zusammen mit Betroffenen und der Gemeinde.
Das Projekt setzt sich zum Ziel, in Marbach eine Bestellgemeinschaft (BeGeMa) aufzubauen, um Großmengen vom nächstgelegenen Unverpacktladen (Ludwigsburg) abzunehmen und Lebensmittel direkt von umliegenden Erzeugern zu beziehen, die innerhalb der BeGeMa verteilt werden. Dies soll möglichst verpackungsfreies und lokal-ökologisches Einkaufen ermöglichen. Die Beratung erhält die Initiative für den konzeptionellen und effizienten Projektaufbau.
Die Initiative „Beteiligung ausländischer Mitbürger in Rottenburg am Neckar“ hat ein Gremium geschaffen, mit dem die Beteiligung von Migranten in Rottenburg institutionalisiert worden ist. Das Gremium ist auf politischer Ebene aktiv und gestaltet das Gemeinwesen in Rottenburg mit.
Der Gesamtelternbeirat setzt sich für die Interessen von Kindern und Eltern ein und sucht zusammen mit Akteuren der Zivilgesellschaft und Mitgliedern des Familienforums Reutlingen nach Lösungen, um den Mangel an Kitaplätzen zu beheben. In Reutlingen fehlen im Kitajahr 2022/23 rund 700 Plätze. Mit ihrer Beteiligungsinitiative setzen sie einen bürgerschaftlichen Prozess in Gang, um niedrigschwellige und schnell wirksame Möglichkeiten zu identifizieren. Ihr Ziel ist es, Ursachen für den Personalmangel und dafür kreative Lösungen zu identifizieren, kreative Betreuungsformen zu entwickeln, die Plätze zu schaffen, Bürger für neue Wege der Kinderbetreuung interessieren und zu eigenen Initiativen motivieren. Dazu bilden sie ein Kernteam, die den Arbeits- und Beteiligungsprozess steuern. Dieser besteht aus einer Analyse und Ideenwerkstatt sowie die Erarbeitung von Handlungsvorschlägen und Initiieren von ersten Initiativen.
Das Projekt ermöglicht die Weiterentwicklung des Ehrenamts in Offenburg, indem Menschen vor Ort zielgruppengerechter angesprochen, Strukturen und Angebote überprüft und Stadtteilbewohner*innen in Partizipationsprozesse einbezogen werden. Die Beratung erfolgt u.a. zu den Themen Projekt-und Prozessplanung, Quartiersarbeit und Schwerpunktsetzung von Aufgaben.
Im Zuge des Projektes werden Wiesengrundstücke in Blühwiesen umgewandelt sowie eine bestehende Wiese durch Neupflanzung von Obstbäumen als Streuobstwiese aufgewertet, deren Früchte später von allen geerntet werden können. Diese Aktionen sollen als Initialzündung im Stadtteil wirken. Zukünftig sollen weitere Flächen folgen, auch Privatpersonen sollen durch diese Vorbildflächen animiert werden, ihre Flächen klima- und biodiversitätsfreundlicher anzulegen. Der Blühstreifen werden mit künstlerischen Holzsteckern ergänzt, die in ehrenamtlicher Arbeit entstanden sind.
Die Initiative Bewegtes Laufenburg setzt sich für eine umweltverträgliche, autoreduzierte und zukunftsfähige Mobilität ein. Ein E-Auto zum Leihen wurde bereits zur Verfügung gestellt, dieses Angebot soll weiter bekannt gemacht werden. Diesem ersten Angebot sollen weitere Mobilitätsmaßnahmen folgen, die zum Umdenken beitragen, weniger das eigene PKW zu nutzen, sondern auf das Fahrrad und den ÖPNV umzusteigen.
Der Arbeitskreis Asyl in Weinheim ist seit mehr als 30 Jahren in der Asylarbeit tätig. Die starke Zuwanderung geflüchteter Menschen im Jahr 2015 löste eine Welle des Engagements aus, seit 2017 ist hier ein Rückgang des Engagements für Geflüchtete spürbar. Ehrenamtliche und auch Geflüchtete ziehen sich zurück. Diese Veränderungen werden im Rahmen des Projektes analysiert: Warum kommt es zu Beziehungsabbrüchen und wie kann man diesen entgegenwirken? Warum und wie gelingt der Beziehungsaufbau? Sowohl Engagierte als auch Geflüchtete werden in diesen Prozess eingebunden. Im ersten Schritt werden leitfadengestützte Interviews durchgeführt, um die aktuelle Situation zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme werden im Rahmen eines Workshops beiden Gruppen und anderen Initiativen vorgestellt und gemeinsam diskutiert. Ein Ziel ist es, den Bedarf an Unterstützung zu erfassen und daraus Vorschläge für die Praxis zu entwickeln. Der Beratungsgutschein wird für die Projektentwicklung und Durchführung benötigt. Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag.
Verbesserung der örtlichen Infrastruktur, des wohnlichen Umfeldes und Verbesserung der sozialen Kontakte der Bürgerinnen und Bürger
Wie soll in einem beschaulichen Ort mit ca. 3.600 Einwohner der Tourismus gesichert/gefördert werden? Teile der Bevölkerung befürworten den Bau eines Wohnmobilstellplatzes und einer großen Hotelanlage. Kritiker befürchten eine herbe Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes und die Schädigung der touristischen Pfründe von Beuren. Sie überlegen, wie sich das Vorhaben auf den Klimawandel und auf die nicht erneuerbaren Ressourcen für nachfolgende Generationen auswirkt.
Diese und ähnliche Fragen wollen wir offen und transparent angehen. Dafür wollen wir ein Bürgerforum gründen und die informelle Bürgerbeteiligung stärken: Gemeinde und BürgerInnen, sollen rechtzeitig und im konstruktiven Dialog Ideen und nachhaltige Projekte für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde finden und umsetzen.
Die Initiative errichtet eine "Bibliothek der Dinge". Hier können Gegenstände ausgeliehen werden, die meist nur selten gebraucht werden oder die man erst einmal kennen lernen und ausprobieren möchte. Vorstellbar sind hier verschiedene Gegenstände, wie z.B. eine Eismaschine, ein Hochdruckreiniger etc. Die Bibliothek der Dinge leistet damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum umweltbewussten Konsum. Auch hat sie einen sozialen Aspekt, da beim Leihen dem Einzelnen nicht so hohe Kosten entstehen wie beim Kaufen. Zur Eröffnung wird es eine große Informations-Veranstaltung geben.
Die Bürger Energiegenossenschaft Endingen (BEGE) möchte aktiv den Aufbau eines bidirektionalen Wärmenetzes mit einem Regenerationspuffer im Neubaugebiet begleiten. Beratung benötigen sie dabei zur Projektdurchführung von bereits erfahrenen Projektverantwortlichen zum Thema.
Der Seniorenbeirat unterstützt das Seniorenbüro dabei, die Seniorenarbeit in Bietigheim effektiv zu gestalten, zu ergänzen und zu vernetzen. Die Projekte unter dem Titel „Bietigheim vernetzt“ werden in Kooperation mit der Dr. Jakob Kölmer-Bürgerstiftung geplant und durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, eine Begegnungsstätte für alle Generationen in der ehemaligen Gaststätte Löwen zu schaffen. Der Beratungsgutschein wird für die Projektentwicklung unter der Einbeziehung weiterer Organisationen und der Beteiligung der Bürgerschaft eingesetzt.
Wie sich verständigen, wenn man die fremde Sprache (noch) nicht ausreichend spricht, um seine Anliegen in Fachthemen wie Medizin oder Pädagogik vermitteln zu können? Auf Google Translate ist bei wichtigen Themen wie der Medizin kein Verlass! Wir entwickeln multilinguale Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprachbarrieren, sei es nun, dass man zugewandert ist oder aufgrund einer Krankheit die Sprache verloren hat. Viele Dokumente stehen zum kostenlosen Download auf unserer Webseite. Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen auf.
Stärkung und Unterstützung von Familien und Einbindung von Freiwillig Engagierten
Die Vereinsgründung erfolgte nach Teilnahme am Runden Tisch "Fonds für
Beteiligung" der Allianz für Beteiligung im Jahre 2020. Hauptzweck ist die
Förderung zielgruppenübergreifender Teilhabe basierend auf einem breiten
Inklusionsverständnis. Unser Verein versteht sich als Brückenbauer und Ermöglicher. Wir
beraten und unterstützen Privatpersonen bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, aber auch bürgerschaftliche Initiativen, die sich in der Gestaltung ihres Quartiers und damit der Stärkung unseres strukturschwachen ländlichen Raumes engagieren. Gleichzeitig
engagieren wir uns auch überregional, z.B. in der Hochwasserhilfe, um Zeichen
zu setzen und dazu anzuregen, über den Tellerrand zu schauen. Alle Aktiven
engagieren sich ehrenamtlich.
Der Verein Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz setzt sich für den Erhalt der Streuobstwiesen ein und ist Hersteller des Sulzer Apfelsafts, bietet Baumkartierung und Qualifizierungsangebote und weitere Aktivitäten rund um das Thema Streuobstwiesen an. Zudem hat er eine digitale Vernetzungsplattform als Treffpunkt für Engagierte, Gruppen und weitere Sulzer Vereine aufgebaut. Zukünftig möchte der Verein seine Aktivitäten für ein nachhaltiges Sulz verstärken und hat dazu in Kooperation mit der Stadtverwaltung Workshops durchgeführt.
Aus dem durchgeführten Klimagespräch ist das folgende Projekt hervorgegangen und von den Teilnehmenden zur Umsetzung empfohlen.
In einem oder zwei Sulzer Quartieren sollen gemeinsam mit den Bürger*innen modellhaft Wege der Müllvermeidung und der Zuführung in den Wertstoffkreislauf erprobt werden. Damit soll ein Beitrag zur Sauberhaltung von Grundwasser und Böden erreicht werden. Maßnahmen der Müllvermeidung, Sammelaktionen, Bewusstseinsbildung und Infomaterial sowie ein aktiver Dialog mit den Bürger*innen im Quartier sind Bestandteile des Projekts. Zudem sollen insektenfreundliche Blühflächen in den Quartieren geschaffen werden.
Der Musikverein Sulz engagiert sich neben Musik, auch für Umwelt- und Klimaschutzthemen und setzt sich in der Sulzer Innenstadt für insektenfreundliche Blühflächen ein. Mehrjährige Blühstauden und Blumenzwiebel werden dazu gepflanzt und dafür übernimmt der Musikverein die Patenschaft zur Pflege der Fläche. Zudem plant der Musikverein Platzkonzerte bei den Blühflächen und verbindet damit Musik und Klimaschutz.
Die Streuobstfreunde Bergfelden setzten sich ehrenamtlich für die Streuobstbestände ein und leisten damit einen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung der örtlichen Kulturlandschaft und Artenvielfalt. Auch die Umwandlung des innerörtlichen Grüns in ein innerörtliches Bunt gehören zu den Vereinszielen.
Für das Anlegen von Blühstreifen hat der Verein Konzepte entwickelt, zum einen Blühenden Schulweg und zum anderen Blühende Trittsteine bei der Ortsdurchfahrt. Ziel ist es, Kinder und Erwachsene für die Vielfalt der Natur zu sensibilisieren. Auf einem Blühstreifen auf einem Schulgelände soll eine Versuchsfläche entstehen, die mit mehrjährigen heimischen Blühmischungen eingesät und mit Stauden bepflanzt werden soll.
Mit dem Konzept "Gut älter werden im Bodenseekreis" bietet der Landkreis seinen Gemeinden ein modulares Baukastensystem für einen niederschwelligen Einstieg in die Quartiersentwicklung und zur Gestaltung der Herausforderungen des demographischen Wandels mit aktiver Beteiligung der Bürger*innen. Die Veranstaltungen haben das Ziel, gemeinsam mit den Multiplikator*innen und Interessierten vor Ort den Handlungsbedarf in der jeweiligen Gemeinde zu erheben, zu konkretisieren und auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen.
Mit der kreisangehörigen Stadt Meersburg sowie mit der Gemeinde Langenargen ist eine intensive Zusammenarbeit vereinbart, die die Begleitung und Unterstützung konkreter Maßnahmen und Schritte zur "Sorgenden Gemeinde" umfasst.
Darüber hinaus soll im Rahmen der landkreisweiten Vernetzung, bürgerschaftlich Engagierten und Verantwortlichen aus ähnlichen Projekten die Gelegenheit zum kreisweiten Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung eröffnet werden.
Die Bürgerinitiative zur Förderung der „Dorfmitte Bolstern“ setzt sich für die Stärkung der Gemeinschaft und das generationsübergreifende Miteinander im Ort, für den Ausbau der nachbarschaftlichen Unterstützung, Verbesserung der Mobilität, für die Schaffung eines Treffs und Nahversorgungsangebotes mit Café sowie für die Entwicklung neuen Wohnens in der Dorfmitte ein. Die Beratung erfolgt zur konzeptionellen Projektentwicklung und zum Prozess der Bürgerbeteiligung für den „Aktiv Tag Bolstern – Zukunft gemeinsam gestalten“ zur Erarbeitung von gemeinsamen Ideen für die genannten Themenschwerpunkte.
Im Zuge des Projektes werden sechs verschieden Filme mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Themenfeld Klima gezeigt. Gestartet wird jeweils mit einem Impulsvortrag zum jeweiligen Themenbereich, der zum Filmthema "hinführt". Dafür werden verschiedene Fachleute u.a. aus der Gemeindeverwaltung eingebunden. Im Anschluss an den Film findet eine Diskussionsrunde mit den Zuhörenden statt, welche in einen kurzen Ideenworkshop mit konkreten Maßnahmen für Bondorf übergeht.
Die Breuninger Stiftung wurde 1968 vom Unternehmer Heinz Breuninger und seiner Tochter Dr. Helga Breuninger gegründet. Eine Grundüberzeugung, die unsere Arbeit trägt, ist, dass es bei zukunftsfähigen Lösungen gesellschaftlicher Probleme in einer Demokratie auf das Zusammenspiel von Bürger*innen, Politik, Verwaltung und Wirtschaft ankommt.
Als unabhängige und gemeinnützige Organisation entwickeln wir operative Projekte in enger Zusammenarbeit mit Partnern, stoßen gesellschaftliche Diskurse an, initiieren Netzwerke und bauen Plattformen in der Bürgergesellschaft, die partizipative Entscheidungsprozesse ermöglichen. Außerdem bieten wir verschiedene Qualifizierungsformate für die Umsetzung von Beteiligungsprozessen (Runde Tische) an.
klimaPLAN_Besigheim hat sich gegründet, um dem Klimaschutz vor Ort eine Stimme zu geben. Mit Aktionen rücken sie die Notwendigkeit des Handelns stärker ins Bewusstsein. Ihr Ziel ist die Klimaneutralität Besigheims bis 2035. Die Initiative möchte in diesem Zusammenhang die Kommune beraten und Bürger*innen aufzeigen, wie sie Veränderungen mitgestalten können.
Im Rahmen des Projekts Klimaleine haben Bürger*innen 350 Pappen mit ihren Ideen für mehr Klimaschutz gestaltet. In einem Buchs werden diese Vorschläge zu klimaschützendem Handeln, Hinweisen zu CO2 Einsparungen und konkreten Maßnahmen veröffentlicht. Das Buch wird der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat überreicht und in der Stadtbibliothek ausliegen. Das Buch verfolgt folgende Ziele: Ideen der Bürger*innen würdigen, Klimaschutz im Stadtgespräch behalten, konkrete Möglichkeiten aufzeigen und Klimaneutralität voranbringen.
Der Hochwasserschutz an der Murr wird weitgehend von den kommunalen und staatlichen Wasserbehörden geplant, jedoch weitgehend ohne Beteiligung der betroffenen Bevölkerung. Deshalb soll das Projekt die Beteiligungsfähigkeit der Bürgerschaft in Umwelt- und Naturschutzfragen fördern, ferner die Bildung für nachhaltige Entwicklung an sich unterstützen. Ziel ist die Umsetzung eines nachhaltig-ökologischen Hochwasserschutzes an der Murr.
Das Projekt hat zum Ziel, Menschen in der Gemeinde auf die Schotterflächenproblematik aufmerksam zu machen und Beetpat*innen zu gewinnen, die sich langfristig um die Pflege nach der Pflanzung einsetzen. Neben Flächen der Gemeinde sollen auch private Schotterflächen bepflanzt werden. Die Bepflanzung sorgt unter anderem für ein verbessertes Mikroklima, verbesserte Regenwasseraufnahme und Lebensbedingungen für Straßenbäume, Erhalt der Biodiversität und im Zuge des Projekts auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein.
Der Verein plant die Entwicklung von "Runden Tischen des Dialogs". Mit einem selbsterbauten Tiny House soll in Stadtteilen Nürtingens gefahren werden und hierbei temporäre Orte des Dialogs entstehen. Vor Ort soll erfragt werden, was Personen mit Nürtingen emotional verbinden und wie sie die Zukunft sehen. Daraus soll ein Kunstprojekt resultieren, das die Nürtinger Vielfältigkeit erlebbar macht.
Die Lokale Allianz Besigheim ist ein Verbund aus Besigheimer Bürgern, Vertretern von Kommune und Vereinen sowie weiteren Akteuren. Mit der Veranstaltungsreihe "Bürger als Experten" schaffen sie einen Rahmen, der zu Austausch, Vernetzung sowie zum besseren Kennenlernen der eigenen Nachbarschaft einlädt. Die Veranstaltungen stehen allen interessierten Bürgern vor Ort offen. Die Bürger sind ausdrücklich eingeladen, sich selbst mit eigenen Ideen und Wissen in das Veranstaltungsformat einzubringen. Eine Stärkung der Stadtgemeinschaft im Sinne des Empowerment-Ansatzes ist Ziel des Projekts. Der Aufbau eines Nachbarschaftsnetzwerks steht als langfristige Idee hinter dem Projekt. Mit dem Beteiligungstaler werden Cateringkosten finanziert, die an den Veranstaltungen anfallen.
Wir hoffen, die junge Generation durch unser Projekt intensiver und aktiver in das Gemeindeleben neu und zukunftsweisend zu integrieren
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Version für ein gutes Leben im Dorf Wäschenbeuren für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen. Ein dorfübergreifender Bürgerbeteiligungsprozess öffnet einen Gestaltungsspielraum für ein soziales, generationsübergreifendes und inklusives Miteinander. Dabei soll besonders die Zukunft im Alter in den Blick genommen werden, damit die Menschen möglichst lange und selbständig in ihrem Zuhause bleiben können. Der Beratungsgutschein wird für die Organisation des Bürgerbeteiligungsprozesses benötigt.
Die Initiative hat ein Bürgerbeteiligungsprozess in Form einer Haushaltsbefragung angestoßen. Dieser soll nun im Folgenden professionell begleitet werden. Inhalte der Befragung waren beispielsweise: Zufriedenheit der bestehenden Angebotsstruktur, Bekanntheitsgrad der Quartiersarbeit sowie deren Projekte, Nachbarschaft und Ehrenamt. Die Haushaltsbefragung bildet das Fundament der weiteren Ausgestaltung der Quartiersarbeit. Die Ergebnisse werden zunächst intern im Netzwerk aufgearbeitet, um sie danach in Themenschwerpunkte zu unterteilen und in Form einer "Bürger Werkstatt Zukunft" der Bürgerschaft transparent zu kommunizieren.
In Herrenberg soll ein großes Bürger-Freizeit-Begegnungsgelände entstehen. Nachdem es bei einer städtisch geplanten Umsetzung der Freizeitanlage zu Protesten aus der Bevölkerung kam, steht die Überlegung an, das Gelände als Bürger Projekt gestalten zu lassen. Hierfür möchte der Kulturverein seine Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit bürgerschaftlichen Akteuren aus Herrenberg ein Konzept erarbeiten. Beratung erhält der Kulturverein zu Fragen des Projektmanagements.
Der Arbeitskreis der Lokalen Agenda 21 bietet seit einigen Jahren zahlreiche Angebote in der Gemeinde wie „Sorgende Gemeinschaft“ oder Bürger-Treff in Form von Sprach-, Bastelkursen, Spieleabenden, Ausflügen, Vorträgen usw. – insgesamt über 1000 gut besuchte Veranstaltungen in ungefähr 3 Jahren. Die Erweiterung der Angebote des Bürger-Treffs soll die soziale Vernetzung der Bürger stärken und weitere Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen anbieten. Beratung benötigt der Arbeitskreis zur Optimierung der Organisation, Gewinnung der neuen Mit-Macher, Entwicklung von Ideen, Öffentlichkeitsarbeit.
Belebung und Ausbau des Bahnhofgebäudes.
Im Quartiersentwicklungsprozess „Gutes Älterwerden in Nellingen“ fungiert die Bürgerstiftung Ostfildern als zivilgesellschaftlicher Partner der Stadt. Das Thema „Gründung und Aufbau einer Bürgerbaugenossenschaft“ wurde dabei nicht berücksichtigt, dagegen im Rahmen von „Gut Beraten!“ aufgegriffen, um die Idee der Bürgerschaft von gemeinwohlorientierten Wohnkonzepten auf genossenschaftlicher Basis zu entwickeln. Die Beratung wurde zur Klärung der rechtlichen Bedingungen bei der Gründung einer Bürgerbaugenossenschaft mit den Synergieeffekten in der Kombination mit einer Bürgerstiftung genutzt.
Im Quartiersentwicklungsprozess „Gutes Älterwerden in Nellingen“ fungiert die Bürgerstiftung Ostfildern als zivilgesellschaftlicher Partner der Stadt. Das Thema „Gründung und Aufbau einer Bürgerbaugenossenschaft“ wurde dabei nicht berücksichtigt. Dieser Aspekt soll im Rahmen von „Gut Beraten!“ aufgegriffen werden, um die Idee der Bürgerschaft von gemeinwohlorientierten Wohnkonzepten auf genossenschaftlicher Basis zu entwickeln. Die Beratung zu rechtlichen Bedingungen bei der Gründung einer Bürgerbaugenossenschaft mit den Synergieeffekten in der Kombination mit einer Bürgerstiftung.
Die Zukunftswerkstatt Kau setzt sich aus verschiedenen Bürgern und Ortschaftsräten zusammen, die in der Vergangenheit bereits ein eigenes Entwicklungskonzept für den Tettnanger Teilort Kau entwickelt haben. Die Entwicklung verlief nicht gekoppelt mit dem Prozess der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts für Tettnang. Der Gruppe geht nun gemeinsam mit der Gemeinde Tettnang und mit Einbezug der Einwohner von Kau den Beteiligungsprozess einer gemeinschaftlichen Teilortsentwicklung an. In einem ersten Schritt des Prozesses werden alle Einwohner von Kau (ab dem Alter von zwölf Jahren) zu ihren Zielen für die gemeinsame Ortsentwicklung und der Einschätzung der aktuellen Situation per Fragebogen (online oder offline) befragt. In der Befragung wird zudem auch ermittelt, welche Einwohner bereit sind, sich bei der Umsetzung der gefassten Schritte einzubringen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Auswertung der Bürgerumfrage anfallen.
Die Initiative errichtet mit ihrem Projekt eine Bürgerbegegnungsstätte mit folgenden Zielen: gesellschaftliche Teilhabe, Barrierefreiheit, Netzwerkarbeit, inklusiv organisiertes Café. Zwei Besonderheiten kommen auch hinzu – eine personenbediente Fahrkartenverkaufsstelle für den Nahverkehr Ostalbkreis sowie das Bürgerbüro für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum. Mit dem Projekt wird ein Dialog innerhalb der Bürgerschaft der Stadt Ellwangen und der Politik herbeigeführt. Die Beratung erhält das Projekt zur Planung und Organisation von Workshops zur Konzeptentwicklung.
Die Initiative Fuss-Rad-Entscheid Esslingen setzt sich aus Aktiven der Gruppen VCD, ADFC, Esslingen aufs Rad, FUSS e.V., Schwäbischer Albverein, Stadtseniorenrat und anderen zusammen.
Sie setzen sich für ein lebenswertes Esslingen mit sicheren und attraktiven Straßen und Wegen sowie Plätzen mit hoher Aufenthaltsqualität ein. Sie fordern, dass die Stadt Esslingen deutlich mehr als bisher in den Ausbau von Fuß- und Radinfrastruktur investiert.
Die Initiative setzt sich für die Verbesserung der Fuß- und Radwege sowie der Sicherheit der Radfahrenden und Fußgänger ein. Sie möchte alle ansprechen, unabhängig von Herkunft oder Bildungsstand, doch durch die Komplexität der Verkehrsthematik entstehen bisher noch sprachliche Hürden. Die Texte sind aufgrund der Behördentauglichkeit im Fachjargon verfasst. Ziel ist es, die Texte in einfache Sprache umzuschreiben und zu veröffentlichen, damit niemand sprachlich ausgeschlossen wird.
Eine Gruppe an Gärtner*innen gründet gemeinsam einen Gemeinschaftsgarten als generations- und kulturübergreifenden Begegnungsort. Unterstützt wird die Gruppe vom Nachbarschaftsbüro Westliches Bergheim, das vom VbI e.V. und Kulturfenster e.V. getragen ist. Bei der Entwicklung greift die Gruppe auf Erfahrungen aus kleinen Gartenprojekten in Hinterhöfen zurück. Hier wurde bereits gegärtnert und die Erfahrung gemacht, dass das Gärtnern Menschen unterschiedlicher Sprachen, Alters und Lebenssituation zusammenbringt. Der Gemeinschaftsgarten wird zum Begegnungsort, da hier Nachbarschaftsgespräche entstehen. Um die Gemeinschaftsgarten zu starten, findet eine Bürgerbeteiligung zur Planung des Gartens und zum Aufbau der Gruppe statt.
Ein ehemaliges Restaurant in der äußeren Weststadt dient der Initiative dazu einen neuen Stadtteiltreff im Quartier zu gründen, der sich in einer belebten Einkaufsstraße für alle Bewohner*innen gut zugänglich befindet. Durch eine Bürgerbeteiligung vor Ort entsteht im Stadtteiltreff ein Ort der Vernetzung, der Integration und Inklusion, für alle Menschen. Die Beratung erfolgt in Form einer professionellen Moderation und Prozesssteuerung.
Das Bürgerforum Kressbronn möchte eine Bürgerbeteiligungssatzung entwickeln. Diese institutionalisierte Satzung mit festgeschriebener Organisationsstruktur soll zu einer nachhaltigen Bürgerbeteiligung in Kressbronn beitragen. Um den Prozess weiter gestalten zu können, benötigt das Bürgerforum Beratung durch projekterfahrene Personen zur Erstellung dieser Satzung.
Zur Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Mobilität möchte der Förderverein „Idee Innovatives Dorfleben einladend & effektiv“ aus Klettgau einen Bürgerbus in die Gemeinde einbringen. Mit dem Bürgerbus können Gemeindemitglieder kurze Strecken innerhalb der Gemeinde zum Einkaufen, zum Arzt, zur Bank, zum Sportverein, etc. zurücklegen. Nach Möglichkeit sollen regelmäßige Einkaufstouren zu den Läden in der Gemeinde, Markt-Touren sowie eine festgelegte Route mit kurzem Haltestellen-Netz realisiert werden. Beratung erhält der Förderverein zu Umfragetechniken/ Auswertung und zu einem möglichen Projektmanagement.
Einrichtung eines ehrenamtlichen BürgerBuses in der Kernstadt von Eppingen als sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV. Eine Ausweitung auf die Vororte ist angedacht. Träger des Buses soll die Stadt Eppingen werden, der Fahrbetrieb wird vom noch zu gründenden BürgerBus Verein organisiert. Qualifizierte Prozessberatung zu Fragen der zielorientierten Bedarfsermittlung, Organisation, Sicherheit und Haftung ist dabei notwendig.
Der Bedarf nach einer besseren Mobilität für ältere Mitmenschen hat sich im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“ herauskristallisiert. Der bestehende ÖPNV wird mit den bedarfsgerechten Angeboten zur Steigerung der Lebensqualität von Senioren im ländlichen Raum ergänzt. Bürger fahren ehrenamtlich für Bürger: zum Arzt oder zum Einkaufen. Beratung zur Ausarbeitung einer Konzeption und zu Projektumsetzung.
Die Initiativgruppe möchte die abgelegenen Tettnanger Stadtteile mit Hilfe eines Bürgerbusmodells besser an die Kernstadt anbieten. Zu diesem Unterfangen haben sich bereits Freiwillige gemeldet. Gerade ältere Menschen bietet der Bürgerbus die Möglichkeit wieder häufiger am sozialen Leben in den anderen Teilorten und der Kernstadt teilzunehmen. Beratung erhält die Initiativgruppe zur Bedarfsermittlung, zum Einsatzkonzept und zur Erstellung einer Vereinssatzung.
Die Bürgergemeinschaft Grünkraut e.V. organisiert auf ehrenamtlicher Basis Hilfen und Unterstützungsangebote insbesondere für Senioren in Grünkraut. Der Verein hat das Ziel, nachbarschaftliches Miteinander ehrenamtlich zu fördern und auszubauen.
Im Rahmen eines Bürgerentscheids zur Standortsuche eines Seniorenzentrums möchte die Bürgergemeinschaft Grünkraut e.V. die Informationen mit eigenen Maßnahmen in Form eines Bürgerdialogs ergänzen. Ziel dabei ist, die Bürger über die Auffassung der Bürgergemeinschaft zum möglichen Standort des Seniorenzentrums zu informieren und ältere Menschen zu befähigen, mit Hilfe des Internets besser informiert zu werden und an der Livestreaming Veranstaltung teilnehmen zu können. Dazu sind folgende Maßnahmen geplant: Entwicklung und Druck eines Informationsflyers zu den Argumenten der Bürgergemeinschaft und zur technischen Anleitung am Bürgerdialog im Livestream sowie die Gewinnung von jungen Menschen, die ältere Menschen bei der Teilnahme an der Online-Veranstaltung unterstützen.
Das Projekt Bürgerfahrdienst Aspach ist aus der Veranstaltung "Miteinander in Großaspach/Aspach" als ein wichtiger Wunsch der Bürger hervorgegangen. Der Fokus liegt dabei auf der Teilhabe älterer Menschen und Menschen mit Behinderung sowie den Erhaltung der Mobilität. Der Bürgerfahrdienst bietet eine kostenlose Beförderung z.B. zu Arztterminen oder Besuchen. An dem Projekt beteiligen sich das DRK und die Gemeinde Aspach und übernehmen die Kosten für das Fahrzeug.
Das Bürgerforum Braunsbach beteiligt sich nach der Flutzerstörung im Mai 2016 aktiv am Wiederaufbau der Gemeinde, um deren Lebensqualität zu sichern. Das Bürgerforum dient dazu, allen Bürger der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen für ein neues Braunsbach mit einzubringen. Beratung erhält das Bürgerforum zu Fragen der Prozessgestaltung sowie zu Fragen der Öffentlichkeitsbeteiligung.
Das Ziel der Bürgerinitiative ist die Gründung eines Bürgerforums zur Stärkung der informellen Bürgerbeteiligung rund um den Bau eines Wohnmobilstellplatzes und einer großen Hotelanlage. Die Gemeinde Beuren begrüßt in seinem Thermalbad ca. 600.000 Gäste pro Jahr. Die Bürgerschaft und die Gemeindeverwaltung sollen rechtzeitig im konstruktiven Dialog Ideen und nachhaltige Projekte für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde finden und umsetzen. Die Initiative erhält Unterstützung bei der Planung des Beteiligungsprozesses.
Zeigt, vernetzt und pflegt den Dialog engagierter Bürgerinnen und Bürger Kressbronns
Wir sind als Wählergemeinschaft mit drei Stadträten im Gemeinderat der Stadt Bad Herrenalb vertreten. Wir sind dem Netzwerk Allianz für Beteiligung beigetreten, nachdem wir 2013 einen Bürgerentscheid für/gegen ein geplantes Großprojekt durch ein Bürgerbegehren erreicht hatten. Das Projekt wird nicht realisiert. Wir meinen: Um bei Stadtentwicklung und Gestaltung bürgerverträgliche Ziele zu erreichen, darf es nicht bei einer ja/nein oder schwarz/weiß Darstellung bleiben. Bürger wollen vorab informiert werden, um einen Entwicklungsprozess aktiv begleiten zu können.
Die Initiative „Kleeblatt“ setzt sich aus vier Seniorenorganisationen zusammen, die einen Zusammenschluss zu einer Bürgergemeinschaft planen, um die Gemeinde Küssaberg bei Projekten selbstbestimmter ambulant betreuter Wohngemeinschaft ehrenamtlich zu unterstützen. Beratung erhält die Initiative „Kleeblatt“ Küssaberg zum Zusammenschluss der Seniorenorganisationen, der Gründung einer Bürgergemeinschaft und zu rechtlichen Aspekten der Satzungsschreibung.
Die Gemeinde Aitrach befindet sich auf dem Weg hin zu einer Solidarischen Gemeinde, in der Jung und Alt sich umeinander kümmern und man gut und gerne alt werden kann. In diesem Entwicklungsprozess sollen Einwohnende in Beteiligungsformaten ihre Themen und Bedarfe für den Prozess einbringen und auch selbst umsetzen können. Eine Begleitgruppe, die der lokale Caritasverband begleitet, kümmert sich um diesen Prozess. Die Nachbarschaftsgespräche werden als Bürgergespräche an vier Terminen in der Gemeinde Aitrach angeboten. Das erste Bürgergespräch findet im Kernort Aitrach statt und ist als Auftakt und niedrigschwelliges Kennenlernen des Prozesses konzipiert. Darauf folgt ein weiteres Bürgergespräch im Kernort. Um die beiden weiteren Teilorte Aitrachs, Mooshausen und Treherz, gut einzubinden, ist in jedem Teilort ein weiteres Bürgergespräch geplant. Aufbauen lässt sich vor Ort an einem vorgeschalteten Prozess mit verschiedenen beteiligungsorientierten Elementen wie einer Umfrage, deren Ergebnisse in den Bürgergesprächen diskutiert und weiterverfolgt werden sollen.
Die Bürgergruppe WG Steingasse begleitet den Aufbau einer Pflege-Wohngemeinschaft für zehn Menschen mit Demenz in Schallstadt. Die Gruppe hat sich nach einem kommunalen Beteiligungsprozess zur Weiterentwicklung der Infrastruktur für die Bevölkerungsgruppe 55+ gebildet. Mit Baustellentreffen, Informationsveranstaltungen und Einzelgesprächen macht die Gruppe weitere Interessierte auf das Projekt vor Ort aufmerksam. Gemeinschaftlich gestaltet sie den demografischen Wandel vor Ort aktiv mit und etabliert neue, vielfältige Wohnformen. Mit dem Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die durch die öffentlichen Veranstaltungen der Gruppe anfallen.
Das Ziel des Projektes ist die Umnutzung eines historischen, denkmalgeschützten Gebäudes am Lindenplatz zu einer Gemeindebedarfseinrichtung (Bürgerhaus). Eine Mediathek, ein integrierter Hofladen, ein Café und ein Bürgersaal werden hier untergebracht, damit das Gebäude das künftige Zentrum der sozialen Infrastruktur des Ortskerns Oberlauchringen wird. Die Gemeinde ist der Eigentümer des Hauses, die Bürgerschaft ist in die Planung miteinbezogen, um das Bürgerhaus und den Lindenplatz mit dem Leben zu füllen und einen Ort der Begegnung für alle Generationen zu schaffen. Der Beratungsgutschein wird zur Entwicklung eines multifunktionales Versorgungs- und Kommunikationszentrums am Lindenplatz genutzt.
Die Bürgerinitiative "Heddebör unser Ort" will Hettigenbeuern zukunftsfähig machen und gemeinsam Projekte für den Erholungsort entwickeln. Der Ort soll für Jung und Alt an Attraktivität gewinnen, damit vor allem junge Menschen hier Perspektiven sehen und nicht wegziehen. Es braucht Einrichtungen und Gemeinschaft vor Ort, damit die Menschen sich hier wohlfühlen. Neue Impulse für die Dorfgemeinschaft werden gemeinsam durch Informationsveranstaltungen und Workshops kanalisiert und realistische Projektziele festgelegt. Die Beratung zu Organisation und Durchführung einer Bürgerwerkstatt, zur Konzeptentwicklung für die Projektumsetzung anhand von Ergebnissen des Bürgerbeteiligungsprozesses wird durch "Gut Beraten!" finanziert.
Die Steuerungsgruppe Unlingen möchte in ihrem Ort einen Bürgerverein oder eine Bürgergenossenschaft gründen. Die Rechtsform wird benötigt, um eine Pflegewohngruppe in Unlingen einrichten zu können und auch den Bau von barrierefreien Wohnungen bewerkstelligen zu können. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Personen und ältere Menschen in ihrer Gemeinde versorgt werden können. Die Steuerungsgruppe Unlingen erhält für ihr Projekt „Bürgerinitiative altersgerechte Wohnformen“ Beratung zu den Themen: Klärung der Rechtsform, Entwicklung einer Satzung sowie Unterstützung der Gründungsveranstaltung.
Wir wollen Information, Diskussion und Mitsprache von Bürgerinnen und Bürgern auf dem Bodanrück ermöglichen und durch Anstöße von Themenprozessen in unserem Bürgerportal dazu beitragen, die Debatte zu Fragen des gesellschaftlichen Lebens in unserer Region auch in die Öffentlichkeit (Politik, Presse, Organisationen/Gremien/Ausschüsse...) zu tragen.
Die Bürgerinitiative NEIN zur Stadtbahn setzt sich dafür ein, den Verkehr in Tübingen ökologischer zu gestalten. Sie befürwortet Elektrobusse und Tangentialbuslinien, anstelle einer Stadtbahnstrecke, die ihrer Auffassung nach teuer und unökologisch ist. Die Bürgerinitiative plant einen Bürgerentscheid, der zeitgleich mit der Bundestagswahl 2021 durchgeführt wird.
Die Ziele der Initiative sind Verbesserung des ÖPNV durch mehr Elektrobusse, Tangentiallinien und flexiblere Angebote, Erhalt der historischen Neckarbrücke sowie Vermeidung von 5-jähriger Bauzeit in der Innenstadt.
Bisher wurden 1.000 Unterschriften gesammelt, weitere Bürger*innen sollen auf die Initiative aufmerksam gemacht werden.
Nach schlechten Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens haben wir das Thema Bürgerbeteiligung im Rahmen von Naturschutz und Landschaftspflege, Förderung von Kunst und Kultur sowie der Förderung von bürgerschaftlichem Engagement zur zentralen Aufgabe gemacht. Dazu gehört vor allem die Vermeidung von umweltschädlicher Industrie in ländlich geprägtem Umfeld.
Die Initiative für Nahversorgung in Mehrstetten möchte die Gemeinde bei der Entwicklung eines Konzepts zur zukunftsfähigen Nahversorgung unterstützen. Geplant ist der Aufbau eines DORV-Zentrums (DORV = Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung) in Mehrstetten. Das Zentrum soll die Nahversorgung sichern und zu einem Ort der Begegnung und Vernetzung werden. Beratung erhält die Initiative zu Fragen der Projektumsetzung.
Die Gaststätte wird wieder für die Bürger*innen geöffnet und hierzu steht eine dafür vorgesehene genossenschaftliche Organisationsform, an der sich möglichst viele Bürger*innen beteiligen. Nach ersten Gesprächen mit dem Genossenschaftsverband BW ist in einem solchen Projekt zunächst die Beratung durch qualifizierte Fachkräfte erforderlich, um die Erfolgsaussichten des Projekts abschätzen zu können. Sofern das im Zuge dieser Beratung erstellte Gutachten erfolgversprechend ist, wird die Projektgruppe die nächsten Schritte einleiten. Zunächst entsteht eine Konzept- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Vorhabens.
Arbeitskreis WN ENGAGIERT, Frauenrat, Integrationsrat, Jugendgemeinderat, Stadtseniorenrat
Dem Bürgernetzwerk „Engagiert zusammen in Dielheim“ stehen durch die Gemeinde gestellte und sanierte Räume für ein Bürgertreff zur Verfügung. Durch das Projekt entsteht ein fester und dauerhafter Treffpunkt für Menschen jeglichen Alters, Religion, Hautfarbe, für die Unterhaltung in neutraler Atmosphäre, gemeinsame Projektplanung und Durchführung, besonders als Anlaufpunkt für engagierte Gruppen vor Ort. Eine professionelle Nutzungsplanung und Unterstützung zur nachhaltigen Verankerung in der Bevölkerung ist dabei notwendig, wofür die Beratung erfolgt.
Der Verein Füreinander Miteinander bringt in Weil der Stadt Menschen zusammen, die sich bürgerschaftlich engagieren möchten. Seit 1995 nimmt der eingetragene Verein damit eine wichtige Mittlerrolle vor Ort ein. Zusammen mit der Stadtverwaltung eröffnet der Verein den „BürgerTreff“, in dem sich Bürgergruppen und Vereine aus der Stadt am Schwarzwaldrand treffen können. Der Treffpunkt trägt zu einer Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt von Weil der Stadt bei. Auf Informationsveranstaltungen des Vereins werden interessierte Bürger auf das neue Angebot hingewiesen und animiert, den Treff und dessen Angebot mitzugestalten. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten des Vereins finanziert, die zum Beispiel für die Informationsveranstaltung anfallen.
Das Quartier Innenstadt/Marktplatz erhält einen Bürgertreff als sozialen Treffpunkt für Jedermann. Eine große Rolle spielen hierbei die Bedürfnisse von Senior*innen und Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Hier werden gemeinsame Aktionen für Jung und Alt durchgeführt, um die Gemeinschaft zu stärken und das Älterwerden im Quartier mit Teilhabe, Begegnung und Daseinsvorsorge zu unterstützen. Die Beratung erfolgt zur ganzheitlichen Konzeptentwicklung.
Die GenerationenGemeinschaft Glottertal e.V. hat sich das Ziel der pflegerischen Nahversorgung im Alter und die Förderung von solidarischem, generationenübergreifendem Engagement gesetzt. Im Projekt soll über den freiwerdenden Raum, der durch den Umzug des Pflegezentrums vor Ort entsteht, beratschlagt werden. In einem Beratungsprozess soll abgefragt werden, was sich die Einwohner von diesem Raum wünschen. Gleichzeitig gilt es die Aufgabenstellung und Anforderungen an das Bürgerbüro zu überarbeiten. Beratung erhält der Verein zur Planung, zur Durchführung und zur Dokumentation des Partizipationsprozesses.
Seit Anfang 2018 trifft sich eine Gruppe engagierter Bürger Hausens, mit dem Ziel mehr Begegnung im Ort zu erreichen. In Begleitung von SPES e.V. Freiburg wurde ein Konzept erarbeitet, welches einen kleinen Dorfladen mit Begegnungsstätte beinhaltet. Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag. Die erste Bewilligung erfolgte im Juni 2018 für die Förderung der Konzepterstellung. Der neue Beratungsgutschein unterstützt die rechtliche Begleitung zur Vereinsgründung.
Der Verein „Gemeinsam Nachbarschaftshilfe Langenau“ stärkt vor Ort Personen mit Unterstützungsbedarf. Der Verein ist noch jung und reagiert auf gesellschaftliche Entwicklungen mit dieser Form der bürgerschaftlichen Nachbarschaftshilfe. Helfer werden mit einem Grundkurs in "Häuslicher Betreuung in der Altenpflege" auf ihre Aufgaben in der Nachbarschaftshilfe vorbereitet. Die Gruppe möchte das Angebot in der Langenauer Kernstadt sowie den Ortsteilen Göttingen und Albeck bekannter machen und hat dazu Bürgerinformationsveranstaltungen geplant. Ziel ist es, sowohl das Angebot bekannt zu machen als auch neue Mitstreiter für die Nachbarschaftshilfe zu gewinnen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit den Bürgerinformationsveranstaltungen für den Verein anfallen.
Der Bürgerwald soll sich als "Mitmach-Wald" unter Berücksichtigung gesellschaftlicher und ökologischer Aspekte entwickeln. Kinder und Erwachsene gilt es für das Arbeiten im Wald zu begeistern, indem sie u.a. an Waldpflegetagen gemeinsam anpacken, Bäume pflanzen, Tümpel anlegen, Tiere beobachten und dabei für Klima- und Naturschutz sensibilisiert werden. Die Bürgerschaft aus Kißlegg sowie Vereine und Interessensverbände aus der Ortschaft und Gemeinde wurden und werden weiterhin eingebunden.
Die Initiative beschäftigt sich mit künstlerischen Techniken wie Malerei, Grafik oder Musizieren. Sie möchten ihre Erfahrungen weitergeben und einen Raum für Kreativität aufbauen, als generationsübergreifenden Treffpunkt für alle Menschen, die sich kreativ betätigen möchten. Alle Interessierte jeglichen Alters sind eingeladen in offener Atmosphäre sich selbst kreativ auszuprobieren. Die Ergebnisse werden bei Ausstellungen und Aktionen der Öffentlichkeit vorgestellt.
Dazu wird eine Räumlichkeit renoviert und eingerichtet sowie Nutzungs- und Öffnungszeiten und Workshops mit fachkundiger Anleitung angeboten.
Der Arbeitskreis Bürgerwindpark der Renninger Agenda umfasst neben der Mitgestaltung der Energiewende vor Ort insbesondere die Gründung einer Bürger Energiegesellschaft/-genossenschaft gem. EEG 2023, um Windkraftanlagen in und um Renningen zu bauen und zu betreiben. Die Beratung erhält der Arbeitskreis bei der Wahl der geeigneten Organisationsform, bei der Einbindung der Zivilgesellschaft, bei einem realistischen Zeitplan und Stolpersteinen, sowie bei der Verträglichkeit mit Naturschutzbelangen.
Die Kunst der Vielfalt
Die Initiative SprechZimmer ist als Projekt in der Corona-Pandemie entstanden. Die Initiatoren öffneten ihr leerstehendes Ladenlokal als Kulturschaufenster für Künstlern aus der Region. Diese Aktion war so erfolgreich, dass sie vom städtischen Kulturamt übernommen und auf zentraler Bühne fortgeführt wurde. In der Zwischenzeit war das SprechZimmer Galerie, Pop-Up-Weihnachtsmarkt und Corona-Schnellteststation. Die Initiative wird von einer Gruppe von Bürgern getragen und ist offen für alle.
Das Café-Neustart im SprechZimmer ist das aktuelle "Post-Corona-Projekt". Es bietet Initiativen und engagierten Bürgern die Möglichkeit, sich im Café-Format, in der nun anstehenden Post-Corona Zeit neu zu orientieren und Perspektiven für ihr Engagement auf- und wieder neu auszurichten.
Mit Workshops, Seminaren, Gruppentreffen, kulturellen Begegnungen erhalten Ehrenamtliche Unterstützung, um wieder in die Engagement-Normalität zurückzufinden.
Das Café ist nicht auf Umsatz ausgerichtet.
Die Initiative Cafe Q ist eine Gruppe von Marbacher Bürgern, die sich für Zusammenhalt, Gemeinschaft, Vernetzung und Integration der Bewohnern im Stadtteil Hörnle einsetzen.
Mit der Eröffnung eines wöchentlichen Cafés können sich die Bewohner in angenehmer Atmosphäre austauschen und vernetzen. Das Café hat zum Ziel, Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten vor allem auch für ältere Menschen anzubieten, um gerade in der Corona-Zeit Vereinsamung entgegenzuwirken. Es gibt zugezogenen Menschen die Chance sich zu vernetzen und sozial benachteiligten Bürgern die Möglichkeit im Gespräch Hilfestellungen zu bekommen. Zusätzlich sind Angebote für Kinder, z.B. Vorlesestunde, Basteln und Hausaufgabenhilfe geplant. Das Café findet in den Räumen des Gemeindehauses der evangelischen Kirche statt.
Die Initiative AK Nahversorgung bringt wieder das Leben in das Dorf und vor allem versorgt sie mit ihrem Projekt die ältere Bevölkerung mit lokalen Lebensmitteln, nachdem der örtliche Bäcker, der Metzger und der kleine Laden geschlossen haben. Ein angeschlossenes Café regt das Miteinander vor Ort als eine Begegnungsstätte an und fördert außerdem den Tourismus im Winzerdorf. Die Beratung erhält die Initative zu der Projektumsetzbarkeit, der Konzeptentwicklung und für die Formen der Bürgerbeteiligung.
Zentrales Anliegen des Projektes ist die nachhaltige Mobilität und der Klimaschutz. Der ökologische Fußabdruck der gesamten Gemeinde wird dadurch verbessert und ein wesentlicher Beitrag zur Einsparung von Ressourcen und CO2-Vermeidung geleistet. Durch Vorträge und einen „Mobilitätstag“ werden alternative Formen der Mobilität für die Bürgerschaft der Gemeinde erlebbar gemacht und dadurch die Akzeptanz für dieses Thema erhöht. Einrichtung eines geeigneten Stadtortes von Bussen auf Sharingbasis für Vereine folgt. Die Beratung erfolgt zur Etablierung der Projektidee.
Förderung der multimodalen Mobilität in Ortenberg. Die Bürgerschaft wird für nachhaltige Mobilität wie (e)CarSharing, Hol- und Bring Dienste und Klimaschutz in Form von Infoveranstaltungen, Bürgerbefragungen und Diskussionen unter der fachlichen Begleitung sensibilisiert. Der Beratungsgutschein wird für die Organisation und das Ausrichten von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung benötigt.
Die Projektgruppe hat sich im Rahmen des Innovationsprogramms D-Care Lab BW zusammengefunden und entwickelt innovative Lösungsansätze für konkrete Herausforderungen im Bereich der ambulanten Pflege. Der Innovationsprozess wird angeleitet vom Social Innovation Lab als Teil des Grünhof e.V. in Freiburg. Ziel der Projektgruppe ist es, Ressourcen eines Sozialraums im Bereich der ambulanten Pflege, Betreuung und Unterstützung zu erfassen, bündeln und für den Sozialraum nutzbar zu machen. Der Hintergrund ist, dass der demografische Wandel in den nächsten Jahrzehnten die Versorgungslandstrukturen an die Kapazitätsgrenze bringen wird, sodass neue Strukturen aufgebaut werden müssen, um die Bedarfe von Menschen mit Pflege, Betreungs- und Unterstützungsbedarf zu decken. Vor diesem Hintergrund erscheint der Projektgruppe, der Sozialraum als wichtiger Ansatzpunkt und entwickelt dazu ein Konzept der Sozialraumbeteiligung.
Die Fördernehmer betreiben einen Kulturraum, der von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung bespielt wird. In diesem Rahmen können sich alle Interessierten gleichberechtigt beteiligen und ihre Ideen einbringen. Gemeinsam gestalten sie auch Veranstaltungen. Beratung wünschen sich die Antragsteller bei der Unterstützung im Umgang mit Geflüchteten und der Vernetzung mit Stakeholdern.
Das Team COLA TAXI OKAY, bestehend aus jungen Studierenden und Personen mit Fluchterfahrung aus Karlsruhe, möchte einen Raum schaffen, der durch flexible Programminhalte gefüllt wird. Die Inhalte bereitet das Team gemeinsam mit interessierten Personen und Menschen mit Fluchterfahrung vor.
Wichtige Bausteine sind:
- Empowerment/ Integration
- Wissensförderung/ Aufklärung
- Motivation
Der Helferkreis Asyl Horgenzell gründete mit zahlreichen Partnern das „Conclusio = Zusammenschluss“. Es handelt sich um das Zeitbankmodell für die gegenseitige Unterstützung von Einheimischen und Geflüchteten am Wohnort, dem Arbeitsplatz und in der Schule. Beratung bekommt der Helferkreis für die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Maßnahme.
Der Verein SPES Zukunftsmodelle e.V. möchte die Entwicklung und Umsetzung eines Zeitbankmodells Conclusio realisieren, das ehrenamtliche Arbeit von Asylbewerber_innen erlaubt und befördert. Das Modell soll zunächst in zwei Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis eingeführt und getestet werden.
Der Gemeinschaftsgarten Blühende Weberei e.V. lädt Bewohner*innen, Kinder und Jugendlichen des Stadtteils zum gemeinsamen Gärtner ein. Das Projekt trägt zum ökologischen Leben im Stadtteil Alte Weberei bei und vermittelt einer breiten Öffentlichkeit in verschiedenen Projekten ökologische Kreisläufe. Insektenfreundliche und heimische Pflanzen werden hier kultiviert und mit altem Saatgut gearbeitet.
Um die angebauten Pflanzen zu verarbeiten und genießen wird eine Küche aufgebaut, in der regelmäßige Angebote stattfinden, z.B. naturpädogogische Gruppen für Kinder und Erwachsene. Hier wird ein Container ausgebaut und mit einer Küche ausgestattet.
GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e.V.
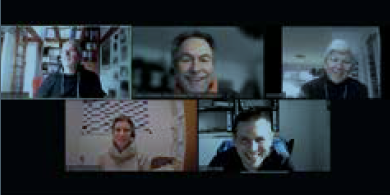
Mitten in der Corona-Pandemie ist in den beiden Nachbarstädten Ulm und Neu-Ulm ein einzigartiges Beteiligungsprojekt im Rahmen der „Nachbarschaftsgespräche“ entstanden. Nach den ersten Erfahrungen in und mit der pandemischen Lage hat der gemeinsame GenerationenTreff (GT) der beiden schwäbischen Städte ein Corona-Forum initiiert, das sich speziell mit den stark von der Pandemie betroffenen Seniorinnen und Senioren beschäftigt. Senioren-Organisationen hatten – wie auch viele weitere zivilgesellschaftliche Akteure – ganz besonders unter den Einschränkungen in der Pandemie zu leiden.
Für Schach-Enthusiasten entschied zeitweise die Zugehörigkeit zum Bundesland, ob noch gemeinsam gespielt werden konnte
Mitgliederschwund, temporäres Brachliegen aller Aktivitäten und der Verlust der Bindung zu den verbliebenen Mitgliedern sind nur eine Auswahl einer breiten Problem-Palette, mit der sich Engagierte plötzlich konfrontiert sahen. In und um Ulm herum kam die reizvolle wie aber auch anspruchsvolle Lage der Städte in zwei verschiedenen Bundesländern hinzu. Waren schon die stetig wechselnden Regelungen in einem Bundesland nicht immer einfach zu greifen, mussten die Ulmer Engagierten Regelungen aus den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg jeweils auf den Ausrichtungsort der Aktivität ausrichten, bei häufig nicht gleich lautendem Regelwerk. Was zum Beispiel für Schachspielfreunde auf der einen Seite der Stadtgrenze eine Spielmöglichkeit in gemeinsamer Runde bedeutete, konnte sich beim Gang über die Stadtgrenzen diese Möglichkeit wieder erübrigen.
Um diese und weitere Erfahrungen von Senior*innen aufzunehmen und Verbesserungspotenzial für mögliche kommende Krisen herauszufinden, bildete sich das Ulmer Corona-Forum. Unter externer Moderation kamen die bunt gemischten Teilnehmenden, die verschiedene Organisationen der Seniorenarbeit und themennahe Verwaltungsabteilungen beider Städte vertraten, mehrmals in einem Zeitraum von rund einem dreiviertel Jahr zusammen. Zeitweise auch im digitalen Raum. Dabei lag der Fokus des Formats nicht so sehr auf den speziellen Bedürfnissen einer Einrichtung, sondern vielmehr auf dem Dialog und dem Austausch der insgesamt 30 Teilnehmenden untereinander.
Engere Zusammenarbeit in der Doppelstadt soll Krisen-Resilienz vor Ort stärken
Schlussendlich ist ein beeindruckendes Abschlussdokument entstanden, das praktische Hinweise für die Bewältigung künftiger Krisen beinhaltet. Insgesamt 24 Lösungsvorschläge konnten den Vertreterinnen der beiden Kommunen übergeben werden. Grundtenor: Es sei auch zukünftig mit ähnlichen weiteren Krisen und Notfällen zu rechnen, wie aktuell der Ukraine-Krieg und seine Folgen zeige. Dafür müsse vor Ort noch mehr Resilienz entstehen durch eine noch engere Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Vertreterinnen der Ulmer Kommunalverwaltungen. Dass beide Seiten häufig unterschiedlichen Handlungslogiken folgen, muss keine Schwäche sein. Vielmehr könnten sich beide Seiten mit ihren Stärken unterstützen.
Gerade zivilgesellschaftliche Organisationen hätten in der Krise durch äußerst rasches Handeln die negativen Auswirkungen der Pandemie stark abgefedert. So folgern auch die Verwaltungsvertreter der beiden Ulmer Städte: „Es ist und bleibt eine Notwendigkeit und eine Herausforderung gleichermaßen, vorhandenes Potenzial der Zivilgesellschaft zu erkennen, dies in städtischen Planungen zu berücksichtigen und einzubeziehen. Dafür sind ein ständiger Dialog und eine kontinuierliche Zusammenarbeit zentral.“
Das Corona-Forum war ein eindrücklicher Beweis, wie diese Worte bereits in praktisches Handeln überführt werden konnten.
FC Esslingen e.V.




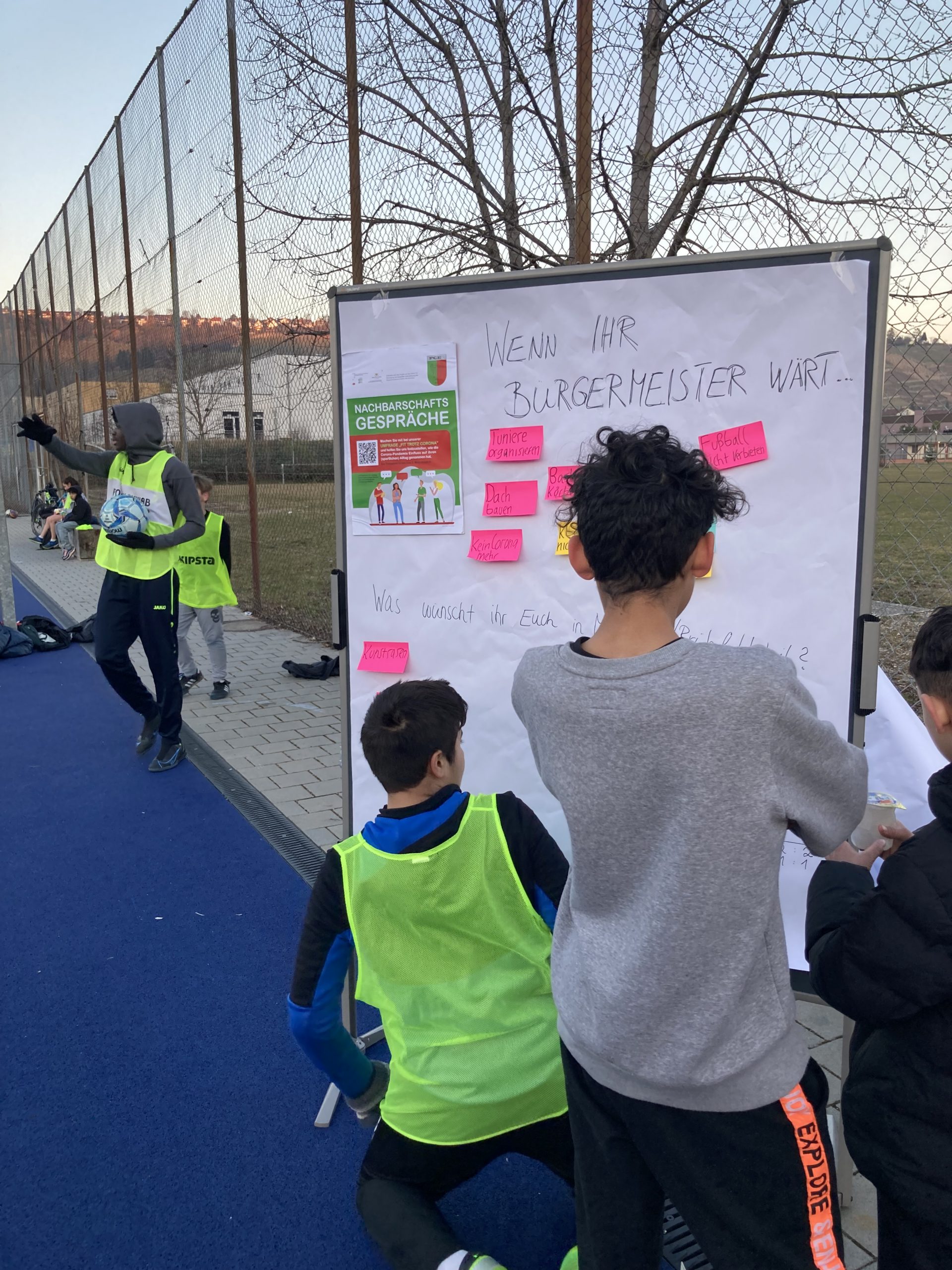



Der FC Esslingen ist mit seiner Sport- und Wirkstätte im Herzen des Esslinger Westens verankert. Nachdem in der Pandemie viele Aktivitäten vorübergehend eingestellt werden mussten, ging es in Nachbarschaftsgesprächen darum, den Neustart nach der Pandemie zu gestalten: Welche Bedarfe im Stadtteil sind vernachlässigt worden? Wo sind neue Fragestellungen entstanden, die es nun zu adressieren gilt? Und wie kann der FC Esslingen Maßnahmen umsetzen, die entsprechend in den Stadtteil hineinwirken und wie kann er die lokalen Netzwerke stärken?
Die Kolpingsfamilie ist ein soziales Netzwerk sowie eine Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Ehrenamtliche und zivilgesellschaftlich Engagierte von Kolpingsfamilie sind für mehr als 30 verschiedene Aktivitäten im Einsatz. Es sind die Besuchsdienstgruppe für Geburtstage und Weihnachten, der "Soziale Mittagstisch" gegen Armut und Einsamkeit mit selber gekochtem Essen, Treff der Frau. Eine Veranstaltung unter dem Motto "Corona... und jetzt!" wird als Reaktivierung, Stärkung, Anerkennung und Wiederbelebung der Motivation für einen guten Neustart der verschiedenen sozialen Aktivitäten dienen. In der langen Durststrecke des Lockdowns herrschte unter vielen Senioren verängstigte und hoffnungslose Stimmung. Die soziale Nähe und die Kontakte werden an einem aufmunternden Abend wiederherstellt. Den unterhaltsamen Input bietet eine Kabarettistin mit dem aktuellen Programm "Coronazeit + Engagement" für ein neues Gemeinschaftsgefühl.
In Stadtteilen Viehweide und Eichholz bemühen sich zwei Arbeitskreise um die Quartiersarbeit. Ein kontinuierlicher Dialog über Bedürfnisse und Interessen der Bewohnergruppen soll zu mehr gemeinsamen Aktivitäten führen und die Nachbarschaft verbessern. Beide Gremien hatten in letzter Zeit hohen Mitgliederschwund sowie Generationenwechsel. Externe Beratung wird geeignete Methoden zur Aktivierung bestimmter Gruppen im Bezirk aufzeigen. Außerdem sollen Maßnahmen und Projekte zur nachhaltigen Förderung des Engagements entwickelt werden.
Das Eltern-Kind-Zentrum ist aus einer kleinen Initiative entstanden und hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Stadtteilkultur im Stuttgarter Westen entwickelt. Das Team besteht aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Hintergründen.
Dabei Sein - nicht abgehängt werden durch die Corona-Pandemie - ist das Ziel des neuen Projekts des Eltern-Kind-Zentrums, das sich speziell an benachteiligte Familien im Stuttgarter Westen richtet. Dort wohnen viele Familien in sehr beengten Verhältnissen und werden im Lockdown auf sich zurückgeworfen. Kinder sind oft die Leidtragenden, die sich nicht gesehen fühlen und keine Chancen für Teilhabe bekommen. Im ersten Lockdown hat sich gezeigt, dass diese Familien keine finanziellen Mittel haben, um den Kindern die technischen Voraussetzungen für Homeschooling zu ermöglichen. Das Projekt reagiert auf diesen Bedarf und gibt den Kindern die Möglichkeit über das Eltern-Kind-Zentrum an digitaler Hausaufgabenbetreuung, Bastel- und Spielnachmittagen teilzunehmen und die Familien auf diese Weise aktiv zu unterstützen.
Der Dachverband der Jugendgemeinderäte e.V. ist ein Zusammenschluss der Jugendgemeinderäte aus Baden-Württemberg.
DEEP ist ein digitales Projekt, bei dem jugendliche an Kunstaktionen teilnehmen. Die primäre Fragestellung ist, wie kollaborativ und digital Kunst von benachteiligten Jugendlichen geschaffen werden kann. Dabei wird die Grenzenlosigkeit des virtuellen Raums als Chance zu innovativen Wegen der Beteiligung genutzt sowie die gestalterischen Auseinandersetzungen mit demokratischen Werten zusammengedacht. Die Ergebnisse werden in einem Web-Archiv veröffentlicht. Gleichzeitig werden sie im analogen Raum mittels einer Plakatausstellung sichtbar gemacht. Beratung zur Projektentwicklung und zum Fundraising.
DELPHI ist eine Plattform, die einen integrativen Raum für Ausstellungen, Lesungen und Projekte im Stadtteil Beurbarung bietet. Hier werden gesellschaftliche Themen aufgegriffen und in experimentelle künstlerische Projekte übersetzt, generationsübergreifender Austausch wird gefördert. Die Initiative entwickelt zielgruppenspezifische Formate der Beteiligung und der künstlerischen Interpretation davon. Beratung zu Organisationsentwicklung, Vereinsgründung und Fundraising.
"DELPHI“ ist ein integrativer Projektraum, der in der Freiburger Brühl-Beurbarung Platz für Ausstellungen, Lesungen und künstlerische Projekt bietet. Eine Gruppe von Engagierten steht hinter diesem Projekt, das auch einen Ort des Dialogs im Quartier bietet, wo gesellschaftliche Themen in verschiedenen Formaten aufgegriffen werden. Dies geschieht auch mithilfe experimenteller, künstlerischer Ansätze. Die Gruppe stärkt mit dem Projekt den Austausch im Quartier und ist als Bewegung offen für weitere Mitstreiter. Die Gruppe sieht in Freiburg noch Bedarf an frei zugänglichen und nicht kommerziellen Orten für einen generationenübergeifenden und interkulturellen Austausch. Der Projektraum DELPHI kann daher auch mit Ideen und Veranstaltungsideen der Bürger bespielt werden. Dazu stehen die Initiatoren mit weiteren Akteuren wie dem Stadtteil- oder dem Jugendtreff vor Ort im Austausch, um interdisziplinäre Kooperationen zu ermöglichen. Durch den Beteiligungstaler werden verschiedene Sachkosten finanziert, die mit der Ausrichtung von Veranstaltungen und Projekten im Raum anfallen.
Der Verein der Türkischen Arbeitnehmer in Herrenberg und Umgebung e.V. hat die Beobachtung vor Ort gemacht, dass junge Menschen der sogenannten Generation Z sich bereits offen über strukturelle Formen der Unterdrückung austauschen. Auch Missstände wie Rassismus und Sexismus können sie benennen. Dieselbe Diskussion unter Erwachsenen führe vor Ort jedoch noch oft in Sackgassen, in denen ein gemeinschaftlicher Umgang mit diesen gesellschaftlichen Herausforderungen erschwert ist. Das Projekt geht auf dieses Problem ein und wirkt dem entgegen. In einem Workshop für Erwachsene mit und ohne Migrationsgeschichte werden Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit begrifflich und theoretisch bekannt gemacht. Im Anschluss bleibt Raum zur Reflexion der eigenen Position und dem eigenen Umgang damit in der Gesellschaft. Ziel ist es, die Teilnehmenden zu einem wertschätzenden Umgang mit den Mitmenschen in der Kommune zu befähigen.
Als gemeinnütziger Verein bieten wir hauptsächlich Angebote für junge Pädagog*innen an. Jedoch zeichnet sich unsere Utopiewerkstatt gerade dadurch aus, dass wir ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringen wollen, die über die grundsätzlichen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gemeinsam in einen Austausch treten. Durch vielfältige Kreativmaterialien und -methoden können die Teilnehmenden sich hier auf eine andere Art und Weise mit der Frage auseinandersetzen, in welcher Gesellschaft sie eigentlich gerne leben wollen, und warum uns dies utopisch anstatt machbar erscheint. Dadurch werden aktuelle Problematiken des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht nur sichtbar, sondern es besteht durch das Benennen der Alternative auch die Möglichkeit, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.
Denk-Initiative Baden-Württemberg geht Folgen der Corona-Pandemie an!
„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.“ (Saint-Exupéry)
Daran wollen wir gerne mitarbeiten.
Wir, das sind: Friedrich Ulmer, Fotografenmeister und Coach Fotografie und Gunter König, Dipl.Psych, Supervisor und Coach, beide in Schwäbisch Hall. (s.a. www.Gunter-Koenig.de und www.ulmerfotografie.de)
Wir haben uns folgendes gedacht: In jeder Stadt in Baden-Württemberg treffen sich regelmäßig ab Frühlingsanfang etwa sieben Menschen. Diese Menschen werden vordenken: Wie gestaltet sich die Zeit „nach Corona“, welche Folgen haben die derzeitigen Veränderungen der Corona-Pandemie auf unser wirtschaftliches, soziales, gesellschaftliches...
Die Pforzheimer Initiative #zusammenhalten bringt vor Ort den Denkraum Corona auf den Weg, um den Dialog und den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder verstärkt zu fördern. Die Initiative hat bei ihrem Vorhaben nicht nur die Pforzheimer Kernstadt im Blick, sondern organisiert die Gesprächsformate auch über weitere Pforzheimer Stadtteile hinweg. Mit dem Format des Denkraums wird ein Rahmen geschaffen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade auch Menschen, die sich derzeit vermeintlich nichts mehr zu sagen haben, werden in den Blick genommen und gezielt für das Format angesprochen. Ihnen und allen anderen Teilnehmer soll es möglich werden, die eigenen Gedanken in einem geschützten Raum zu teilen, sich für andere Sichtweisen wieder zu öffnen und eines der wichtigsten Dinge (wieder) zu erschaffen: Verständnis füreinander und die Haltung des Gegenübers.
Die Initiative ermöglicht mit ihrem Projekt den Fortbestand des lokalen Bäckers, um die bestehende Infrastruktur und Lebensqualität im Ort zu erhalten. Durch einen potentiellen Wegfall des Bäckers befürchtet die Initiative einen Domino-Effekt für die umliegenden Läden, da dieser neben der Funktion der Nahversorgung auch ein Treffpunkt für die Einwohner*innen darstellt. Beratung erhält die Initiative dafür, inwiefern eine tragfähige Basis für eine Genossenschaft möglich ist und wie die Themen vor Ort konkret gelöst werden können.
Der Verein "Solidarische Landwirtschaft Inneringen e.V." baut gemeinsam mit seinen Mitglieder*innen Gemüse im Freiland an. Mit höchsten Ansprüchen an klima- und umweltgerechten Gartenbau wird gemeinschaftlich an einer lebendigen Nahversorgung gearbeitet. Im Rahmen des Projektes soll der Gemeinschaftsgarten öffentlich zugänglich gemacht werden und hin zu einer Bildungsstätte wachsen. Ziel ist es, Interessierte in die Lage zu versetzen, das in regelmäßig stattfindenden Workshops erworbene Wissen direkt in den eigenen Garten zu übertragen.
Eine Gruppe von Bürgern haben sich zusammengefunden, um zu überlegen wie mit der steigenden Zahl an Tagestouristen in den Weinbergen umgegangen werden kann bzw. wie ein niederschwelliges Angebot geschaffen werden kann, um die Touristen für die Kulturlandschaft zu sensibilisieren.
Die Region ist durch den Weinbau geprägt, der kein Wirtschaftsfaktor ist, sondern für die Region eine identitätsstiftende Tätigkeit ist. Ziel ist es zum einen die Menschen durch die Weinberge zu leiten, Informationen zu Rebsorten und Rebarbeiten bereitzustellen und zum anderen auf Rücksichtnahme auf Umwelt und Kulturlandschaft hinzuweisen.
Als langfristig angelegtes Projekt soll daher eine Wegbeschilderung des Panoramawegs um den Batzenberg entstehen, sowie begleitend dazu eine Webseite und Flyer.
Der gemeinnützige Verein Cent hinterm Komma e.V. engagiert sich für gesellschaftliche Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Handicap. Es geht dabei um barrierefreie Spielplätze, inklusive Freizeitmöglichkeiten, musisch-kulturelle Förderung. Modellprojekte wie die Installation einer flexiblen Kletterwand wurden u.a. mit dem Inklusionspreis der Stadt Karlsruhe ausgezeichnet. Die Veranstaltungsreihe "Salon" bringt Menschen des öffentlichen Lebens und "Alltagsexperten", also Betroffene, zu unterschiedlichen Themen rund um die gesellschaftliche Inklusion in einer Podiumsdiskussion zusammen. Grundsätzliche Probleme wie gesellschaftliche Teilhabe, Alltagsdiskriminierung, aber auch aktuelle Themen wie Vereinsamung durch die Pandemie, sollen kontrovers und offen diskutiert werden. Die Runden finden an unterschiedlichen Orten im öffentlichen Raum (auch an den Brennpunkten) statt und sind barrierefrei (Gebärdensprachdolmetscher).
Stipendienprogramm des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart e.V. für begabte und engagierte deutschtürkische Gymnasiasten und Studierende, die sich als ehrenamtliche Mentoren für Schüler engagieren.
Der Kreisdiakonieverband nutzt seine gute Vernetzung, um die unterschiedlichen Akteure wie engagierte Bürger, Initiativen, Vereine, Stadtverwaltung in Nürtingen zusammenzubringen und aktuelle Beratungs- und Unterstützungsbedarfe zu ermitteln. Ein wichtiges Thema ist Quartiers- und Stadtentwicklung. Beratung wird für einen moderierten Entwicklungsprozess eingesetzt, damit bestehende Angebote durch die Vorschläge von Bürger sinnvoll erweitert werden.
Mit der Dialogreihe "Wir sind WENDlingEr" bringt der Verein Ökologie und Mobilität Wendlingen die Bürger der Stadt ins Gespräch zum Thema Nachhaltigkeit. Am Ende des Prozesses steht eine Nachhaltigkeitsmesse, die auch entsprechende Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für das Thema und den Dialogprozess bringen soll. Teil der Nachbarschaftsgespräche sind Mitmach-Aktionen sowie Informations- und Aufklärungsveranstaltungen an zentralen Orten in Wendlingen. Auch das über die Stadt hinaus bekannte Vinzenzifest wird bespielt. Im Rahmen der Dialogveranstaltungen werden die Menschen dafür sensibilisiert, wie sie vor Ort im privaten und öffentlichen Leben zur Einsparung von Energie und Rohstoffen und insgesamt zur Reduzierung von Umweltschäden beitragen können. Gemeinsam als Gruppe wird das Bewusstsein und das Wissen über die Erfordernisse des umweltbewussten Umgangs mit Energie, Konsumgütern und Verkehrsmitteln im alltäglichen Leben weiterentwickelt und gestärkt.
Die Dialoggruppe „Fußgänger-Hängebrücke Rottweil“ möchte den Bau einer Fußgänger-Hängebrücke zwischen dem Testturm von Thyssen Krupp und der historischen Innenstadt dialogisch begleiten. Dazu möchte sie alle bei dem Projekt relevanten gesellschaftlichen Akteure aus dem städtischen Leben an einen Tisch bringen, um einen dialogorientierten Beteiligungsprozess zwischen Befürworter und Kritiker zu begleiten.
Der Kreisseniorenrat Tübingen e.V. schafft mit seinem Digitalforum einen neuen Ort des Austauschs auf Augenhöhe zwischen Senior*innen und Politik. Herzstück ist eine Kommunikationsplattform auf der aktuelle Themen im Landkreis Tübingen diskutiert und kommentiert werden können und Bürger*innen sich begegnen. Flankiert wird der Auftritt durch Interviews mit Spezialist*innen zur Vielfalt des Älterwerdens sowie Anregungen zur Entwicklung einer neuen "Kultur der Pflege". Gleichzeitig entsteht eine Vernetzungsmöglichkeit für die größeren und kleineren Initiativen und Quartiersentwicklungsprozesse im Landkreis, mit dem Ziel eines Austauschs, der gegenseitigen Unterstützung und Zusammenarbeit. Beratung erhält das Projekt zu den Themen "Förderung Medienkompetenz, Aufbau und Verschlagwortung interessanter Themenblöcke, Schulung von Helfern, die digitalen Bringdienst anbieten, Videobearbeitung und Arbeit im Netz."
Die WiGe (Wohnen in Gemeinschaft) engagiert sich für eine integrierte Stadtentwicklung im Sinne des Stadtentwicklungsplans der Stadt Radolfzell und leistet einen Beitrag für eine bedarfsgerechte, quartiersbezogene Infrastruktur, sowohl für Familien als auch für älter werdende Generationen. Das Ziel des Projektes ist es, ein Quartiersbüro einzurichten, als Anlauf- und Koordinierungsstelle für den Stadtteil und ein Treffpunkt für kulturelle und inklusive Aktionen, um auch Menschen außerhalb der WiGe konkrete Hilfe anzubieten und zur Begegnung und zum Austausch einzuladen. Beratung zu Methoden der Bürgerbeteiligung, zur Organisation und der Öffentlichkeitsarbeit.
Die Initiative "Weissach KLIMAschutz" konkret möchte ein vielfältiges Happy-Puzzle aus "Momenten des Miteinanders" und "Orten der Öffnung" für ein buntes Begegnungs- und Beteiligungsbild in Weissach erstellen. Geplant sind dazu verschiedene kleinere Aktivitäten, wodurch unterschiedliche Personengruppen erreicht werden sollen.
Das Jugendhaus in Elzach bietet bereits seit 20 Jahren das zentrale Angebot der Offenen Jugendarbeit. Es ist ein guter Zeitpunkt die bestehenden Strukturen und Formen zu analysieren. Hier ging es um die Neuorganisation des Vereins für die Jugend und die Konzeption der Offenen Jugendarbeit insbesondere für das Jugendhaus in Elzach. In einem breit angelegten Partizipationsverfahren wurde mit vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Stadt ein Prozess der Neugestaltung des selbstorganisierten Jugendhauses geplant und umgesetzt. Beratung und Begleitung zur Gestaltung der Neuorganisation, zur Entwicklung neuen Beteiligung- und Kommunikationsstrukturen.
Das Jugendhaus in Elzach - das zentrale Angebot der Offenen Jugendarbeit - wird 20. Es ist ein guter Zeitpunkt die bestehenden Strukturen und Formen zu analysieren. Hier geht es um die Neuorganisation des Vereins für die Jugend und die Konzeption der Offenen Jugendarbeit insbesondere für das Jugendhaus in Elzach. In einem breit angelegten Partizipationsverfahren soll mit möglichst vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Stadt ein Prozess der Neugestaltung des selbstorganisierten Jugendhauses geplant und umgesetzt werden. Beratung und Begleitung zur Gestaltung der Neuorganisation, zur Entwicklung neuen Beteiligung- und Kommunikationsstrukturen.
In Zeiten von Corona stellt die Bürgerbeteiligung eine ganz neue Herausforderung dar. Das Projekt hilft bei der Erarbeitung von neuen Methoden der analogen und digitalen Beteiligung in Schorndorf, um die Menschen trotz allem in die Entwicklungen des Sozialraums Nord einzubeziehen. Die Paulinenpflege arbeitet dort mit Migrant*innen und ist damit ein wichtiger Brückenbauer zu Menschen, die als „stille Gruppen“ oftmals nicht erreicht werden. Mit dem Netzwerk Wiesenstraße werden vielfältige Akteure regelmäßig zusammengebracht, um die Angebote im Quartier zu vernetzen und weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Beratung wird im Vorfeld ein Instrumentarium zu weiteren Quartiersprojekten ausgearbeitet, mit dem die Menschen vor Ort ihren Sozialraum gestalten können.
Der Arbeitskreis "Kommunikation und Information" ist einer von insgesamt sechs Arbeitskreisen, die sich im Rahmen eines Gemeindeentwicklungsprozesses mit dem Titel "LebensQualität durch Nähe (LQN) in Wittendorf gegründet haben. Die Gruppe arbeitet zusammen mit den anderen Arbeitskreisen an der Stärkung der Lebensqualität in der Gemeinde. In der Gruppe "Kommunikation und Information" bereiten die Engagierten vielfältige Informationen für die Wittendorfer auf und bespielen dabei sowohl Print- als auch soziale Medien (Zum Beispiel Facebook oder nebenan.de). Ergänzend zu seinen bisherigen Projekten will der Antragsteller nun Informationstafeln an gut besuchten Punkten im Ort (Metzger und Lebensmittelmarkt) anbringen, um relevante Informationen aus dem Gemeindeleben und vorhandene Infrastrukturen für die Bürgerschaft aufzubereiten und damit gerade auch Bürger zu informieren bzw. zu erreichen, die über keinen Zugang zu Internet und "Social Media" verfügen. Mit den Ladengeschäften wurde vereinbart, dass diese ihre Schaufenster für eine Anzeige zur Verfügung stellen. Die Wartung und die Ausarbeitung der Informationen übernimmt der Antragsteller selbst.
Das Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz e.V. hat sich 2019 hat sich im Rahmen von Bürgerveranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit, saubere Stadt und Streuobstwiesen gegründet. Der Verein produziert gemeinsam mit der Stadt den 3-Täler-Apfelsaft, pflegt Streuobstwiesen und beteiligt sich beim jährlichen Apfelfest vor Ort. Der Verein hat in der Coronakrise vermehrt den Wunsch aus der Sulzer Bürgerschaft vernommen, lokale digitale Beteiligungsmöglichkeiten auszubauen. Diesem Wunsch möchte sich der Antragsteller nun annehmen und ein mehrteiliges Qualifizierungsangebot für Vereinsvorstände und Mitmachinitiativen vor Ort anbieten. In der Qualifikation werden Onlinetools kennen gelernt und ausprobiert sowie Grundlagen der Online-Moderation vermittelt. Dazu soll ein Onlineraum zum Austausch für die Engagierten aus Sulz eröffnet und erprobt werden. Als Tool wurde dazu die Online-Plattform "humhub" ausgewählt. So sollen die Digitalkompetenzen der Ehrenamtlichen ausgebaut werden.
Die SAGES eG ist eine der ersten Genossenschaften in Deutschland für Haushaltshilfen und Alltagsassistenz für Senioren und Familien. Die Verbrauchergenossenschaft wurde bereits 2006 gegründet und unterstützt überwiegen ältere Menschen und deren Angehörige mit preisgünstigen Leistungen. Ein Newsletter und ein Veranstaltungskalender mit kulturellen und sportlichen Aktivitäten werden durch die Plattform DNA, Die Neuen Alten, digital verbreitet. Aktuell plant die SAGES eG bürgergetragene Nachbarschaftshilfe digital zu vernetzen. Anhand der zwei ausgewählten Quartiere der Nachbarschaftshilfe wird eine App erprobt, um die Einsätze und Aufwandsentschädigung transparent und effizient zu gestalten. Die Beratung wird für das Einrichteten der App und für die Organisation eines passenden Qualitätsmanagements benötigt.
Engagiert zusammenleben in Dielheim bündelt bürgerschaftliche Angebote wie Flüchtlingshilfe, Gartenfreunde, Bildung, Fairtrade und Jugendarbeit. Ein neues Projekt ist die "Offene Werkstatt", ein Raum in dem Dinge repariert werden können. Der Grundgedanke basiert auf der Ressourcenknappheit und der Weitergabe von Fähigkeiten an die nächste Generation. Die Werkstatt ist für alle offen und bringt Menschen zusammen, die Hilfe bei der Reparatur brauchen und Menschen mit Wissen, wie repariert werden kann. Zudem sind Kurse geplant, wie z.B. der Bau von Nistkästen.
Durch das Projekt werden bestehende und leerstehende Geschäftsräume wiederbelebt, um die Wiederherstellung und Sicherung der örtlichen Nahversorgung und Begegnungsstätten zu gewährleisten. Mit Hilfe einer Bürgerbeteiligung entsteht ein Gesamtkonzept, das vor Ort die Lebensqualität erhöht. Beratung erhält die Initiative zum prozesshaften Vorgehen, zur Einbindung von Bürger*innen und zu einer Analyse zum Gesamtkonzept.
Bermaringen ist ein dörflich geprägter Stadtteil Blausteins mit einem Nebeneinander von Landwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistung und Wohnen. Der strukturelle Wandel, die Nähe zu Ulm und die künftige Bahnhaltestelle Merklingen führen zu einer zunehmenden Bedeutung der reinen Wohnnutzung. Im Dialog mit der Bürgerschaft vor Ort, dem Ortschaftsrat und dem Gemeinderat wird der Weg für ein Dorfentwicklungskonzept geebnet, dass der dörfliche Charakter des Ortes erhalten und durch angemessene Infrastruktur für alle Generationen lebenswert bleibt. Die Beratung erhält die Initiative zu Erstellung und Durchführung des Dorfentwicklungsprozesses.
Die Arbeitsgruppe „Dorfgemeinschaft Holzhausen“, die Teil des Lenkungskreises „Sulz engagiert“ ist, möchte in Holzhausen ein Dorfgemeinschaftszentrum errichten, als Begegnungsraum für die Bewohner. Hier soll Raum sein, um gemeinsam Kaffee zu trinken, Spielenachmittage zu veranstalten, Vorträge sollen stattfinden und vor allem der Austausch untereinander soll gestärkt werden. Die Arbeitsgruppe erhält Beratung zu den Themen: Organisationsform, Marketing und Personalmanagement.
Das Ziel des Projekts ist die Einrichtung eines Dorfladens als belebendes Zentrum für ein gesellschaftliches Miteinander im Ortskern. Neben der reinen Grundversorgung steht vor allem das soziale, generationsübergreifende und inklusive Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund. Der Dorfladen soll gemeinsam mit einem Museum in dem ehemaligen Rathausgebäude entstehen. Der Beratungsgutschein wird zur Konzeptentwicklung, zur Rechtsform und zur Erstellung einer Satzung benötigt. Bevorzugt ist hier die Form der Bürgergesellschaft.
Eine Bürgergruppe arbeitet an einem Dorfladen in einem ehemaligen Rathausgebäude. Die Räume dafür stellt die Gemeinde Laichingen zur Verfügung. Mit dem Dorfladen wird ein lebendiges Zentrum mit Wirkung auf den umliegenden Dorfkern entstehen. Wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zur Eröffnung des Ladens ist die Beteiligung der Bewohner vor Ort. Mit Informationsveranstaltungen werden sie von der Gruppe in die Planungen mit eingebunden. Dazu gibt es an den Veranstaltungen Informationen zur Funktion des Ladens und zum aktuellen Projektstand. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit der Ausrichtung und Bewerbung der Informationsveranstaltungen anfallen.
Die Initiative möchte einen bürgerschaftlich getragenen Dorfladen in Buchenbach gründen. Die Gemeinde stellt die Geschäftsräume für ein Laden zur Verfügung. Professionelle Beratung für die Bewertung der Rahmenbedingungen vor Ort im Hinblick auf die Organisation und Wirtschaftlichkeit des Projektes ist dabei notwendig.
Bei dem Projekt handelt es sich um die Initiierung und Einrichtung eines bürgerschaftlich geführten Dorfladens in Buchenbach zur nachhaltigen Sicherstellung der Grund- und Nahversorgung vor Ort und zur Stärkung der Attraktivität der Dorfmitte. Nach der Durchführung einer Umfrage und Erstellung einer Standortanalyse zur Bewertung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit, geht es in der zweiten Projektphase um die Gründung der Dorfladen-Gesellschaft, das Mobilisieren des Eigenkapitals und das Errichten des Dorfladens. Die Initiative erhält hierfür eine qualifizierte Projektberatung.
Die Bürger-Arbeitsgruppe „Dorfladen“ aus Geislingen-Aufhausen hat sich nach einer Bürgerversammlung zum Thema: „Unser Dorf – unsere Zukunft“ zusammengefunden. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die seit 10 Jahren fehlende Einkaufsmöglichkeit in Geislingen-Aufhausen durch die Gründung eines Dorfladens zu lösen. Beratung benötigt die Arbeitsgruppe hinsichtlich der Fragen der Machbarkeit und daran anknüpfend der Rechtsform und des zukünftigen Betreibermodells des Dorfladens.
Die Bewohner*innen in Warmbach wünschen sich eine Einkaufsmöglichkeit (Ergebnis einer Umfrage), wo sie sich treffen können und regionale und saisonale Waren zu marktüblichen Preisen einkaufen können. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde die Initiative "Dorfladen Warmbach" gegründet. Mit der Einrichtung eines Dorfladens in Warmbach wird die Nahversorgung der Bewohner gewährleistet. Dabei legt der Dorfladen besonderen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit und dient ebenfalls als Treffpunkt der älteren aber auch jüngeren Bewohner*innen aus Warmbach. Der Dorfladen wird in Form einer Bürgergenossenschaft "Dorfladen Warmbach" organisiert werden. Die Beratung erfolgt in Form einer Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlichkeitsstudie zur Gründung und den Betrieb eines Dorfladens.
Der Wunsch nach einer zentralen, täglich geöffneten Einkaufsmöglichkeit mit Treffpunktfunktion in der Bevölkerung ist sehr groß. Hierfür gründet die Initiative einen bürgerschaftlich organisierten Dorfladen mit angeschlossenem Café. Durch den Laden erhofft sich das Projekt eine Quelle zur Identifikation mit Stupferich: durch regionale Produkte, kürzere Wege, bessere Teilhabe sowie Austausch und Gespräch. Die Beratung erfolgt zu folgenden Themen: Wahl der Gesellschaftsform, Infos zur nötigen Ausstattung des Ladens, Hilfe bei Verhandlungen mit Vermietern und Lieferanten, Hilfe beim Erstellen des Businessplans, Einarbeitung in die Themen Prüfberichte, Soll-Ist-Vergleich, Steuer, Controlling, Hinweise zum Netzwerkaufbau, Tipps zur Personaleinsatzplanung, Information zur Gruppenfindung, Teambuildung.
Bei diesem Projekt handelt es sich um die Einrichtung eines bürgerschaftlich geführten Dorfladens mit einem Café in Boxtal zur nachhaltigen Sicherstellung der Grund- und Nahversorgung und zur Steigerung der Lebensqualität vor Ort. Ein Dorfladen fungiert zudem als Absatzmarkt für die Kleinst-Landwirte aus der Region und als eine Begegnungsstätte für den sozialen Austausch. Boxtal ist ein Ortsteil von Freudenberg am Main mit ca. 750 Einwohnern. Die Initiative erhält eine qualifizierte Beratung zur Konzeptentwicklung und Projektorganisation.
Die Bürgerinitiative Dorfladen Boxtal errichtet einen Dorfladen mit Café als Begegnungsort. Die Projektidee beinhaltete neben der Sicherung der Grundversorgung und einem Mehrgenerationentreffpunkt folgende Innovationen im ländlichen Lebensraum: Vermarktung regionaler und lokaler Lebensmittel von kleinen Betrieben, kurze Wege und Einsparung von CO2 in den Warenanlieferung und im Verkauf, Reduzierung von Verpackungen sowie lokale Energiewende mit Eigenstromversorgung durch Photovoltaik und Ladestationen für E-Bikes und E-PKW. Die Beratung erhält die Initiative zur Projektorganisation und zur betriebswirtschaftlichen Konzeption.
Das Ziel des Projektes ist der Aufbau und der Betrieb eines Dorfladens zur Versorgung des Grundbedarfs an Nahrungsmittel in Dettighofen sowie der umliegenden Orte. Das nächste Lebensmittelgeschäft ist rund zehn Kilometer entfern. Die Bürger in der Gemeinde, insbesondere ältere Personen, wünschen sich einen Dorfladen mit den lokalen landwirtschaftlichen Produkten sowie einem Café/Bistro, einem Getränkemarkt und einer Begegnungsstätte. Der Beratungsgutschein wird für die Plausibilisierung des Konzeptes und für eine Machbarkeitsanalyse benötigt.
Die Initiativgruppe plant die Einrichtung und den Betrieb eines Dorfladens im Stadtteil Reichental, um die Grundversorgung direkt vor Ort zu ermöglichen. Das Gründungskapital kommt von Bürger, regionale Anbieter bilden das Sortiment. Beratung deckt die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsform des Unternehmens, Businessplan, Öffnungszeiten, Angebotspalette und Personalgewinnung ab.
Die Initiative kümmert sich um das Thema Nahversorgung im Ort und möchte die Gründung eines Dorfladens in Form einer Genossenschaft vorantreiben. Fachberatung zu verschiedenen Facetten der Projektumsetzung ist dabei notwendig.
Der demografische Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen sind auch in Rottenburg am Neckar spürbar. Das Projekt „Dorfladen Seebronn“ soll den Zugang zur Nahversorgung in der Ortschaft langfristig sichern und als Vorbild für weitere Ortschaften dienen. Unterstützung erhält die Initiative für die Standortanalyse sowie zur Gründüngung einer Genossenschaft.
Die Initiative Dorfladen Staufenberg setzt sich dafür ein, dass in Staufenberg ein neues Dorfzentrum errichtet wird. Damit soll ein Beitrag zur Nahversorgung geleistet werden und das Dorfcafé soll als Begegnungsstätte dienen. Beratung erhält die Initiative zu Fragen der Prozessausgestaltung und eines möglichen Betreibermodells.
Das Ziel der Bürgerinitiative „Dorfladen Staufenberg“ ist das Einrichten eines neuen Dorfzentrums in Staufenberg für eine lebendige Dorfgemeinschaft mit Zukunft. Das Dorfzentrum besteht aus einem Dorfladen für die unmittelbare Grundversorgung im Ort sowie einem Dorf Café mit Kaffee und Kuchen als lebendiger Treffpunkt im Herzen des Dorfes. Die Gruppe engagiert sich seit 2014 für das Projekt. Der Beratungsgutschein wird für die Gründung, die Einrichtung und den Betrieb eines Dorfladens für die Ortschaft Staufenberg benötigt. Das Dorfzentrum sichert die fußläufige Lebensmittelversorgung und bildet einen wichtigen sozialen Treffpunkt im Ort.
Die Initiative Dorfladen Wiesenbach möchte nach Schließung der Metzgerei im Ortsteil wieder eine Nahversorgung und einen angegliederten sozialen Treffpunkt schaffen. Beratung findet zur Gründung einer Genossenschaft sowie zu einer professionellen Bewertung der Rahmenbedingungen vor Ort im Hinblick auf Organisation und Wirtschaftlichkeit des Projekts statt.
Die Initiative Dorfladen Wiesenbach wirbt und informiert regelmäßig auf Dorfveranstaltungen für ihr Vorhaben, um wieder eine Nahversorgung und einen angegliederten sozialen Treffpunkt im Ortsteil in Form einer Bürgergenossenschaft zu schaffen. Das Einrichten eines Dorfladens befindet sich auf einem guten Weg, die Initiative benötigt aber weiterhin Beratung für die Rechts-, Organisations- und Personalfragen.
Die Initiative gründete zuerst eine Nachbarschaftshilfe für ein langes und selbständiges Wohnen Zuhause. Fehlende fußläufige Einkaufsmöglichkeiten schränken ältere Menschen ein. In einer Bürgerveranstaltung kam die Idee auf, einen Dorfladen in Sunthausen mit Zusatzdiensten wie Café, Paketdienst, Reinigung sowie als sozialer Treffpunkt aufzubauen. Beratung zur Rechtsformwahl und zur Umsetzung wird benötigt.
Die Arbeitsgruppe Dorfladen-Café Fessenbach gründete sich nach einer Bürgerversammlung 2016. In dieser wurde der Bedarf geäußert, dass Fessenbach einen Dorfladen haben soll, der die Grundversorgung vor Ort gewährleistet. Durch die Einrichtung eines Dorfladens in Fessenbach soll wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort geschaffen werden und dies zur Bildung einer lebendigen Dorfmitte beitragen. Beratung erhält die Arbeitsgruppe zu Fragen der Standortanalyse und des Betreibermodells.
Auf dem ehemaligen ZG-Raiffeisen Areal Wagenstadt entsteht ein multifunktionales Dorftreff. Im Konzept sind ein Dorfladen zur Nahversorgung, ein Dorfcafé mit Mittagstisch vorgesehen. Weitere Angebote im sozialen, kommunikativen und pflegerischen Bereich sind ebenfalls auf dem Gelände geplant: neue Formen des altersgerechten Wohnens, Krabbelgruppe, das Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentrum. Die Beratung erhält die Initiative zur Konzeptentwicklung des Bleichtaltreffs mit Dorfladen und Dorf Café sowie zur Gründung einer Träger-Genossenschaft.
Auf dem ehemaligen ZG-Raiffeisen Areal Wagenstadt entsteht ein multifunktionaler Dorftreff. Im Konzept sind ein Dorfladen zur Nahversorgung sowie ein Dorfcafé mit Mittagstisch vorgesehen. Weitere Angebote im sozialen, kommunikativen und pflegerischen Bereich sind ebenfalls auf dem Gelände geplant: neue Formen des altersgerechten Wohnens, eine Krabbelgruppe, das Sonderpädagogische Bildung- und Beratungszentrum. Die Beratung wird zur Durchführung der Basisanalyse nach dem DORV-Konzept benötigt.
Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag.
Das ehemalige ZG-Raiffeisen Areal Wagenstadt wird durch die Stadt erworben. Dort soll ein multifunktionaler Dorftreff entstehen. Im Konzept sind ein Dorfladen zur Nahversorgung und ein Dorfcafé mit Mittagstisch vorgesehen. Weitere Angebote im sozialen, kommunikativen und pflegerischen Bereich sind ebenfalls auf dem Gelände geplant: neue Formen des altersgerechten Wohnens, eine Krabbelgruppe sowie ein Sonderpädagogisches Bildung- und Beratungszentrum. Die Beratung zur Konzeptentwicklung des Bleichtaltreffs mit Dorfladen und Dorfcafé sowie zur Gründung einer Träger-Genossenschaft.
Eine Bürgergruppe arbeitet im Herbolzheimer Ortsteil Wagenstadt an der Eröffnung eines Dorfladens mit Treffpunkt für die Einwohner. Als Gebäude steht das ehemalige ZG-Raiffeisenlager zur Verfügung, das die Gemeinde gekauft hat. Die Gruppe vereint Bürger und Vertreter verschiedener Einrichtungen wie des örtlichen Kindergartens, der Schule und eines Bildungs- und Beratungszentrums. Ziel der Gruppe ist es, die wohnortnahe Nahversorgung weiterhin sicherzustellen. Eine Basisanalyse dient als Grundlage zum Aufbau des Dorfladens und wird im Rahmen eines Bürgerforums mit der Einwohnerschaft diskutiert. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit der Durchführung des Bürgerforums anfallen.
Das Projekt realisiert im alten Feuerwehrhaus einen Dorftreff mit Gemeinschaftsraum und einer Küche, das als Treffpunkt für Jung und Alt dient und für öffentliche Veranstaltungen genutzt wird. Angedacht sind zudem Möglichkeiten der regionalen Kleinkunst und Kultur. Weitere Veranstaltungen wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, der Betrieb eines Bürgercafés und eine Grundversorgung erweitern zudem das Angebot. Durch die Beratung erhält die Initiative Unterstützung zur Umsetzbarkeit des Projekts und darüber hinaus zur energetischen und klimafreundlichen Umgestaltung des Gebäudes.
Das historische Rathaus und der Dorfplatz in Bünzwangen erhalten durch die Neugestaltung und Sanierung durch die Initiative neues Leben und schaffen somit die Möglichkeit für regelmäßige Veranstaltungen und weitere multifunktionale Angebote. Diese Angebote umfassen u.a. Treffpunkte für Jung und Alt, Anlaufstellen für Menschen im höheren Alter und ein Raum für ein Café. Beratung erhält die Initiative zu den Themen Renovierung/Sanierung historischer Gebäude.
Der Bürgerverein Önsbach möchte ein Dorfzentrum gestalten, das Aspekte der Nahversorgung, Mobilität und Pflege zusammenbringt. Finanziert werden soll dies über ein Bürgerdarlehen. Zur weiteren Durchführung des Vorhabens bedarf es Beratung zu Themen der Projektentwicklung, Projektorganisation und Projektdurchführung.
Aufgrund der mangelnden Nahversorgung in Lahr Hugsweier hat sich die Initiative entschlossen ein DORV (Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung) Konzept umzusetzen, bei dem der zentrale Ort der Begegnung neben der Nahversorgung auch der Kommunikation, Dienstleistungen und Unterstützungsangebote Raum bietet. Die Beratung erfolgt zu den Themen Planung der Sortimentsgestaltung, Personalbeschaffung, Gespräche mit möglichen Lieferanten und Finanzierung.
Die Kernidee der Initiative ist die Schaffung eines DORV Zentrums als zentralen Begegnungsort mit Nahversorgung und Räumlichkeiten für das gesellschaftliche, kulturelle und soziale Miteinander vor Ort, für Kommunikation, Dienstleistungen und Unterstützungsangeboten sowie Gründung eines Vereins für den Betrieb des Ladens und zur Durchführung weiterer zivilgesellschaftlicher Aktivitäten. In Lahr-Hugsweier gibt es seit einigen Jahren keinerlei Angebote für Nahversorgung, insbesondere nach der Schließung der letzten Bäckerei. Die Beratung erfolgt zur Konzept- und Projektentwicklung. DORV bedeutet "Dienstleistungs- und Ortsnahe Rundum Versorgung".
Die Initiative verbessert die Nahversorgung in Kiebingen, wobei die Versorgung nicht nur auf den Erwerb von Lebensmitteln beschränkt ist, sondern darüber hinaus auch den persönlichen Kontakt zwischen den Kiebinger*innen verstärkt. Eines der zur Umsetzung des Projekts anvisierten Gebäude bietet neben der notwendigen Fläche für einen Laden mit Café-Bereich und das Büro Platz für einen Begegnungsraum von ca. 50m2 z.B. für Eltern-/Kindergruppen und bietet somit die Voraussetzungen ein neuer Mittelpunkt des Dorfes zu werden. Beratung erhält die Initiative bei der Umsetzung.
Entwicklung eines ganzheitlichen Versorgungskonzeptes für die Dorfbewohner: Lebensmittelgeschäft, Poststelle, Bankautomat, Café, Kulturtreff, Lotto, Bäcker, Metzger, Ort der Begegnung usw. Beratung in Form einer Basisanalyse der Machbarkeit.
Mit dem Projekt „DORV-Zentrum Horben“ entwickelt die Initiative für Nahversorgung „oben-bleiben“ ein ganzheitliches Konzept zur Sicherung der Nahversorgung im Ort. Horben ist eine kleine Gemeinde mit ca 1200 Einwohnern und rund um 20.000 Übernachtungen in den Ferienwohnungen ohne direkte Einkaufsmöglichkeit im Ort. Der Beratungsgutschein wird für die fachliche Begleitung der Initiative auf dem Weg zur Eröffnung eines multifunktionalen Dorfladens eingesetzt. Folgeantrag – der erste Beratungsgutschein wurde für die Durchführung einer Basisanalyse verwendet.
Die Bürgerinitiative hat sich zum Ziel gesetzt die Energiewende in Dossenheim voranzubringen. Sie setzen hierzu konkrete Projekte um und stoßen eine gesellschaftliche Diskussion zu Klimaschutzthemen an. Mit dem Projekt Dossenheimer nutzen Ökostrom informiert und berät die Initiative zu Ökostrom und Photovoltaik-Anlagen. Sie kommt dazu mit Dossenheimern zu Klimaschutzthemen ins Gespräch und sensibilisiert für die Dringlichkeit des Handelns. Ziel dabei ist es, den Anteil der Haushalte, die Ökostrom nutzen und Photovaltaikanlagen installieren, zu erhöhen. Die Initiative plant auf dem Wochenmarkt mit einem Stand präsent zu sein, dort zu beraten und im direkten Gespräch mögliche Hindernisse für den Umstieg auf Ökostrom aus dem Weg zu räumen. Zudem sind Informationsveranstaltungen geplant, um den Austausch zwischen Interessierten und PV-Anlagenbesitzern zu ermöglichen.
Neben dem Café Drehscheibe, das bereits durch die Initiative entstanden ist, ermöglicht das Projekt zudem den weiteren Ausbau des Angebotes vor Ort. Hierzu zählt insbesondere die Erweiterung des Angebotes im Gemeindehaus und die Finanzierung des Ehrenamtskoordinators über den Sommer 2024 hinaus. Beratung erfährt die Initiative zu den Themen der Moderation von Beteiligungsformaten, Möglichkeiten der Finanzierung und die Kooperation mit politischen Entscheidungsträgern.
Junge Menschen, die im Bereich der Jugendarbeit und Jugendbeteiligung im Landkreis Emmendingen aktiv sind und bereits dialogische Formate der politischen Bildung organisieren, haben sich für dieses Projekt zusammen geschlossen. Im Vorfeld der Landtagswahl Baden-Württemberg organisiert die Initiative einen "Jungen Politiktag" im Landkreis Emmendingen, um jungen Menschen, insbesondere den Erstwähler*innen zu ermöglichen, sich ein Bild über die Kandidaten der Parteien zu machen, die im Bundes- oder Landtag vertreten sind bzw. eine Aussicht auf Erfolg haben werden. Die Veranstaltung ist als hybrides Format geplant, um die Corona-Vorgaben einzuhalten, aber auch möglichst vielen Jugendlichen die Teilnahme zu ermöglichen. Jugendliche Stellvertreter treffen z.B. am Vormittag die Schülersprecher, nachmittags jugendliche Ausbildungsvertreter, am Abend Jugendsprecher der Jugendverbände auf die Kandidaten. Es soll zu einzelnen jugendrelevanten Themenfeldern (z.B. Bildung, Beteiligung, Mobilität, Klimaschutz, usw.) einen Dialog zwischen jungen Menschen und den Kandidaten stattfinden und aufgezeichnet werden, sodass er zum einen direkt, aber auch im Nachhinein angeschaut werden kann. Die Zusagen auf Mitwirkung der Kandidaten liegen vor.
Eine Gruppe von jungen Menschen, die im Bereich Jugendarbeit und -beteiligung sowie der politischen Bildung im Landkreis Emmendingen aktiv sind, organisieren einen Jungen Politiktag zur Bundestagswahl 2021. Sie ermöglichen damit jungen Menschen sich über die Kandidaten der Parteien zu informieren. Die Veranstaltung findet digital statt und sieht Gesprächsrunden mit den Kandidaten zu den Themenfeldern Bildung, Beteiligung, Mobilität und Klimaschutz vor. Sie findet voraussichtlich in Kooperation mit weiterführenden Schulen statt, für das ein begleitendes Vorbereitungsmodul entwickelt wird.
Die Initiative ist eine Genossenschaft und realisiert mit ihrem Projekt bezahlbaren innerstädtischen Wohnraum mit sozialem Mehrwert in Stuttgart und der Region. Durch die Partizipation wird dauerhaft Wohnraum in Gemeinschaft geschaffen und vielfältige Wohnkonzepte erarbeitet. Beratung erhält die Initiative für das Finanzkonzept und zum Fundraising.
Die Liebenau Teilhabe strebt mit dem Projekt eine Neuausrichtung des inklusiven Cafés und die Gründung eines Inklusionsbeirates für Dußlingen an. Dieser soll zukünftig als Expertenforum auch politische Beschlüsse des Gemeinderates begleiten und damit Dußlingen auf dem Weg zur inklusiven Gemeinde unterstützen. Beratung erhält die Initiative beim Aufbau einer Organisations- und Beiratsstruktur, um inklusive Prozesse nachhaltig im Gemeinwesen verankern zu können. Außerdem deckt die Beratung die Entwicklung eines Inklusionskonzeptes für die Kommune ab.
Die Liebenau Teilhabe ist Träger von Einrichtungen und Diensten für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen. Darüber hinaus betreut die Liebenau Teilhabe das Dußlinger Inklusionsprojekt „Dußlingen auf dem Weg zur inklusiven Gemeinde“, innerhalb dessen auch das „Dußlinger Projekt-Café“ angesiedelt ist. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam niederschwellige und inklusive Angebotsstrukturen für alle Bürger anzubieten. Durch das Café Projekt soll ein Beitrag zur inklusiven Gemeinwesenarbeit geleistet werden. Beratung erhält die Liebenau Teilhabe zur strukturellen Weiterentwicklung und Verstetigung des Projekt-Cafés.
Die Gruppe möchte mittels Bürgerbeteiligung ein CarSharing-System mit Elektroautos in Bad Säckingen initiieren. Das Interesse der Bevölkerung für die klimaneutrale Mobilität wird in öffentlichen Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität, mit Informationsständen und Bürgerbefragungen geweckt. Prozessberatung zur Etablierung der Projektidee.
Solar mobil Heidenheim wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, regenerative Antriebe zu propagieren. Aktuell soll ein CarSharing Angebot mit einem ortsnahen Betreiber initiiert werden. Im Idealfall mit dem Stromversorger Stadtwerke AG Heidenheim. Beratung zu Projektaufbau und Management.
EasyStreet organisiert jährlich ein Straßentheaterfestival in unterschiedlichen Quartieren in Freiburg mit einem dezentralen Konzept, um im Sinne der Quartiersentwicklung die unterschiedlichen Viertel Freiburgs mit Stadtteilkultur zu beleben.
Mit professionellem Theater, das direkt auf der Straße, ohne Eintritt und Barrieren gezeigt wird, ermöglicht einem breiten Publikum die Teilhabe am kulturellen Leben. Mit der Auswahl der dezentralen Spielorten in zum Teil sozialen Brennpunkten, wird der Rahmen für Begegnung von Menschen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen geschaffen.
Ecocurious ist ein offenes Hands-on-Labor für Dich und mich. Wir machen Citizen Science & DIY* und bieten Dir Workshops und Meetings an, in denen Du gemeinsam mit Anderen an interessanten Fragestellungen rund um die Themenfelder Umwelt, Natur und Technik forschen kannst. Wir sind in der Region Tübingen/Stuttgart (Region Neckar-Alb) aktiv. (* Bürgerforschung und Selbstgebautes)
Bei uns kannst Du:
> einen Insektencounter bauen und Insekten digital erkennen
> Strahlung selber messen, einen eigenen Geigerzähler bauen
> Teil unseres Bürger-Umweltdaten-Messnetzes werden
An welchen Themen würdest Du gerne arbeiten?
Finde Deine Community oder entwickle Dein eigenes Forschungs-Projekt im Ecocurious Lab – mit unserer Hilfe!
Der Kreisjugendring ist ein Zusammenschluss von 21 Vereinen und Verbänden im Landkreis Sigmaringen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Wichtigste Aufgabe ist die Qualifizierung und Unterstützung der Ehrenamtlichen. Neu gegründet wurde der AK "Netzwerk Ehrenamt" zur Akquise von Ehrenamtlichen. Mitglieder sind das Rote Kreuz, Caritas, katholische Dekanate, evangelische Jugend, Jugendagentur des Landkreis Sigmaringen, die Stadt Sigmaringen und der Kreisjugendring. Ziel des Arbeitskreises ist es Ehrenamtliche zu unterstützen, weitere zu gewinnen und die bereits im Ehrenamt Tätige zu halten. Momentane Aufgabe ist es, die Corona-Krise im Ehrenamt zu bewältigen. Die Situation der Ehrenamtliche ist sehr unterschiedliche, einige sind froh aktiv werden zu können, andere ziehen sich zurück oder sind gelähmt durch den Lockdown. Der Arbeitskreis möchte Ehrenamtliche beim Weg aus der Krise begleiten und unterstützen, um möglichst wenig Engagement und Engagierte zu verlieren.
Eine erste Aktion des Arbeitskreises war die Imagekampagne "Du bist Gold wert" zur Motivation von Ehrenamtlichen. Daran anschließend folgt die Kampagne "Durchhalten - wir brauchen dich!".
Die landkreisweite Kampagne erfolgt analog mit Bannern, Postkarten und Plakate sowie online über soziale Medien. Begleitend dazu findet eine Online Veranstaltung für Vereine und Ehrenamtliche zum Thema wie der Wiedereinstieg ins Ehrenamt gelingen kann, statt.
Mit seinem „Sozialraumorientierten Konzept: Ehrenamt für gelingendes Altern“ bietet DRK ein Kombinationsangebot für ältere Menschen an: Betreuungsdienst, aktivierende Hausbesuche, Entlastung für pflegende Angehörige. Diese Leistungen werden von Ehrenamtlichen durchgeführt, die aus dem sozialen Umfeld von Betroffenen stammen. Dadurch werden soziale Isolation und Einsamkeit vorgebeugt. Eine Vernetzung mit anderen Einrichtungen und der Kommune ist geplant. Beratung wird zur Konzeptentwicklung, zur Nachhaltigkeit des Projektes und zur Nutzerargumentation benötigt.
Mit seinem „Sozialraumorientierten Konzept: Ehrenamt für gelingendes Altern“ möchte der DRK ein Kombinationsangebot für ältere Menschen anbieten: Betreuungsdienst, aktivierende Hausbesuche, Entlastung für pflegende Angehörige. Diese Leistungen werden von Ehrenamtlichen, die aus dem sozialen Umfeld von Betroffenen stammen, durchgeführt. Soziale Isolation und Einsamkeit werden dadurch vorgebeugt. Vernetzung mit anderen Einrichtungen und der Kommune ist geplant. Beratung wird zu Konzeptentwicklung, Nachhaltigkeit des Projektes und Nutzerargumentation benötigt.
Der Landsknechtszug Ellerbach-Freyberg e.V. ist ein historischer Fanfarenzug. Der Verein stellt seine Kostüme und Uniformen selbst her. Daher gibt es auch eine vereinseigene Nähgruppe. In der Corona-Krise ist die Idee entstanden, dass lokalen Senioren- und Pflegeeinrichtungen mit von Vereinsmitgliedern selbst genähten Behelfs-Mund-Nasen-Schutzmasken („Facies“) versorgt werden könnten. Die Anleitung für das Nähen der Masken ist auch auf der Homepage des Vereins zu finden, ebenso wie ein Aufruf zum Mitnähen an die Bevölkerung. Die Stadt hat daraufhin eine eigene Email-Adresse eingerichtet, damit sich weitere "nähwillige" Ehrenamtliche melden können. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Nähstoffe der Ehrenamtlichen anfallen.
Der Verein „Miteinander Bürger-Selbsthilfe Frickingen e.V.“ möchte hilfebedürftigen Mitbürger ehrenamtliche Unterstützung anbieten in Form von Hilfen rund ums Haus, Begleitung im Alltag, Versorgung mit Mittagsessen, Betreuung und Besuchsdiensten. Um dies weiterhin vollumfänglich anbieten zu können, benötigt der bestehende Verein Beratungshilfe durch einen Steuerberater.
Der Stadtseniorenrat Waldkirch arbeitet an der Entwicklung einer „Bürgerbusidee“, die im Rahmen einer Zukunftswerkstatt des Klimaschutzkonzeptes aufkam. In der Umfrage „Gut älter werden in Waldkirch“ wurde eine mögliche Einrichtung eines Bürgerbusses als ergänzendes Mobilitätsangebot sehr positiv bewertet. Daraufhin bildete sich eine Arbeitsgruppe für die Konkretisierung der Projektidee, mehrere Personen meldeten sich als potenzielle Fahrer an. Der Beratungsgutschein wird für die Bürgerbuskonzeption für Waldkirch eingesetzt.
Der Bürgerverein möchte die Lebensqualität und Attraktivität Gauangellochs für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen auf Dauer erhalten und steigen. Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Leitbilds zur Zukunftssicherung des Ortes mit der Bürgerschaft in folgenden Bereichen: Förderung der Familienfreundlichkeit und der generationsübergreifenden Gemeinschaft, Erhalt und Verbesserung des ÖPNV, Aufbau eines Bürgerzentrums im alten Rathaus usw. Externe Beratung für die Begleitung einer Zukunftswerkstatt ist dabei notwendig.
"Ein Quartier, eine Idee! Wir können Nachhaltig!": Unter diesem Titel richtet der Arbeitskreis Haus der Gesundheit ein Quartiersfest rund um das Thema Nachhaltigkeit in Heidenheim aus. Neben der Aufmerksamkeit für das Thema sollen weitere Kooperationen im eigenen Quartier entstehen. Den Quartierbewohnern wird bewusst viel Raum gegeben: Sie können sich am Festtag mit eigenen Ideen und Projekten einbringen. Die Stadt Heidenheim ist ebenfalls involviert und unterstützt zum Beispiel mit einem Fachvortrag zur Nachhaltigkeitspolitik der Stadt. Mit dem Beteiligungstaler werden Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit und das Rahmenprogramm des Festes finanziert.
Der Verein möchte die Gemeinschaft in der Nachbarschaft erlebbar machen und soziale Verantwortung fördern. Hauptziel des Projektes ist die Gründung eines Quartierszentrums als Ort der Begegnung, ein Raum für Veranstaltungen und ein geselliges Miteinander. Beratung wird zur Realisierung des Projektes, Projektplanung, Einbindung möglicher Kooperationspartner sowie der Einrichtung eines Bürgerforums im Quartier genutzt.
Duha hat das Ziel, Menschen mit Behinderung und Demenzkranken Leben und Teilhabe in Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei liegt der Schwerpunkt von Duha auf kultursensibler Beratung und Betreuung. Alle Angebote des Vereins werden sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch angeboten.
Als ein weiterer Schritt möchte der Verein die sprachliche Barriere abbauen und die Webseite in leichte Sprache übersetzen. Die Übersetzung soll professionell bearbeitet werden und durch Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund überprüft werden.
Durch das Projekt werden Akteure in Heidenheim miteinander vernetzt, die sich den Themen Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung verschrieben haben. Langfristig entsteht die Etablierung eines Mittagstisches für Tafel-Kunden, Bildung im Bereich Ernährung und das Heben des Engagement-Potentials bei Studierenden. Durch die Beratung erfolgt die Moderation aller Beteiligungsformate, die Kommunikationsstrategie für das Projekt, die Projektsteuerung und Hilfe rund um die Themen Finanzierung und Engagementförderung.
Die Freiburger Kinderhausinitiative (FKI) ist aus der Tradition ehemaliger Elterninitiativen entstanden. Seit 35 Jahren ist die FKI anerkannter Träger der Jugendhilfe in Freiburg und betreibt derzeit neun kleine Einrichtungen für Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren. Im Kinderhaus „Fang die Maus" wird nach den Prinzipien der „Kinderstube der Demokratie" eine Verfassung erarbeitet, in der demokratische Entscheidungsstrukturen als Recht der Kinder im Kinderhaus strukturell verankert sind. Der Pilotprozess wird von einer externen Referentin angeleitet. Im Rahmen des Schneeballverfahrens und durch die Teilnahme von Mitarbeitern aus den anderen Häusern werden die Strukturen innerhalb von drei Jahren auch auf die anderen acht Häuser übertragen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Raummiete für den Pilotprozess anfallen.
Netzwerk zur Förderung einer nachhaltigen und global gerechten Entwicklung
Im Bildungs- und Begegnungszentrum Stauferschule (BBS) sind bereits der Bürgertreff und die Stadtteilkoordination integriert. Die Hauptamtlichen aus verschiedenen Einrichtungen arbeiten bereits zusammen. Es bietet sich nun die Chance die im BBS organisierte Bürgerschaft für ein Miteinander im Stadtteil zu gewinnen. Damit sind die Elternbeiräte der Grundschule, der beiden Kitas, der Behindertenschule, der Jugendtreff und der Förderverein Weststadt gemeint. Das Ziel des Projekts ist es, das Miteinander zu stärken und ein WIR-Gefühl im Stadtteil entstehen zu lassen. Der Beratungsgutschein wird für die Entwicklung eines passenden Beteiligungsformats verwendet.
Im Karlsruher Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock entsteht mit dem "Grünen Haus" ein offener Raum für das Quartier. Dieser offene Raum dient der niedrigschwelligen Begegnung, bei der auch die nachhaltige und passende Organisationsform entwickelt wird. Die Initiative erhält die Beratung zur Konzeption und Durchführung eines Beteiligungsverfahrens hinsichtlich der konkreten Umsetzung sowie zur Entwicklung einer tragfähigen Organisationsstruktur mit dem Kooperationsteam.
Die Initiative bildet sich aus interessierten Bürger*innen, die mittels Bürgerbeteiligung zukunftsfähige und klimaschonende Mobilität durch ein kluges Carsharing-Angebot im Dorf initiiert. Hierfür findet ein regelmäßiger Mobilitätskreis statt, der sich um eine verbesserte, nachhaltige Mobilität kümmert. Beratung erhält die Initiative für die Begleitung des Beteiligungsprozesses.
Die Bürgerinitiative setzt sich für eine zukunftsfähige Mobilität ein, mit dem Ziel CO2 zu reduzieren. Dazu hat die Initiative einen Mobilitätsarbeitskreis gegründet und veranstaltet Mobilitätstage, um für Bürger alternative Formen der Mobilität erlebbar zu machen und Akzeptanz für das Thema zu erhöhen. In einem Bürgerbeteiligungsprozess und in Kooperation mit der Kommune wird das Interesse zu unterschiedlichen Mobilitätsbausteine abgefragt. Um die Bereitschaft zur Veränderung zu erhöhen sind zudem Veranstaltungen und Werbemaßnahmen geplant.
Der Arbeitskreis "Zukunftsfähige Mobilität Stühlingen" ist eine Gruppe von Interessierten, die mittels Bürgerbeteiligung zukunftsfähige und klimaschonende Mobilität für alle durch ein kluges Car-Sharing-Angebot in der Stadt initiiert. Für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung erhält die Initiative eine Beratung, die die fachlichen Voraussetzungen mitbringt, sie über die Entwicklung der Zukunftsmobilität der letzten Jahre informiert und bei der Entwicklung und Umsetzung der nächsten Schritte hilft (z.B. Bürgerbeteiligung und Etablierung der Projektidee).
Die Bürgerstiftung realisiert und unterstützt soziale, kulturelle und ökologische Projekte in Dußlingen. Zu ihren Projekten gehören ein Bürgerauto, Ort der Begegnung, Spieleabende, Mehr-Generationentheater und eine Backscheune. Zweck der Projekte ist die aktive Mitgestaltung des Zusammenlebens und der Vorbeuge gegen Isolierung oder Ausgrenzung.
In einem denkmalgeschützten Gebäude in Dußlingen wird die dazugehörende Scheune zu einer Backscheune umgenutzt. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Bürger wie damals ihren Brotteig mitbringen können und dann Brote in einem Holzbackofen ausgebacken werden können. Die Backscheune soll zu einem Ort der Zusammenkunft und des Austauschs werden und so die Gemeinschaft stärken. Das Projekt wird mit vielen Ehrenamtlichen betrieben und ein nicht kommerzielles Café mit eingebaut, wo sich z.B. Initiativen und Gruppen treffen können. Perspektivisch kann der Ort zu einem Kulturzentrum werden mit Vorträgen und Lesungen.
In der Gemeinde Schuttertal soll im Ortsteil Schweighausen ein Dorfladen die Grund- und Nahversorgung nachhaltig sichern. Ergänzt werden soll das Angebot durch eine Begegnungsstätte mit einem kleinen Café, das innerhalb des Dorfladens eigerichtet werden soll. Beratung benötigt die Initiative unter anderem zu Fragen der Standortanalyse und Sortimentsplanung.
Plattform lebenswert


Auf Wunsch der Bürger des Unteren Ringelbachs sollte ein Quartiers-Forum im Rahmen eines Wochenmarkts etabliert werden. An diesem sollten Nachbarschaftsgespräche sowie quartiersbezogene Mitmach-Angebote stattfinden. Außerdem sollten mehrere kleinere Nachbarschaftsgespräche in verschiedenen Formaten stattfinden, bei denen sich Bürger zu Themen und Entwicklungen in ihrem Stadtteil austauschen können. Das Quartiersforum sollte der Ausgangspunkt sein, Bürger dieses Quartiers miteinander ins Gespräch zu bringen, sich gegenseitig zu vernetzen und einander bürgerschaftlich zu unterstützen. Das Vorhaben konnte aufgrund der Corona-bedingten Situation nicht wie geplant umgesetzt werden.
Jedoch wurde die Projektidee angepasst: Nachbarschaftsgespräche in kleinen Gruppen konnten wie geplant durchgeführt werden. Das Quartiersforum im Rahmen eines Wochenmarktes konnte nicht realisiert werden und der ersatzweise geplante Quartierstreff ohne Wochenmarkt fiel den verschärften Hygiene-Auflagen der Corona-Pandemie zum Opfer. Jedoch konnte ein Quartiersspaziergang mit Bewohner des Stadtteils durchgeführt werden. An mehreren Stationen diskutierten die Teilnehmer dabei über verschiedene quartiersbezogene Themen wie zum Beispiel: Unter welchen Voraussetzungen wäre gemeinschaftliches Gärtnern im Ringelbach möglich? Während des Spaziergangs konnten spontan Passanten dazustoßen und ins Gespräch mit einbezogen werden. Die Bewohner machten Vorschläge wo und wie der Nachbarschaftsgedanke besser verwirklicht werden könnte und wiesen auf Missstände wie Müllprobleme hin.
Neben dem Spaziergang konnten noch kleinere Nachbarschaftstreffen realisiert werden. Hierbei ging es um ein ungezwungenes Kennenlernen der Bewohner untereinander sowie den Austausch über aktuelle Themen in der Nachbarschaft. So wurde über ein bevorstehendes Bauprojekt gesprochen und über Möglichkeiten einer Realisierung gemeinschaftlichen Wohnens.
Eine Gruppe aus dem Quartier konnte außerdem gemeinsam mit einer Grafikerin ein Logo als Markenzeichen für die Nachbarschaftsgespräche im Quartier entwickeln. Als Slogan wurde "Hallo Nachbarn" gewählt.
Die Bürgerstiftung realisiert und unterstützt soziale, kulturelle und ökologische Projekte in Dußlingen. Zu ihren Projekten gehören ein Bürgerauto, Ort der Begegnung, Spieleabende, Mehr-Generationentheater und eine Backscheune. Zweck der Projekte ist die aktive Mitgestaltung des Zusammenlebens und der Vorbeuge gegen Isolierung oder Ausgrenzung.
Zur Verbesserung des Austauschs setzt die Bürgerstiftung zusammen mit nebenan.de ein Nachbarschaftsnetzwerk auf und schult die Engagierten im Umgang mit der Plattform.
Hiermit wird der niederschwellige Austausch der Einwohner untereinander ermöglicht. Die Plattform ist für die Nutzer*innen kostenfrei und eröffnet ein breites Spektrum von Warentausch bis zur Gründung von Interessengruppen, Veranstaltungsankündigungen, Hilfsdiensten und vielem mehr.
Das "Marktplatz11"-Team hat mittlerweile eine Genossenschaft gegründet und ist auf der Zielgeraden, mitten im Ortskern von Mehrstetten einen Einkaufs- und Begegnungsort zu etablieren. Ein Lebensmittelladen mit Café-Betrieb soll einerseits die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen, andererseits ein Treffpunkt für alle Generationen werden. Marktplatz 11 beantragt einen Beratungsgutschein für die Erstellung eines Konzepts zur Ladeneinrichtung.
Die Bürgerenergiegenossenschaft Teningen e.G. initiiert Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie sowie Maßnahmen zum Klimaschutz vor Ort und in der Region. Das Ziel der Initiative ist der Einstieg in eine klimaneutrale und zukunftsfähige Mobilität sowie die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, die Reduktion der CO2 Emission und die Schonung von Ressourcen. Dafür wird ein E-Mobilitätskonzept zur Umgestaltung in eine nachhaltige Mobilität gemeinsam mit der Bevölkerung und in der Kooperation mit der Gemeinde erarbeitet. Beratungsgutschein zur Organisation von Beteiligungsveranstaltungen und zur Etablierung der Projektidee.
Die Initiative Klimaschonende Mobilität für Stockach laden regelmäßig zu öffentlichen Runden Tischen Mobilität ein. Aus diesem Format hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die Carsharing in Stockach als einen Baustein der klimaschonenden Mobilität voranbringen will.
Um Carsharing in Stockach als einen wichtigen Bestandteil eines Mobilitätmixes aus ÖPNV, Fahrrad, Fußwegen und gelegentlicher Autonutzung zu integrieren, braucht es ein sinnvolles Carsharing-Angebot. Um dieses mittels Bürgerbeteiligung zu entwickeln, finden Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung statt sowie Öffentlichkeitsarbeit.
In einem ersten Schritt muss Carsharing auch in Stockach ein sinnvoller und integrativer Bestandteil eines Mobilitätsmixes aus ÖPNV, Fahrrad, Fußwegen und gelegentlicher Autonutzung werden. Daher entwickelt die Initiative mittels Bürgerbeteiligung eine zukunftsfähige und klimaschonende Mobilität für alle durch ein kluges Carsharing-Angebot. Für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung erhält die Initiative eine Beratung, die die fachlichen Voraussetzungen mitbringt, sie über die Entwicklung der Zukunftsmobilität der letzten Jahre informiert und bei der Entwicklung und Umsetzung der nächsten Schritte hilft (z.B. Bürgerbeteiligung und Etablierung der Projektidee).
Die Initiative weckt die Sensibilität für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz und engagiert sich seit längerem für CarSharing in Kappel. Mittels eines Bürgerbeteiligungsprozesses wird die Bereitschaft für alternative Mobilitätsformen in der Bevölkerung abgefragt. Dadurch wird der ökologische Fußabdruck der gesamten Kommune verbessert und ein wesentlicher Beitrag zur Einsparung von Ressourcen und CO2-Vermeidung geleistet. Der Beratungsgutschein wird für das Ausrichten und die Organisation von Bürgerbeteiligungsveranstaltungen zu diesem Projekt verwendet.
Ein Arbeitskreis arbeitet im Freiburger Stadtteil Kappel an einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Mobilität. Ziel ist die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und eine Reduktion des CO²-Austoß. Der Arbeitskreis verfolgt verschiedene Ziele wie die Etablierung eines Carsharing-Angebots, die Verbesserung der Fahrradwege und des Nahverkehrsanschlusses vor Ort. Mit Bürgerinformationsveranstaltungen, einer Vortragsreihe zum Thema sowie weiteren Werbemaßnahmen macht der Arbeitskreis die Bevölkerung auf das Projekt aufmerksam. Teil davon werden auch Probefahrten sein, die per Flyer allen Einwohnern angeboten werden. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt anfallen.
Die Initiative weckt die Sensibilität für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz in Wittnau. Das vorhandene E-CarSharing Auto wird um das E-Lastenfahrrad erweitert. Mittels eines Bürgerbeteiligungsprozesses wird die Bereitschaft für alternative Mobilitätsformen in der Bevölkerung abgefragt: eine Mitfahrbörse, ein Hol-Bring Dienst, Dadurch wird der ökologische Fußabdruck der gesamten Kommune verbessert und ein wesentlicher Beitrag zur Einsparung von Ressourcen und CO2-Vermeidung geleistet. Für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zu Bürgerbeteiligung an diesem Projekt wird der Beratungsgutschein benötigt.
Das Aktionsbündnis "Freiburg 5G frei“ setzt sich für eine Information über mögliche Risiken der fünften Generation des Mobilfunks (kurz: 5G) ein. Dafür hat das Bündnis in Freiburg erfolgreich die nötige Stimmenanzahl für eine vom Gemeinderat bestätigte Einwohnerversammlung gesammelt. Die Versammlung findet im städtischen Paulussaal statt. Rund um die Veranstaltung macht die Initiative auf ihre Positionen zum Thema 5G aufmerksam. Im Vorfeld der Veranstaltung hat die Initiative dafür Flyer gedruckt und Anzeigen in den lokalen Medien geschaltet. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Initiative anfallen.
El Palito ist ein interkulturelles Projekt, an dem Menschen aus verschiedenen Kulturen zu den Themen Natur, Kunst und Gesellschaft zusammenkommen und sich dafür einsetzen. Zentrales Thema im Urban-Gardening-Projekt ist die Permakultur. Einige hundert Menschen haben den Garten gestaltet, gebaut und Workshops besucht. Mit dem Samenbomben-Projekt möchte El palito Menschen dazu anregen, selbst einen Garten zu bepflanzen. Die Samenbomben werden verschenkt und gemeinsam mit Kooperationspartner*innen ausgegeben, um damit Impulse zu setzen.
Engagierte Eltern führen im Vaihinger Ortsteil Enzweihingen ein integratives Elterncafé. Mit dem Zuzug von Geflüchteten bemerkte die Gruppe, dass viele Eltern mit Flucht- oder Migrationshintergrund dem neuen (Schul-)System hilflos gegenüberstehen. Im Rahmen des Elterncafés wird die Eltern-Schul-Bindung verbessert. Auch Informationen rund um das Thema Schule werden geteilt. Dazu entstehen für die Zugewanderten neue Kontakte vor Ort. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten wie zum Beispiel die Raummiete finanziert, die mit der Ausrichtung des Elterncafés anfallen.
Ehrenamtliche im Hoffnungshaus stehen Geflüchteten, die zusammen mit den Ehrenamtlichen im Hoffnungshaus wohnen, als Ansprechpartnern zur Verfügung und leisten Einzelfallhilfe und organisieren Gemeinschaftsevents. Sie helfen mit, dass Integration gelingt.
Durch das Begleiten von teilweise traumatisierten Personen können bei den Ehrenamtlichen starke psychische Belastungen entstehen. Um mit dieser Belastung gut umgehen zu können, braucht es Raum diese zu thematisieren, Teambildung zu stärken und Bildungsimpulse zu setzen. Eine Ehrenamts-Klausur soll diese Themen aufgreifen.
Das Energie-Netzwerk focus.energie e.V. wurde gegründet, um Energie-Themen zu bündeln, Angebote zu koordinieren und ein Netzwerk aufzubauen. Mit Aktionen werden neue Impulse für eine nachhaltige Energie-Zukunft gesetzt, dabei Menschen zusammen gebracht und Wissen und Kompetenz aufgebaut.
fokus.energie veranstaltet ein Energie- und Klimafestival im Rahmen der Energiewendetagen BW zu den Themen Energiewende und Wärmewende sowie ein Jugendforum mit dem Thema Klimaschutz zum Beruf machen. Das Festival richtet sich an die Bürger der Stadt und hat ein umfangreiches Programm mit Aktionen, Workshops, Informationen und Mitmachangeboten.
Der Verein Nachhaltige Zukunft Waldstetten e.V. setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Waldstetten ein. In einem Klimagespräch wurde der Dialog mit den Bürgern begonnen, der nun mit einem Energiegipfel fortgesetzt wird. Bürger erhalten aktuelle Informationen und Hilfestellungen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und nächste Schritte umzusetzen. Die Veranstaltung ist an den Waldstetter Herbst angedockt, um eine direkte Ansprache von möglichst vielen Personen zu ermöglichen. Ziel des Energiegipfels ist es, die Ergebnisse aus dem Klimagespräch sichtbar zu machen, aktuelle Informationen zum Thema Wärme und Stromerzeugung zu vermitteln, Mitmacher für vorgestellte Aktionen zu gewinnen und die Ansprache von neuen Engagierten.
Der Förderverein für Energiesparen und Solarenergie-Nutzung e.V. sieht seine Aufgaben darin, Informationen über Energiesparen, Energieeffizienz und die Nutzung von erneuerbaren Energieträgern zur Verfügung zu stellen. Als neues Projekt möchte der Verein die nachbarschaftliche Energieversorgung verstärkt in den Blick nehmen und hierfür Konzepte gemeinsam mit Fachkräften und Bürger erstellen. Beratung erhält der Verein zu Fragen der Prozessausgestaltung.
Gemeinsam für MORGEN setzt sich gemäß ihres Namens für Mobilität, Offenheit, Regionalität, Generationengerechtigkeit, Energie und Nachhaltigkeit ein. In enger Kooperation mit der Gemeinde Bötzingen führt der Verein verschiedene Aktionen durch.
Zum Thema Energiewende laden sie zu einer Perspektivwerkstatt ein, um Ansätze zu finden, wie möglichst viele Personen sich an der Energiewende beteiligen können. Experten aus unterschiedlichen Bereichen beraten wie die ersten Schritte hin zu einer nachhaltigen und autarken Gemeinde aussehen können. Im Anschluss werden Arbeitsgruppen gegründet.
Der Verein "Gemeinsam für MORGEN e.V." organisiert eine Perspektivwerkstatt zum Thema "Energiewende - jetzt einfach machen! Aber wie?". Hierbei werden insbesondere die Themen Klimawandel und Energie näher betrachtet und über autarke Möglichkeiten der Energiegewinnung und -speicherung informiert und mit Hilfe einer Bürgerbeteiligung für Bötzingen erarbeitet. Der Verein erhält die Beratung für verschiedene Themen des Klimawandels, sowie der Energiespeicherung und -gewinnung.
Der "Energiestammtisch Salem" setzt sich für Projekte der Energiewende ein und startet mit der Installation von einer Photovoltaik-Anlage auf dem Sportheim in Neufrach, das als Ort der Begegnung und darüber hinaus als Veranstaltungsstätte genutzt wird. Der Stammtisch trifft sich seit Ende 2022 und diskutiert über den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien, Energieeinsparung durch bauliche Maßnahmen und persönliches Verhalten zur Energiewende. Die Beratung erfolgt für gesellschaftliche und juristische Arten zur Bürgerbeteiligung, Projektmanagement und die Begleitung des Projekts bis zum Abschluss.
Der städtische Friedhof in Ditzingen erlebt den Wandel der Begräbnis- und Trauerkultur. Viele suchen nach Alternativen. Aktuelle Veränderungen der Friedhofs- und Bestattungskultur gehen mit Veränderungen der Trauerformen einher. Dieses Bürgerprojekt möchte diese Veränderungen aktiv mitgestalten: Ausstellung, Vernetzung mit Schulen, Verbänden sowie Gestaltung von Freiflächen auf dem Friedhof. Fachliche Beratung wird zu Projektorganisation, Entwicklung von Angeboten, Bearbeitung des Themas Trauer und Bestattungskultur genutzt.
Der städtische Friedhof in Ditzingen erlebt den Wandel der Begräbnis- und Trauerkultur. Viele Angehörigen suchen nach alternativen Bestattungsmöglichkeiten. Auf dem Friedhof entstehen Freiflächen, die anders genutzt werden können. Aktuelle Veränderungen der Friedhofs- und Bestattungskultur gehen mit Veränderungen der Trauerformen einher. Das Ziel des Bürgerprojektes ist es, diese Veränderungen aktiv mitzugestalten und die Bürgerschaft darüber zu informieren. Das Thema Trauer wird im Rahmen von verschieden Veranstaltungen behandelt, wie z.B. selbst organisierte Ausstellung "Ökologisch nachhaltiger Friedhof". Frei werde Flächen auf dem Friedhof werden als Orte der Begegnung verstanden, um die Bürgerschaft in Ditzingen zum Austausch rund um das Thema Trauerkultur zu bestärken.
Das Projekt verändert mit Hilfe von partizipativen Prozessen eine brachliegende städtische Fläche zu einer hochwertigen Begegnungsfläche für alle Menschen aus Kirrlach. Hierzu finden Workshops zur Konzeptentwicklung, Arbeitseinsätze und die Konzeptionierung zur Nutzung statt. Für die Umsetzung erhält die Gruppe Beratung zu Ansprachestrategien und Adressierung bisher nicht involvierter Gruppen und zum Fundraising.
Die Bürgergemeinschaft Oberried (BGO) kümmert sich um soziale Aufgaben in der Gemeinde. Ältere und hilfebedürftige Menschen werden im Alltag unterstützt, deren Angehörige dadurch zeitweise entlastet. Momentan saniert die Gemeinde das Quartier Ursulinenhof. Eine barrierefreie Tagespflegeeinrichtung ist geplant. Die neu gegründete Wohnbaugenossenschaft errichtet derzeit mehrere Wohnungen. Die BGO möchte ein innovatives Konzept des Miteinanders im neuen Quartier unter breiter Beteiligung gemeinsam entwickeln und später realisieren. Der Beratungsgutschein wird für die konzeptionelle Entwicklung des neuen Miteinanders sowie für die Entwicklung der Tagespflege und der Wohngruppe eingesetzt.
Der Arbeitskreis Klimaschutz Stegen arbeitet vor Ort in der kleinen Gemeinde im Dreisamtal an einer umweltverträglichen und autoreduzierten Mobilität. Dafür verfolgt die Gruppe verschiedene Ziele wie zum Beispiel die Festlegung eines Standorts für ein Carsharing-Auto sowie für weitere kleine Mobilitätsstationen für Pedelecs. Im Bürgerbeteiligungsprozess wird auch geklärt, wie groß die Bereitschaft in der Bevölkerung ist, das Konzept des Bürgerbusses "Dreisamstromers" aus dem benachbarten Kirchzarten nach Stegen zu übertragen. Durch den Beteiligungstaler werden zum Beispiel Sachkosten finanziert, die durch die Beteiligungsveranstaltungen anfallen.
Die Oikos eG ist eine Genossenschaft in Mannheim, die sich für ihre Nachbarschaft für einen Gemeinschaftsgarten einsetzt und gemeinsam mit anderen Bewohner*innen umliegender Häuser den innenliegenden Hof zum urban-gardening gestalten möchte. Das Projekt soll zur Artenvielfalt einheimischer Pflanzen und Tiere beitragen und insbesondere auch Jugendliche und Kinder für das Thema begeistern.
Die Kultur- und Klosterstiftung Horb führt einen offenen und partizipativen Entwicklungsprozess durch, der das Ziel hat, das bisher seit Jahrzehnten bestehende Kulturangebot in Horb und Umgebung auch in Zukunft zu erhalten und weiterzuentwickeln. Insbesondere werden mit diesem Prozess jüngere und aktive Kulturinteressierte gefunden, motiviert und befähigt, um am Ende ein formales Netzwerk gründen. Das Kloster Horb ist hierbei der zentrale Ort dieses Netzwerkes. Die Öffentlichkeit wird über die öffentliche Veranstaltungen, die Presse, die Homepage des Klosters, Social Media und über persönliche Anschreiben sichergestellt. Die Beratung erfolgt zu folgenden Themen: Auftragsklärung mit Auftraggeber; Umfeld- und Akteursanalyse der zivilgesellschaftlich getragenen alternativen Kulturlandschaft im weitesten Sinne in Horb, Projektkonzeption, Zeitplan, Abstimmungsgespräche mit Arbeitgebern, Konzept und Durchführung der Prozessgestaltung; Gewinnung und Motivation von Akteuren, die auf der Grundlage bürgerschaftlichen Engagements ein dauerhaftes Netzwerk für den Erhalt und die Entwicklung eines alternativen Kulturangebotes im ländlichen Raum schaffen; Abschlussbericht mit Vorschlag für eine Trägerkonzeption.
Der Arbeitskreis Integration Sinzheim versteht sich als Partner der hautamtlichen Flüchtlings- und Sozialarbeit in der Gemeinde. Das Hauptmerk liegt dabei auf den Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit mit den zugewanderten Menschen muss an die geänderten Bedürfnisse neuausgerichtet werden, um das vorhandene Engagement neu zu motivieren und weitere Unterstützer zu gewinnen. Dies wird in einem Workshop-Projekt erarbeitet. Der Beratungsgutschein soll für die konzeptionelle Entwicklung des Workshops, die Durchführung sowie ein paar Reflexionstermine eingesetzt werden.
Durch das Projekt entsteht eine offizielle Mountainbike Strecke in Holzgerlingen, die von allen Interessierten genutzt und akzeptiert wird, um das Befahren von inoffiziellen Strecken, die ohne Maßgaben errichten wurden, zu unterbinden. Die Strecke erweitert das Freizeitangebot vor Ort und sorgt für die Abwechslung zu normalen Radwegen. Beratung und Begleitung erfolgt zu Beteiligungsformaten rund um das Projekt.
Der Helferkreis „Flüchtlinge Riegel“ möchte ein bedarfsgerechtes und nachhaltig verankertes Unterstützungssystem für Flüchtlinge innerhalb der Gemeinde konzipieren. Die Entwicklung eines Konzepts für Bürgerdialoge soll so gestaltet werden, dass es standardisiert auch von anderen Gemeinden adaptiert werden kann. Beratung wünscht sich der Helferkreis zum Thema Gestaltung von Beteiligungssettings und Erstellung übertragbarer Ablaufpläne für Bürgerbeteiligungsprozesse.
Projektziel ist die Erarbeitung einer wissenschaftlichen Empfehlung zur Umsetzung eines nachhaltig-ökologischen Hochwasserschutzes unter der Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Akteuren und der Bürgerschaft. Hierbei erhalten die Fördernehmer Beratung. Das Projekt soll die Beteiligungs- und Partizipationsfähigkeit der Bürgerschaft in Umwelt-und Naturschutzfragen vor Ort fördern.
Die AG Erinnerungskultur setzt sich dafür ein, dass die Vergangenheit der NS-Zeit nicht vergessen wird, um daraus für die Zukunft zu lernen. Beim Projekt Bodnegger:innen in der Nazizeit: Geschichte und Geschichten in Kurzfassung liegt der Fokus auf den Opfern, diese bekommen mit der Aufarbeitung einen Namen. Ihre Geschichte wird in einer Informationsbroschüre veröffentlicht.
Der Degerlocher Frauenkreis bietet vielfältige Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements und trägt so zum sozialen und kulturellen Leben im Stadtteil Degerloch bei. In Kooperation mit anderen Vereinen arbeitet er an der Vernetzung, Stärkung und Sichtbarmachung bürgerschaftlichen Engagements durch gemeinsame Veranstaltungen.
Im Rahmen eines Straßenfestes anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Weltladens Degerloch plant der Frauenkreis eine eritreische Kaffeezeremonie. Ziel ist es, über Kaffee anschaulich das Thema fairer Handel zu vermitteln und auf die Situation und Kultur in den Produktionsländern aufmerksam zu machen.
Die BruderhausDiakonie Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bietet Angebote für Menschen mit Behinderungen an, um Barrieren abzubauen und Begegnungen zu schaffen. Durch Angebote wie einen Erlebnispfad, Kultur, ein Café und auch ein Selbstbedienungsmarkt mit Verschenkeecke wird Inklusion im Erlebnishof Pochenmühle gelebt. Die Beratung erhält die Initiative zur Finanzierung der Projektidee, zu den nächsten Schritten, sowie zur Etablierung der Idee im Sozialraum.
Der Dorfladen in Jechtingen ermöglicht neben dem Zugang zu Lebensmitteln und täglichen Bedarfsartikeln auch die Möglichkeit des Treffpunkt für die Bewohner*innen. Somit werden die Versorgungslücken in Jechtingen geschlossen, die durch die Entfernung oder Schließung lokaler Geschäfte entstanden sind. Der Dorfladen basiert auf einem Konzept. welches von der Gemeinschaft auf Selbstbedienungsbasis getragen wird. Beraten wird die Initiative über das gesamte Projekt für die Etablierung des Dorfladens.
Die ErzählBar ist eine studentische Initiative, die sich für die Belebung der Nürtinger Stadtgesellschaft einsetzt und mit Beteiligungsprojekten in der Stadt sichtbar wird. Angesichts der Corona-Pandemie hat die Initiative das Medium des Podcasts für ihr crossmediales Beteiligungsprojekt gewählt. In der ErzählBar treffen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, werden gehört und kommen zu Wort. Studierende recherchieren und moderieren Geschichten aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Methodisch orientieren sie sich dabei an Storytelling und Oral History. Sobald die Pandemielage es zulässt, findet die ErzählBar auch vor Ort statt. Über Socialmedia werden Vorschläge zu Themen und Gästen gesammelt.
Das Bündnis Esslingen aufs Rad besteht seit 2015, um den Radverkehr in der Stadt am Neckar zu stärken. Das Bündnis will den Radverkehrsanteil von derzeit rund zehn Prozent um zehn bis zwanzig Prozentpunkte anheben. Dafür trifft sich die Gruppe einmal monatlich und informiert mit einem Mailverteiler weitere interessierte über seine Aktivitäten vor Ort. Die „Critical Mass“-Radrunde jeden dritten Freitag durch Esslingen ist eine davon. Um die Öffentlichkeitsarbeit der Gruppe zu stärken, wird mit der Sachkostenfinanzierung ein neuer Homepage-Auftritt professionell entwickelt.
Der Arbeitskreis Klima hat sich im Rahmen des Klimagesprächs gebildet, um die auf dem Klimagespräch geplanten Projekte umzusetzen. Die beteiligten Bürger*innen kamen zu dem Entschluss, dass die Etablierung eines Arbeitskreis Klima geeignet ist, um die Projekte auch langfristig zu verwirklichen. Damit der Arbeitskreis Klima zielorientiert arbeiten kann wird eine professionelle Moderation benötigt, um möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Arbeitsweisen einbinden und mitnehmen zu können. Als Multiplikator für Wissen im Bereich erneuerbarer Energien möchte der Arbeitskreis Klima mit Anschauungsobjekten z.B. mit einem Balkonkraftwerk neue Interessierte gewinnen.
Durch den Beschluss der Gemeinde Remshalden bis 2035 klimaneutral zu werden, wird ein Gremium zum Klimaschutz eingesetzt, dass Verwaltung, Vereine, Politik und Initiativen miteinander verknüpft, um gemeinsame Ziele und Vorstellungen festzulegen. Hierfür gründet das Projekt den "Runden Tisch Klimaschutz", der eng mit der Gemeinde zusammenarbeiten wird. Die Beratung erfolgt für die Moderation der ersten Treffen und die Etablierung des Runden Tisches.
Der Bürgerfahrdienst Aspach verbessert die Teilhabe der älteren und mobilitätseingeschränkten Personen, die sich bereits nach der Etablierungsphase in der Modellphase befindet. Für die Auswertung und Evaluation, sowie für das Bürgerbeteiligungsverfahren erhält die Initiative die Beratung, um eine längerfristige Etablierung zu gewährleisten, um auch darüber hinaus weiterhin für soziale Vernetzung in Aspach zu sorgen.
Bildungseinrichtung/Tagungstätte der Ev. Landeskirche Württemberg
Die Bürgergemeinschaft Grünkraut organisiert verschiedene niederschwellige Beteiligungsangebote vor Ort. Darunter ist auch ein sozialer Fahrdienst für Senioren, der den öffentlichen Nahverkehr vor Ort ergänzt. Der Fahrdienst, der aus 16 ehrenamtlichen Fahrern und einer Person zur Koordinierung besteht, vergrößert den Bewegungsradius von körperlich eingeschränkten Menschen. Das Angebot ist für verschiedene Zwecke (Einkauf, Frisör- oder Arztbesuch etc.) nutzbar und ermöglicht mehr Selbstständigkeit und eine aktive Teilnahme am Gemeindeleben. Mit dem Beteiligungstaler wird ein Startpaket zur Fahrzeugausrüstung sowie ein Erste-Hilfe-Kurs für die Fahrer finanziert.
Der ADFC setzt sich für die Förderung des Radverkehrs ein, als Beitrag zur Verkehrswende um Klimaneutralität zu erreichen. Gemeinsam mit dem Verein "Flüchtlinge und Wir" führen sie das Projekt Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge in Herrenberg durch. Dafür spenden Herrenberger*innen alte Fahrräder und die Initiative setzt die Räder gemeinsam mit den Flüchtlingen instand. In Form eines Repair-Cafes können die Räder repariert und damit Ressourcen geschont und das Umsteigen aufs Rad gefördert werden.
Demokratie lebt von Ideenvielfalt und davon, dass jede_r einen Unterschied machen kann – der Einsatz lohnt sich. Das Lörracher Rathaus erarbeitet 2016 gemeinsam mit Lörracher Bürger_innen ein neues Leitbild. fairNETZt, das Lörracher Netzwerk bürgerschaftlicher Initiativen, und der Werkraum Schöpflin begleiteten den Leitbildprozess mit Workshops.
Damit ist die Bürgerbeteiligung in Lörrach nicht vollendet, sondern fängt gerade erst an: fairNETZt und Werkraum Schöpflin laden engagierte Bürger_innen, Mitarbeiter_innen der Verwaltung und Vertreter_innen der Kommunalpolitik zu interaktiven Vorträgen und Workshops ein: von juristischen und praktischen Grundlagen über das Kennenlernen gelingender Beispiele bis zum Ausprobieren der erlernten Instrumente.
Der Arbeitskreis „Eltern sein in Riegel“ gründete sich als Folge des Onlinebeteiligungsprozesses „Eltern sein in Riegel“. Ziel der Initiative ist es, aktuelle Themen zu Kindergärten (u.a. Gebühren und Einzugsgebiete) und den für die Lebensqualität von Eltern und Kindern relevanten Beiträgen mehr Gewicht zu verleihen. Gemeinsam mit Kindern der Grundschule sollen die Spielplätze in Riegel hinsichtlich einer bedarfsgerechten Gestaltung unter die Lupe genommen werden und mögliche Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. Beratung für diesen Prozess erhält der Arbeitskreis zur Verankerung von Bürgerbeteiligung in der Gemeinderatsarbeit und zu inhaltlichen Fragestellungen.
Dachverband verschiedener sozialer Organisationen
Ein Sportangebot, welches alle Esslinger/innen unabhängig von Herkunft, Alter, sozialem Status oder Geschlecht zusammenbringt und über den Sport eine gemeinsame Begegnung ermöglicht.
Menschen mit unterschiedlicher Herkunft wollen gemeinsam mit einer Künstlerin eine Mosaikskulptur in Form einer Sitzbank gestalten. Diese soll im öffentlichen Raum als Symbol der Vielfalt in Reutlingen sichtbar gemacht werden. Die Bank soll zudem als Treffpunkt der Begegnung dienen. Die Gestaltung der Bank findet in Workshops statt und ermöglicht durch gemeinsames Arbeiten das Knüpfen von Kontakten und den interkulturellen Austausch.
Der FC Esslingen vertritt die Grundhaltung, dass Fußballspielen mehr als nur sportlicher Wettkampf ist. Die 250 Spieler lernen im Verein entscheidende Schlüsselqualifikationen und wirken als Multiplikatoren in ihren Netzwerken. Dieser Grundgedanke kann von anderen Vereinen adaptiert und auf die Problemlagen vor Ort angewendet werden. Das soziale Profil des Vereins soll weiter ausgebaut werden und perspektivisch ein Vielfältigkeitsmanagement etabliert werden.
Dazu wird ein Fest der sportlichen Vielfalt gemeinsam mit Esslinger Vereinen organisiert. Alle Menschen mit und ohne Handicap werden zum Fest eingeladen an den Angeboten der unterschiedlichen Trägern teilzunehmen.
Jeder Kooperationspartner beteiligt sich mit einem eigenen Angebot, an dem die Besucher teilnehmen und an den unterschiedlichen Stationen Stempelkarte ausfüllen können. Zudem gibt es ein Bühnenprogramm sowie die Möglichkeit sich über die städtebaulichen Entwicklungen zu informieren.
Ziel der Veranstaltung ist es, die Vielfältigkeit in der Gesellschaft sichtbar zu machen, Netzwerkarbeit zu stärken und über die Quartiersentwicklung zu informieren.
Die Bodensee-Stiftung setzt sich für mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz in der Bodenseeregion ein. Projekteübergreifend stellt sie die Sensibilisierung, den Dialog und die Vernetzung der Akteure sowie die Bildungsarbeit in den Fokus. Mit dem Projekt Flower Kids werden Kinder des Kinderkulturzentrums Lollipop an das Thema Wildbienen und Vielfalt herangeführt. Ein weiteres Angebot im Rahmen des Projekts, ist der "Platz der Vielfalt". Die Kinder sähen und pflanzen zusammen mit ihren Eltern und legen eine insekten- und klimafreundliche Fläche am Kinderkulturzentrum an. Dieser Platz bietet Raum für Begegnung, an dem Kurse Klimaschutz und Biodiversität kindgerecht vermittelt werden. Ziel ist es, dass Kinder durch ihre Beschäftigung mit den Themen als Botschafterinnen fungieren und Familie und Freunde für das Thema sensibilisieren.
Gemeinsames Arbeiten (Herstellung von Holzspielzeug und Gartenmöbeln), wöchentl. Vereins-Treffen, Teilnahme und Organisation an/von Kulturveranstaltungen, Begegnungskaffee, Nachbarschaftshilfe...
Der Kreisjugendring Rems-Murr e.V. möchte ein Projekt initiieren, das die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe und der Jugendarbeit in einer gemeinsamen Zusammenarbeit unterstützt, um so Personen mit Fluchterfahrung eine möglichst gute Integration in bereits bestehende Strukturen zu ermöglichen. Beratung erhält der Verein zur Konzepterstellung für eine gelingende Qualifizierung und Stärkung der Ehrenamtlichen vor Ort in der Jugendarbeit und der Flüchtlingshilfe.
Die Initiative GoodFood teilt ihr Wissen, Erfahrung und Begeisterung zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung mit anderen Bürgern. Die Initiative hat ein didaktisches Spiel "FoodPrint" entwickelt, das auf spielerische Weise, die Folgen von Ernährung auf Umwelt, Natur und Tiere aufzeigt. Das Spiel ist bisher nur in deutscher Sprache und wird in weitere Sprachen übersetzt, um ein noch breiteres Publikum anzusprechen. Ziel ist die Steigerung der Aufmerksamkeit für das Thema klimafreundliche Ernährung in der Bevölkerung
Die Initiative „Schlüssel für Alle e.V.“ ist ein Verein für gehörlose und hörgeschädigte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Der Verein bemüht sich um bessere Verständigungsmöglichkeiten und mehr Selbstbestimmung sowie Partizipation von Menschen mit Hörbehinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Der Verein erhält Beratung um Fachinformationen für Menschen mit Hörbehinderung und Fluchterfahrung sowie Hilfemöglichkeiten seitens des Vereins präsentieren zu können.
Die Initiative setzt sich für die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen und die Beratung zur Nutzung und Verwendung geeigneter Verkehrsmittel ein. Das Projekt sichert die nachhaltige Mobilität, indem Lastenanhänger, Zubehör und Materialien für die Verleihstandorte gefördert werden. Zudem veranstaltet die Initiative im Rahmen des Projekts Veranstaltungen zur nachhaltigen Mobilität.
Der „Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim e.V.“ möchte die Wohnsituation im Alter nicht dem Zufall überlassen, sondern die zukünftigen Bewohner schon frühzeitig in den Gestaltungsprozess von alternativen Wohnformen einbeziehen. Gemeinsam mit interessierten Bürgern soll erarbeitet werden, ob und wie ein bedarfsgerechtes alternatives Wohnprojekt in Bad Dürrheim entwickelt und realisiert werden kann.
Durch das Projekt wird ein Sharing-Angebot in Bonndorf angeboten, die durch Bürgerbeteiligung erarbeitet wird und insbesondere für eine Reduktion von CO2 und Individualverkehr, sowie eine Erweiterung der Angebote im Bereich nachhaltige Mobilität sorgt. Hierfür erhält die Initiative eine Beratung für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung, gepaart mit einer Information zum Fortschritt der Entwicklung von Zukunftsmobilität.
Das Forum 2030 ist ein Netzwerk zivilgesellschaftlich engagierter Gruppierungen und Initiativen, das gemeinsam mit den Kirchen, Gewerkschaften und den Ortsverbänden der Kirchheimer Grünen und LINKEN kritisch-konstruktive Impulse zur Umsetzung der UN-Agenda 2030 (17 Nachhaltigkeitsziele) in Richtung Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürgergesellschaft kommuniziert. Durch die Vernetzung werden die einzelnen Initiativen gestärkt.
Das Forum "Aktiv älter werden" handelt von einer Bürgerbeteiligung, die sich insbesondere seniorenspezifischen Angelegenheiten und ihre Einbindung in die Projektarbeit widmet. Die Ideen aus dem Forum sollen die Lebensqualität von Senior*innen verbessern, mögliche Aktivitäten bieten und letztendlich gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Beratung erhält die Initiative bei den Themen der Prozessgestaltung, der Erstellung einer Fokusgruppe und bei der Begleitung des Forums.
Der Lenkungskreis Forum Courage koordiniert die Gemeinwesen- und Seelsorgearbeit im Kirchenbezirk für die Flüchtlingsarbeit, fördert Akzeptanz und Begegnung sowie den interkulturellen und interreligiösen Dialog. Um die aktiven ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit weiter zu bestärken und auf deren Bedürfnisse eingehen zu können, möchte das Forum Courage Problemzentriert agieren. Beratung erhält der Lenkungskreis zu Fragen der Prozessgestaltung.
Die Gruppe "Zusammen Zukunft Gestalten" (ZZG) ist eine Bürgerinitiative für Menschen, die im Remstal rund um die Gemeinde Remshalden zu Hause sind. Gemeinsam will die Gruppe eine positive Zukunft in der Gemeinde erreichen und dabei möglichst viele Bürger in die Ideenfindung für dieses Zeil einbeziehen. In einem Bürgerrat, dessen Teilnehmende per Zufallsauswahl ermittelt werden, wird die Gemeindeentwicklung in Remshalden anhand von Leitfragen in den Blick genommen. In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse von den Teilnehmenden und der Moderation der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstaltung wird intensiv von der Gemeinde, den Teilnehmern und den Mitgliedern der Bürgerinitiative beworben, wobei hier die persönliche Ansprache von Multiplikatoren eine wichtige Rolle spielt. Auf der Veranstaltung werden alle Anwesenden eingeladen, sich aktiv mit den Ergebnissen auseinander zu setzen und sie mit eigenen Gedanken und Vorschlägen anzureichern. Die Endergebnisse werden dokumentiert und der Gemeinde für den weiteren Entwicklungsprozess zur Verfügung gestellt.
Das Forum Inklusiv vertritt die Interessen von gehandicapten Menschen in Ostfildern. Ziel ist die ungehinderte Teilhabe aller Bürger am gesellschaftlichen Leben vor Ort. Deshalb setzt sich die Gruppe auch dafür ein, dass alle Bauten in Ostfildern von Anfang an barrierefrei geplant werden. Auf seine Arbeit macht das Forum an Orten wie dem Bürgerbüro und anderen öffentlichen Einrichtungen aufmerksam. Die Gruppe bewirbt dort auch ein regelmäßiges Treffen, bei dem sich Akteure aus der Zivilgesellschaft mit Interesse am Thema Inklusion austauschen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für den Druck neuer Infoflyer des Forums anfallen. Teil des neuen Flyers ist ein in einfacher Sprache gehaltenes Beiblatt, das gehandicapte Personen auf die Arbeit der Gruppe aufmerksam macht.
Der Runde Tisch Lörrach ist Akteur im Mitmachplan Klima der Stadt Lörrach, um die Klimaneutralität der Stadt zu erreichen. Er ist für alle Bürger offen und vermittelt Wissen zu einzelnen Themenfelder, trägt zur Bewusstseinsbildung bei und bietet Möglichkeiten des Austauschs. Ein Themenfeld ist die Stadtbegrünung. Mit einer Fotoausstellung unter dem Titel "Grün statt Grau in der Stadt" wird die Notwendigkeit von Stadtbegrünung in Zeiten des Klimawandels und Artensterbens hervorgehoben, insbesondere zur CO2-Reduzierung, zur Kühlung und als Lebensraum für Insekten. An der Ausstellung arbeiten zudem die Ev. Erwachsenenbildung, der BUND und die Stadt Lörrach mit.
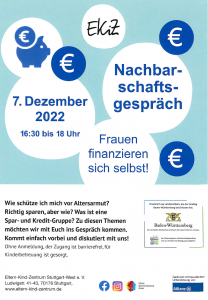
Das Eltern-Kind-Zentrum in Stuttgart West veranstaltet Nachbarschaftsgespräche zu den Themen Frauen und Finanzen, in denen zu wichtigen Aspekten wie Geld, Finanzierung und Rente im Alter das Gespräch gesucht wird. Überwiegend Frauen - davon viele Alleinerziehende - laufen im Alter Gefahr, in der Altersarmut zu landen. Da sich diese Beobachtung in der Zukunft mitsamt den steigenden Lebenshaltungskosten noch zuspitzen könnte, wird im Rahmen der Gespräche auch mit Befragungen und persönlicher Ansprache auf Spielplätzen, Marktplätzen und im Zentrum selbst auf das Thema aufmerksam gemacht. Das Thema wird im Format eines "World-Cafés" mit Arbeitstischen zu verschiedenen Fragestellungen bearbeitet. Dabei wird auf eine offene Einladung gesetzt. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden in einem Bericht dokumentiert, zusammengefasst und auf der Homepage öffentlich gemacht.
Die Initiative erarbeitet einen Leitfaden, wie ehrenamtlich Engagierte im Bereich Sozialpsychiatrie gewonnen werden können und eine Inklusion stattfindet, indem Bürger*innen Bürger*innen helfen. Die Beratung erfolgt für den gesamten Projektablauf und Fragen wie beispielweise, was zeitgemäße Bürgerhilfe konkret meint und Bürgerhelfer*innen konkret helfen können.
Der Verein "Mobil-Gemeinschaft Staufen e.V. (kurz: MobiGeiST)" fördert mit ihrem Projektvorschlag "Freie E-Lastenräder für den südlichen Breisgau" die Förderung der Nachhaltigen Mobilität im Ländlichen Raum, indem sie maßvoll PKW-Stellplätze abbaut und durch attraktive E-Lastenrad-Leihangebote inkl. Lastenrad-Abstellanlagen ersetzt. Die Beratung erfolgt für die Detail-Planung sowie Organisation und Vorbereitung der Projektdurchführung.
Parents for Futur Bad Krozingen unterstützt das Engagement der Jugend für den Klimaschutz mit unterschiedlichen Aktionen. Um die nachhaltige Mobilität zu fördern, setzt sich die Gruppe für die Anschaffung eines freien Lastenrads ein und schafft damit eine neue nachhaltige Mobilitätsalternative für Einkaufs- und Transportwege, die es bisher in Bad Krozingen nicht gibt. Ähnlich wie beim Carsharing, aber kostenfrei, können sich Bürger*innen ein Lastenrad für einen halben oder ganzen Tag reservieren. Dies verbessert zum einen die Teilhabe von Menschen ohne Führerschein oder finanziellen Mittel, zum anderen fördert es die umweltfreundliche Mobilität. Das Konzept zur Einführung eines Lastenrads wurde mit Hilfe des ADFCs entwickelt.
In Hechingen entsteht ein großes Freizeit- und Begegnungsgelände für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen. Diese haben altersspezifische Wünsche, nutzen gemeinschaftlich frei zugängliche, attraktive Flächen zum Sporttreiben, zur sozialen und kulturellen Interaktion sowie zum zwangslosen, konfliktfreien Aufenthalt als wichtigste Zielsetzung des Vorhabens. Es wird einen flexibel nutzbaren Veranstaltungsbereich mit einer kleiner Bühne und verschiedene Aufenthaltsmöglichkeiten geben. Der Gutschein wird zur konzeptionellen Entwicklung von generations- und zielgruppenübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten in Form eines Beteiligungsprozesses genutzt.
Ziel des Vereins ist es, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und Brücken zwischen den Generationen zu bauen. Monatlich wird ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen organisiert. Die Initiative engagiert sich seit fast 20 Jahren in Bad Dürrheim, aber die Akteure werden älter und vorhandene Strukturen kommen langsam an ihre Grenzen. Der Beratungsgutschein wird zur Analyse, Diskussion und Weiterentwicklung des Generationentreffs in einem Workshop eingesetzt.
Die Bildungsgruppe von "Engagiert zusammenleben in Dielheim" möchten die Zugänge zu Bildung von Menschen jeden Alters ermöglichen. Dabei ist ihnen der zwischenmenschliche Kontakt ein zentrales Element. Mit einem Trainingstool können zwischenmenschliche Interaktionen gefördert werden, insbesondere interkulturelle Kommunikation, aktives Zuhören, Teamentwicklung u.a. Diese Tools kommen bei Gemeindefesten zum Einsatz und werden durch eine pädagogische Fachkraft begleitet. Zudem werden die Tools gemeinnützigen Vereinen zur Verfügung gestellt.
In Waldshut entsteht mithilfe der Initiative ein Co-Working Space, um digitales Arbeiten mit kostenfreiem Zugang zu ermöglichen. Dieser wird im Haus der Diözesanstelle Waldshut ins Leben gerufen und bietet das Angebot somit durch eine öffentliche Stelle für eine breite Bevölkerung an. Die Beratung erfolgt zur Konzeptentwicklung und Implementierung des sogenanntes FRIDO Space und zum Beteiligungsprozess.
Der KreislandFrauenverband Reutlingen e.V. ist der größte Frauenverband im Landkreis Reutlingen. Mit dem Veranstaltungsangebot „Frischer Wind“ in Zwiefalten richtet sich der Verband an seine Ortsvorsitzende und deren Stellvertreterinnen. Die Teilnehmerinnen eignen sich im zweitägigen Seminar neues Handwerkszeug an, mit dem sie gezielt Kontakte zu bisher nicht beteiligten Frauen im ländlichen Raum aufbauen und festigen können. Ein Engagement bisher nicht aktiver Frauen ist das Ziel. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten wie zum Beispiel die Raummiete finanziert, die durch die Veranstaltung anfallen.
Der Jugendtreff Hardt ist eine sozialraumorientierte Einrichtung in einem Wohngebiet, in dem viele sozial-schwache Bewohner*innen leben. Er ist eine wichtige außerschulische Anlaufstelle für die Fragen und Sorgen der Kinder und Jugendliche, aber auch für Angebote wie Hausaufgabenbetreuung, Ferienprogramm und Themenwochen.
Viele Kinder und Jugendliche kennen regionale und saisonale Früchte nicht. Ziel des Projektes ist es daher ein Verständnis für regionale und nachhaltige Ernährung zu schaffen und dabei zu lernen, wo das Essen her kommt und wie es verarbeitet werden kann.
Die Initiative initiiert in Ulm einen Fuß- und Radentscheid. Die Bürger*innen entscheiden, ob sie der Verbesserung der Infrastruktur für Fahrradfahrende und Fußgänger*innen mehr Gewicht geben wollen. Eine solche Neuausrichtung führt zu einem sicheren Verkehr für alle Verkehrsteilnehmenden und zu einem signifikanten Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Ulm. Eine fundierte professionelle juristische Beratung, die sicherstellen kann, dass eine Beteiligung der Bürger*innen wirksam stattfinden kann, wird unterstützt.
Die Initiative Fuß- und Radentscheid Ulm hat sich zum Ziel gesetzt die Verkehrsplanung und -wende aktiv mitzugestalten, um die Verkehrssituation für Fußgänger*innen und Fahrradfahrende zu verbessern.
Die Initiative plant einen Fuß- und Radentscheid Ulm durchführen, damit Bürger*innen entscheiden können, ob sie einer Verbesserung der Infrastruktur für Fahrradfahrende und Fußgänger*innen zustimmen.
Die neue gegründete Ortsgruppe des Vereins „FUSS“ setzt sich in Remseck und der Umgebung für den Fußverkehr vor Ort ein. Die Gruppe unterstützt dabei auch das Vorhaben der Landesregierung, eine neue „Gehkultur" zu entwickeln und eine selbstbestimmte Mobilität vor Ort auch für ältere Menschen oder Kinder zu ermöglichen. Der Verein führt verschiedene Aktivitäten zum Thema wie Vor-Ort-Begehungen an Gefahrenstellen („FußverkehrsChecks“) durch, wobei auch Lösungsvorschläge der Bürger für die Verwaltung festgehalten werden. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit der „FußverkehrsChecks“ anfallen.
Ziel des Projektes ist es, einen Raum in der Innenstadtlage für Kooperationen und Angebote rund um das Thema bewusste Lebensmittelversorgung und Ernährungssouveränität zu gründen. G-Wertstatt steht für Gaumengenuss, Gemeinschaft, Gemeinwohl, Gesellschaftswandel. Beratung für folgende Themen: Akquise, Organisationsstrukturen, Rechtsformen und Öffentlichkeitsarbeit.
Das Projektziel ist die Schaffung eines Gemeinschaftsgartens mit verschiedenen Zielen und Inhalten: Anbau und Verarbeitung von Gemüse und Kräutern, um Begegnung zu fördern mit Jung und Alt, in der Nachbarschaft, mit Migranten und Geflüchteten, mit Bewohnern aus der Stadt (Umkehr der Landflucht). Beratung zu Projektplanung zu rechtlichen Fragen hierzu.
Das Projektteam setzt einen Garten des Friedens an, der in partizipativer Weise mit lokalen Akteuren und Bürger*innen gestaltet wird und in Deutschland lebende ukrainische Freiwillige beteiligt. Der Garten ist eine Symbol für Freundschaft und Dankbarkeit zwischen den Völkern und dient als inspirierender Ort der Begegnung. Die Beratung erhält die Initiative für den partizipativen Prozess und zum Bildungs-und Landschaftskonzept des Gartens.
Im Freiburger Stadtteil Vauban wird schon seit längerer Zeit engagiert über das Thema der gastronomischen Ausstattung vor Ort diskutiert. Es wurde bereits eine Umfrage durchgeführt, auf deren Basis nun ein Dialogprozess über die Zukunft der Gastronomie vor Ort durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Nachbarschaftsgespräche wird auch die Quartiersarbeit in den Prozess involviert. Verschiedene Maßnahmen der Ansprache und Beteiligung werden angewendet: Von der Informationskampagne, die vorgeschaltet zu den Nachbarschaftsgesprächen im Stadtteilmagazin veröffentlicht wird, bis zur aufsuchenden Beteiligung per Fahrradanhänger. Möglichst viele Menschen im Vauban sollen damit in den Prozess eingebunden werden und ihre Perspektiven einfließen.
Zentrales Anliegen des Arbeitskreises ist es, Unterstützungsangebote für alle Generationen zu organisieren (z.B. Babysittern, Rasenmähen, Hilfe bei Besorgungen usw.). Diese Dienste ergänzen bestehende Angebote der organisierten Nachbarschaftshilfe der Diakoniestation Loßburg. Ein weiteres Ziel war die Gründung eines Zeitbankmodels zu Stärkung der Dorfgemeinschaft geplant. Der Arbeitskreis erhält die Prozessberatung zur Einrichtung, Etablierung und Vernetzung des Zeitbankes.
Zentrales Anliegen des Arbeitskreises ist es, Unterstützungsangebote für alle Generationen zu organisieren (z. B. Babysitting, Rasenmähen, Hilfe bei Besorgungen usw.). Diese Dienste ergänzen bestehende Angebote der organisierten Nachbarschaftshilfe der Diakoniestation Loßburg. Zeitnah ist die Gründung eines Zeitbankmodels zu Stärkung der Dorfgemeinschaft geplant. Prozessberatung zur Einrichtung, Etablierung und Vernetzung der Zeitbank.
Mit dem Projekt „Älter und selbstbestimmt - Pflege neu denken in Aspach"
sollen auf Grundlage eines moderierten Prozesses mit den Bürger*innen
Empfehlungen für ein ganzheitliches Konzept eines altengerechten Lebens in
der Gemeinde erarbeitet werden. Dies umfasst sowohl die Erhebung der
Bedarfe hinsichtlich der baulichen Infrastruktur, als auch Aspekte der
pflegerischen Versorgung und und sozialen Infrastruktur.
Die Ergebnisse sollen unter anderem Entscheidungsgrundlage für anstehende
bauliche und verkehrliche Entwicklungen in der Gemeinde sein.
Betrachtet man die Gemeinde Aspach als „Mehrgenerationenhaus", sollen alle
Gesellschaftsgruppen zufrieden, sicher, gut versorgt, eigenverantwortlich und
selbstbestimmt in der Gemeinde leben und wohnen können. Teilhabe am
öffentlichen Leben sowie Barrierefreiheit stehen hierbei auch im Vordergrund.
Mit diesem Projekt soll ein Grundstein für die weitere Entwicklung hin zu einer
einer generationengerechten Gemeinde, gelegt werden.
Bad Boll ist Pionier-Kommune im Landkreis Göppingen, um neue Strategien der Quartiersentwicklung gemeinsam zu erproben. Es wird angestrebt, den sozialen Lebensraum zu stärken und die Lebensqualität sowie die Teilhabe der Bürger zu fördern. Ausgangspunkt für das Quartiersprojekt ist der genossenschaftlich organisierte Dorfladen, der zum Quartiersmittelpunkt erweitert wird. Unter Einbeziehung aller Akteure wir eine Entwicklung angeregt, bei der Möglichkeiten erarbeitet werden, die ein alters- und generationengerechtes Lebensumfeld fördern. Um die Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzubeziehen, befasst sich der Bürgerrat mit der Frage: "Was braucht es für ein gutes Leben für Jung und Alt in Bad Boll?". Es entwickeln sich Projektideen, die mit Mitwirkung der Bürgern umgesetzt werden. Der Dialog von Kommune, Bürgerschaft und Verwaltung, professionelle Koordination und gute Vernetzung der lokalen Akteure tragen zum Gelingen der Quartiersentwicklung bei.
Die Gemeinde Bad Ditzenbach und die als gemeinnützig anerkannte Seniorengemeinschaft Obere Fils e.V. (SEGOFILS) möchten gemeinsam mit der Gemeinde Bad Ditzenbach das Projekt "Sorgende Gemeinschaft im Täle" als Pilotprojekt starten. Die Gemeinde Bad Ditzenbach stellt dem Verein SEGOFILS e.V. das Bürgerhaus als Begegbungsstätte zur Verfügung. Zunächst soll die Begegnungsstätte einmal in der Woche geöffent sein: mit Mittagstisch, Kaffee und Kuchen und Informations-, Beratungs-, und Unterstützungs- sowie Unterhaltungsangeboten. Langfristig soll dieses "Starterangebot" um weitere Zielgruppen und Angebote erweitert werden. Außerdem sollen sukzessive auch die Nachbargemeinden (7 Tälesgemeinden) in das Projekt eingebunden werden, so dass die Begegnungsstätte interkommunal von unterschiedlichen Zielgruppen mit einem umfassenden und abwechslungsreichen inhaltlichen Programm genutzt und das Miteinander gestärkt werden kann.
Die Gemeinde Bad Schönborn plant den Aufbau einer bürgerschaftlichen
Nachbarschaftshilfe, die eine direkte Unterstützung zwischen Menschen ermöglicht und
Versorgungslücken im Alltag schließen soll. Das übergeordnete Ziel besteht darin,
Senior*innen und anderen hilfebedürftigen Personen dabei zu helfen, möglichst lange
in ihrem eigenen Wohnumfeld bleiben zu können. Das Angebot der
Nachbarschaftshilfe soll als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu gewerblichen
Anbietern verstanden werden. Zudem soll es die Chance eröffnen Menschen
verschiedener Generationen, Kulturen und Ortsteile zusammenzubringen und das
WIR-Gefühl in Bad Schönborn zu stärken.
Bürgerschaftliches Engagement und ein vielfältiges, aktives und funktionierendes Vereinsleben sind eine wesentliche Grundlage, um in der Gemeinde Beimerstetten nachhaltige Strukturen für das Gemeinwohl aufzubauen. Dies zeigt sich u.a. im ehrenamtlichen Engagement für den im Jahr 2018 gegründeten Verein Nachbarschaftshilfe e.V.. Dieser hat sich die Alten- und Jugendhilfe, die Unterstützung im Alltag und die Förderung von Bildung und Erziehung zum Ziel gesetzt.
Beimerstetten steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. Die Gestaltung und Entwicklung der Ortsmitte, die Erschließung neuer Baugebiete (Wohnbebauung und Gewerbe), eine gesicherte Anbindung an den ÖPNV, der demographische Wandel, die Sicherung der Daseinsvorsorge und das Voranbringen von Klima- und Energiethemen stehen im Fokus. Diese Themen lassen sich nur gemeinsam mit der Bevölkerung und generationsübergreifend bewältigen. Mit einem umfassenden Beteiligungsprozess sollen Prioritäten (was ist der Bevölkerung wichtig?) herausgearbeitet, Ziele entwickelt und definiert werden. Konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung sollen das Ergebnis des Bürgerbeteiligungsprozesses sein.
Es ist überall spürbar, dass das Engagement von Bürger*innen für eine aktive Gemeinde in den letzten Jahren abgenommen hat. Das betrifft nicht nur die Vereine und bekannten Gruppierungen, sondern alle sozialen und generationsübergreifenden Bereiche. Woran liegt das? Einerseits an den demographischen und sozialen Veränderungen in der Gesellschaft, andererseits auch am Ort selbst: Etliche Begegnungsmöglichkeiten und Infrastrukturangebote gibt es nicht mehr. Hier setzt der "BERGER ZUKUNFTSDIALOG" an. Die Akteur*innen dieser Initiative wollen alle Bürger*innen motivieren, über die Situation in Berg nachzudenken, um das Interesse an ihrem Ort und am Miteinander wieder neu zu wecken. Dazu braucht es in der Konzeptphase viele Ideen und Anregungen, die Schritt für Schritt in konkrete Projekte münden und umgesetzt werden, z.B. ein Bürgertreff. Und dabei sollen die Anliegen aller (Senioren, Jugendliche, Vereine, Familien, Kirchen, Neubürger, Flüchtlinge) mit einfließen. Das wird ein spannender Prozess! Man kann sich eine Vielzahl von Ergebnissen vorstellen. Zusammen mit der Gemeinde und den bestehenden Gruppierungen wollen wir Visionen entwerfen, die unser Berg attraktiver und lebenswerter machen.
Mit dem Gemeinde-Projekt "Nachverdichtung - Eine Chance für Jung und Alt" wird eine qualitative Nachverdichtung von sehr dünn besiedelten EFH durch den Wohnungswechsel umzugswilliger Senioren in altersgerechte Wohnungen und den durch die Gemeinde koordinierten Nachzug junger Familien erreicht. Mit der Koordination durch die Gemeinde und einer geeigneten Vertragsgestaltung ("Kopplung") sollen Spekulationsgewinne ausgeschlossen und die Wohnraumentwicklung im Sinne der Gemeinde gesichert werden. Das Projekt bindet die Bürger mittels einer Kommunikationsstrategie und durch partizipative Prozesse ein. Das Projekt ist eingebunden in einen längerfristigen und integrativen Gemeindeentwicklungsprozess (GEK Binzen 2035), der seit 18 Monaten gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet wird und der bereits große Entwicklungspotenziale in vielen Handlungsfeldern (z.B. Energieversorgung, Wohnen, Lokales Gewerbe etc.) aufgezeigt hat und aus dem heraus Einzelprojekte entwickelt werden.
Die Gemeinde Bösingen steht, wie viele Gemeinden im ländlichen Raum, vor den Herausforderungen des demographischen Wandels. Die Gemeinde ist geprägt durch ein starkes ehrenamtliches Engagement der Bürger*innen und eine erfolgreiche, mittelständische Wirtschaft. Im Zusammenwirken mit den Vereinen, den Sozialgemeinschaften und den Vertreter*innen der beiden Kirchengemeinden strebt der Gemeinderat die Ausweitung der Bürgerbeteiligung und eine weitere Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements an. Ziel ist ein Ausbau der Seniorenbetreuung in der Gemeinde, um weitere Impulse für eine noch lebenswertere Gemeinde zu setzen und Angebote zu schaffen. Der Gemeindeprozess bietet darüber hinaus die Möglichkeit, neue Zielgruppen und Handlungsfelder zu erschließen.
Entsprechend dem Motto "Irslingen hat Zukunft - gut leben und wohnen im Alter" machen sich Ortschaftsrat und Kirchengemeinderat gemeinsam mit der Bürgerschaft auf den Weg, diese Vision in verschiedenen Maßnahmen umzusetzen. Die Quartiersimpulse für Irslingen fußen auf dem Grundgedanken der Mobilität. Sie gehört zu einem Grundbedürfnis des Menschseins und sollte im Alter weiterhin Kernstück des Daseins bilden. Menschen wollen von A nach B kommen, sei es räumlich gesehen, im eigenen Haus, im eigenen Ort, außerhalb des Ortes, sei es digital sozial oder geistig. Dies geschieht in Form von Projektangeboten zu den Themen: Wohnen, ist mehr, Bürger*innen fahren für Bürger*innen und digital mobil im Alter. Für die Koordination und Transparenz benötigt es eine Ansprechpersonen. Für Identifikation und Reflexion dient die Bürgerbefragung ab 18 Jahren. Generationsübergreifend, inklusiv und durch Bürgerbeteiligung aktivieren wir das ganze Dorf und generieren Gemeinschaft, Glück und Gesundheit.
Die Nachbarschaftsgespräche in Dornstadt waren als partizipatives Element in einen größeren Gesamtprozess, das nachhaltige Gemeindeentwicklungskonzept, eingebettet. Ziel des Prozesses war die Erarbeitung eines integrierten Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung für und in Dornstadt. Dieses sollte die globalen Herausforderungen bewusst mit einbeziehen.
Für diesen Prozess wurde eine Begleitgruppe eingerichtet, die den gesamten Prozess sowie den Teil der Nachbarschaftsgespräche unterstützte. Sie begleitete den Beteiligungsprozess kontinuierlich und bildete das „Scharnier“ zwischen der Bürgerschaft und der Kommune. Die Zusammensetzung der Begleitgruppe wurde so gewählt, dass unterschiedliche Expertisen zusammengebracht wurden. Sie gab sowohl der Gemeinde als auch der beratenden Institution Anregungen für die Konzeptentwicklung. Ebenso wurde sie im späteren Verlauf zu den erarbeiteten Ergebnissen um eine Rückmeldung gebeten. Die Mitglieder der Begleitgruppe hatten zudem die Funktion von Multiplikatoren.
Des Weiteren konnten übliche Beteiligungsmuster im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche durch das Anwenden der Zufallsauswahl aufgebrochen werden. Dabei wurden speziell jüngere Menschen, nämlich die 18-40 Jährigen, adressiert. Auch der zivilgesellschaftliche Partner, Initiative kikuna e.V. - Zukunft Nachhaltig Gestalten, war aufgrund seiner Expertise von Beginn an eingebunden. Zusammen formulierten die Kommune, die Initiative kikuna e.V. und die beratende Institution die zielgruppenspezifische Ansprache für die Bürger. Zudem hatte die Initiative kikuna e.V. eine zentrale und aktive Rolle bei der Durchführung und Moderation der einzelnen Nachbarschaftsgespräche und unterstützte die Kommune bei der Ergebnisdokumentation.
Das Projekt fördert Ausbau und Qualifizierung des sozialen Netzwerks der Gemeinde mit Stärkung des nachbarschaftlichen und intergenerativen Miteinanders, der Kooperation von kulturellen und sozialen Angeboten (z.B. Nachbarschaftshilfe, Vereine, Kirchen) mit Begegnungsstätte sowie der Einrichtung von niederschwelligen Begleitungs-/ Unterstützungsangeboten (wie Tagesbetreuung, Nachbarschafts-App). Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung der Zuhause lebenden Pflegebedürftigen und Angehörigen sowie die Organisation/ Koordination der Angebote und Hilfen (z.B. über neue Bürgergemeinschaft) sowie der Aufbau einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft in geteilter Verantwortung insbesondere die intensive Vorbereitung des "nachhaltigen Betriebs" (Wohnform mit zivilgesellschaftlicher Basis).
Mit dem Projekt "Gutes Älterwerden in Eschenbach" möchten wir die in der "Nachhaltigen Gemeindeentwicklungskonzeption Eschenbach 2035" gesetzten Zielvorgaben zum Themenkomplex: Älterwerden, Unterstützungsbedarf, Wohnen, Pflege und generationengerechtes Lebensumfeld konkretisieren. Gemeinsam mit der Bürgerschaft, dem Gemeinderat, der Verwaltung und Fachleuten soll eine ganzheitliche Konzeption erstellt werden, um die Lebens-, Wohn-, Unterstützungs- und Pflegesituation von Senioren und deren Angehörigen im Ort zu verbessern. Insbesondere stehen dabei folgende Bereiche im Fokus: Vorhandene Bedarfe; informeller Treffpunkt/ Begegnungsort an attraktivem Ort, sorgende Gemeinschaft durch ehrenamtliches Engagement, generationenübergreifende Begegnung (Alt und Jung gemeinsam), niederschwellige Informationsangebote für Fragen im Kontext von Pflege und Betreuung, lebenslanges Wohnen im Ort/ neue bzw. alternative Wohnformen, Betreuungsangebote und Pflegeangebote im Ort.
In der Seniorenwohnanlage Frittlingen (Fertigstellung Frühjahr 2020) soll eine vollständig selbstverwaltete Seniorenwohngemeinschaft für 11 Personen eingerichtet werden. Des Weiteren soll unabhängig davon eine Tagesbetreuung für Senioren eingerichtet werden. Beide Einrichtungen sollen zur Stärkung der dörflichen Strukturen in Frittlingen im Bezug auf "Wohnen und Leben im Alter in Frittlingen" beitragen. Erst durch die Seniorenwohnanlage wird es möglich sein, dass pflegebedürftige Frittlinger Senioren, die nicht mehr in ihrem eigenen zu Hause wohnen und leben können oder wollen, in ihrem Dorf bleiben können und nicht auf eine Einrichtung auswärts angewiesen sind. Somit können die Senioren weiter am gesellschaftlichen Leben im Dorf teilnehmen und teilhaben. Das Projekt soll den Begleitprozess bis zur Inbetriebnahme der Einrichtungen darstellen.
Der demografische und gesellschaftliche Wandel erfordert neue Wege und gemeinschaftliche Mitverantwortung in der Dorfgemeinschaft. Die Gemeinde Fronreute entwickelt in ihrem Ortsteil Fronhofen gemeinsam mit ihrer Bürgerschaft und sozialen, kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Partnern ein Zukunftskonzept, das diese Mitverantwortung und Verbundenheit fördert und die Dorfgemeinschaft aktiviert. Es geht um Treffpunkte für Jung und Alt, Wohnraum und Begegnungsangebote für alle Generationen, Angebote für Kinder und Jugendliche, um die Belebung nachbarschaftlicher Dienste, um neue Wohnformen für unterstützungs- und pflegebedürftige ältere Menschen, aber auch um Themen wie Nahversorgung, ökologische Nachhaltigkeit und Mobilität. Im Rahmen eines breiten Bürgerbeteiligungsprozess mit offenen Ergebnissen und viel Kreativität werden diese Themen mit Leben gefüllt. Eine lebendige, städtebauliche und räumliche Neukonzeption der Dorfmitte befördert, dass sich die Dorfgemeinschaft gemeinsam auf den Weg macht.
Das Quartiersprojekt "Zukunft in Gomaringen" hat zum Ziel, dass ältere Menschen sich in Gomaringen wohlfühlen, integriert sind und auch bei Unterstützungsbedarf gut versorgt sind. Damit dies gelingen kann und gleichzeitig Jung und Alt aktiv eingebunden sind, wird zur Situations- und Bedarfsermittlung eine anonyme Bürgerbefragung mit Sozialraumstudie durchgeführt. Im anschließenden Hauptteil des Projekts erarbeiten Bürger, soziales Netzwerk und die Gemeinde eine Seniorenkonzeption mit interessanten Beteiligungsmöglichkeiten. Als erste konkrete Maßnahmen sind im Gespräch ein Reparaturcafé, themenorientierte Treffen und Veranstaltungen, etwa mit der Volkshochschule vor Ort, Begegnungsstätten und eventuell die Reaktivierung eines historischen Backhauses. Aber auch weitere spannende Solidar- und Wohnprojekte werden aus dem Quartiersprozess erwartet. Der aktive Gomaringer Arbeitskreis "Leben im Alter" ist zivilgesellschaftlicher Partner.
In einem partizipativen, ergebnisoffenen Bürgerbeteiligungsprozess wird gemeinsam entwickelt wie die Nachbarschaft zukünftig im Quartier leben möchte. Zu Beginn des Prozesses erarbeitete eine Begleitgruppe aus Bürgern, wie die Menschen im Quartier am besten erreicht und beteiligt werden können.
Die Begleitgruppe setzte sich aus Vertretern aller Fraktionen aus dem Gemeinderat, Projektleitung der Gemeinde sowie aus Bürgern zusammen, die verschiedene Perspektiven für das Quartier einbringen können. Die Gemeinde Gottmadingen profitierte von den unterschiedlichen Blickwinkeln der Begleitgruppe unter anderem bei der Ansprache der Bürger, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie mit Blick auf die Beratung während des Beteiligungsprozess. Die Gruppe traf sich insgesamt fünf Mal und sie beteiligte sich an den öffentlichen Veranstaltungen. Entweder in einer aktiven Rolle oder als Teilnehmende.
Zu Beginn wurde festgelegt: die Beteiligungsformate sollen für alle offen sein und möglichst unterschiedliche Personen erreichen. Die Beteiligung soll im Quartier (auch im Freien) stattfinden. Als Auftakt wurde ein öffentlicher Spaziergang rund um die Eichendorffschule vor Ort gewählt. Neben Informationen zu Zielen, Leitplanken des Gemeinderates, Terminen ging es vor allem darum, ins Gespräch zu kommen und erste Anregungen zu sammeln. Was kann auf dem Schulgelände entstehen, wenn die Schule umzieht? Welche Funktion erfüllt das Gelände jetzt und was fehlt? Wo begegnen wir uns im Alltag? Wie möchten wir im Alter leben? Dies waren Fragen, mit denen sich die etwa 120 Teilnehmer beschäftigten. Insgesamt fanden fünf geführte Spaziergänge zu unterschiedlichen Stationen statt. Mehrere Begleitgruppenmitglieder aus dem Quartier begleiteten Stationen und konnten die Diskussion mit ihren Nachbarn moderieren. Eine Station wurde durch den Vorsitzenden des Kreisseniorenrates geleitet.
Die Ergebnisse des Spaziergangs und Bildeindrücke wurden in einer Dokumentation festgehalten, welche hier einzusehen ist: www.quartierfueralle.de.
Aufbauend auf den Ideen, die während der Spaziergänge gesammelt wurden, konnte eine Exkursion zu gemeinsam ausgewählten Best Practice Beispielen stattfinden. Die Exkursion diente dazu einen gemeinsamen Wissensstand zu erreichen und Inspiration mit nach Gottmadingen zu bringen. Nachbarn, ehrenamtlich Engagierte und hauptberuflich Mitwirkende kamen zu Aspekten wie Begegnungsorte, Trägerformen, Wohnformen sowie die persönlichen Wünsche für das Leben im Alter und im Quartier ins Gespräch. Auch über das Einwohnermelderegister konnten zufällig ausgewählte Bürger für die Teilnahme an der Exkursion gewonnen werden.
Einen ganzen Tag lang waren 50 Bürger gemeinsam mit einem Bus unterwegs und wurden vor Ort durch unterschiedliche Wohnformen geführt. Die Teilnehmer konnten vor Ort viele Fragen stellen und sich im „Exkursionsbuch“ wichtige Punkte notieren. Die Busfahrten zwischen den Stationen wurden zur Auswertung und Diskussion der neuen Erkenntnisse genutzt, so dass für die Weiterarbeit auch konkrete Ergebnisse vorliegen. Diese werden nun im Zuge der Förderung bei den Quartiersimpulsen weiter bearbeitet.
In der Gemeinde Gottmadingen wird eine neue Realschule gebaut und 2021 bezogen. Auf dem alten Schulgelände sollen Wohnen im Alter bzw. neue, generationenübergreifende Wohnformen sowie ein Begegnungsort entstehen. Die Bürger*innen werden bei der Entwicklung eingebunden.
Eine Bürgerwerkstatt bildet den Auftakt für die Quartiersimpulse. Während der Bauphase der neuen Schule wird auf dem Gelände der bisherigen Schule ein Quartierstreffpunkt in Form eines Open-Air-Cafés entstehen. Dort werden Anwohner*innen miteinander ins Gespräch kommen und die Möglichkeit haben sich auszutauschen. Ergänzend finden Informations- und Austauschveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen statt, zu welchen interessierte Bürger*innen eingeladen werden. Exkursionen zu Best-Practice-Beispielen bringen vertieftes Wissen nach Gottmadingen.
Die Gemeinde Graben-Neudorf wünscht sich — ebenso wie viele andere
Organisationen und Menschen in Graben-Neudorf, einen lebendigen Ort, an
dem ein geselliges Zusammenkommen möglich ist.
Wo Menschen ohne feste Zugehörigkeit zu einer Organisation, Religion oder
Kultur Raum haben, um sich auszutauschen oder auch um sich mit seinen
Talenten einzubringen zu können.
Ein klassischer Begegnungstreff, der auf Basis von Beteiligung gestaltet wird
und für Gemeinschaft, Veranstaltungen, Beratung und jedwede Form des
Engagements genutzt werden kann. Das Haus ist der Rahmen, um
engagierten Menschen die Möglichkeit zu geben, eigene Ideen mitzubringen
und das Haus mit immer mehr Facetten zu bereichern.
Auch Beratung soll in diesem Haus angesiedelt werden - eine ideale Immobilie
ist gefunden. Diese wird derzeit durch die Kommune käuflich erworben und
danach für dieses Vorhaben umgebaut.
Für dieses Vorhaben wurde eigens ein Trägerverein gegründet, der durch die
Kommune mit diesem Antrag unterstützt wird.
Mit der Bürgerkonzeption „Älter werden in Herbertingen“ ermittelt die Gemeinde Herbertingen die Bedarfe und Anforderungen an ein gutes Leben im Alter in der Gemeinde. Gleichzeitig regt das die Bevölkerung zum Nachdenken über ihre Lebenssituation im Alter an. So werden möglichst viele Menschen zum Mitmachen an den Projekten motiviert, die sich aus der Bürgerkonzeption ergeben. Im Anschluss an eine bereits erfolgte Umfrage unter den Bürger*innen ab 40 Jahren folgt die Reihe der auf den Ergebnissen der Umfrage basierenden Bürgertische. Diese Bürgertische sind offene Arbeitsgruppen, die sich an mehreren Abenden zu jeweils einem Überthema treffen und hierzu Ideen und Maßnahmen entwickeln und Impulse geben. Die Ergebnisse der Bürgertische fließen anschließend in die Bürgerkonzeption ein, die Maßnahmen daraus sollen dann durch eine aktivierte Bürgerschaft zusammen mit der Gemeinde Schritt für Schritt umgesetzt werden – hin zu einer sich (wieder) sorgenden Gemeinschaft!
Die Gemeinde Herdwangen-Schönach und der Nachbarschaftshilfeverein (NBHV) "Miteinander-Füreinander" und Gemeindebürger/innen bauen gemeinsam eine bürgergestützte ambulant betreute Wohngemeinschaft mit sozialem Netzwerk (Umfeld), geteilter Verantwortung sowie Betreuungsassistenz auf. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Integration von Mitbürger*innen mit Pflege- und Betreuungsbedarf und Demenzerkrankungen in die Wohnform, sowie des Gemeinschafts- und Gemeindelebens. Mit bürgerschaftlichen Engagement und Mitverantwortung werden Wohngemeinschaft und das soziales Netzwerk im Quartier gestärkt.
Beteiligung und bürgerschaftliches Engagement waren in den letzten zehn Jahren wesentliche Faktoren, wenn es darum ging, in Hermaringen nachhaltige Strukturen für das Gemeinwohl aufzubauen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Gründung der Bürgerenergiegenossenschaft. In einer Zukunftswerkstatt Anfang 2020 wurden die Folgen des demografischen Wandels, die Sicherung der Daseinsvorsorge, das Abwandern der jüngeren Generation und die Bedrohung von Natur und Umwelt als die wichtigsten Herausforderungen identifiziert. Allen ist bewusst, dass sich diese Aufgaben nur gemeinsam und generationsübergreifend bewältigt lassen. Mit dem umfassenden Beteiligungsprozess „Hermaringen fit für die Zukunft!“ sollen die zentralen Ziele entwickelt und die wichtigsten Stellschrauben identifiziert werden. Im Fokus stehen das Miteinander der Generationen, die medizinische Versorgung und Lebensqualität der alten Menschen. Konkrete Maßnahmen und deren Umsetzung sollen das Ergebnis sein.
Mit "Wir in Hirschberg" startet die Gemeinde Hirschberg mit sieben zivilgesellschaftlichen Partnern einen zweijährigen Prozess zu einem "Mehr an Miteinander" in der Zukunft. Ausgangslage war der 1. Sozialbericht 2019 des Familienbüros. Um für die soziale Ungleichheit in verschiedenen Generationen und im Gemeinwesen Lösungsansätze zu finden, wurde ein Prozess mit einer Zukunftswerkstatt vorgeschlagen. Jetzt werden in einem offenen Prozess Ideen entwickelt und die Umsetzung von Maßnahmen vorbereitet, die das generationsübergreifende Miteinander fördern, die Lebensqualität der älteren Menschen sichert und soziale Schieflagen beseitigt.
Ein verstärktes Engagement und eine bessere Vernetzung in der Hirschberger Bürgerschaft über alle Generationen wird angestrebt. Dies ist Grundlage, um notwendige Hilfen anbieten zu können. Die etablierte Kultur des Gebens und Nehmens macht es leicht Hilfe anzunehmen. Die Teilhabe von älteren Bürgern, Familien und Jugendlichen im Gemeinwesen wird verbessert.
Das Projekt "WIR! Für mehr Lebensqualität in Hohenfels" stellt einen Prozess dar, welcher ganz am Ende zu fertigen Projektskizzen führt. Am Beginn steht die Ermittlung von Themen-/ Handlungsfeldern und der tatsächlichen Bedarfe in der gesamten Gemeinde:
- Was fehlt Jugendlichen, Familien und Senioren?
- Wie können wir möglichst lange vor Ort leben?
- Mit welchen Wohn- und Pflegeformen ist die Gemeinde langfristig am besten aufgestellt?
Nachdem die Themenblöcke identifiziert sind, wird gemeinsam mit Bürger*innen, zivilgesellschaftlichen Partnern und der Gemeinde (Verwaltung, Gemeinderat und Bürgermeister) an Lösungen gearbeitet. Die Projektskizzen zeigen letztlich, wie "WIR!" Stück für Stück die Lebensqualität in Hohenfels steigern können.
Mit dem Quartiersprojekt im Teilort Zogenweiler >DORFMITTE attrAKTIVer leben< startet die Gemeinde Horgenzell ein bewusst dezentrales Sozialraum-Vorhaben mit vielseitigen Beteiligungsmöglichkeiten in einer Art "Runderneuerung".
Sowohl ein Treffpunkt für Jung und Alt, eine Gemeinschaftswohnform, allgemein barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum und echt nachbarschaftliche Dienste sind zu aktivieren bzw. aufzubauen und mit Bürger-Angeboten zu füllen. Auch die gesamte Dorfmitte erhält darüber hinaus eine lebendige, städtebauliche und räumliche Neukonzeption.
Die Gemeinde Iggingen entwickelt mit Bürger*innen und dem sozialen Netzwerk ein Gemeinde- und Bürgerkonzept mit Themen der Begegnung, niederschwelligen Angeboten und Dienste, Unterstützung des Wohnens zu Haus und dessen Umfeld sowie neue Wohn- und Lebensformen für ältere bzw. pflege- und unterstützungsbedürftige Mitbürger*innen. Infrastrukturelle Zukunftsmaßnahmen und Begegnungsorte sowie Begegnungsangebote sind dazu zentrale Aspekte. Eine vorgelagerte Sozialraumstudie zeigt erste Erkenntnisse und Erwartungen auf.
Das Quartiersprojekt der Gemeinde Ingoldingen möchte mit der Gestaltung eines Kommunal- und Bürgerkonzepts nachhaltig die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger und der Teilorte stärken sowie soziale und zukunftsfähige Schwerpunkte setzen. Themen wie das Miteinander von Jung und Alt, die Versorgung Älterer und Pflegebedürftiger, Infrastruktur und Wohnsituation, Begegnung und soziales Netzwerk u.a. werden in Konzeption und Projekten aufgegriffen.
Die Gemeinde Inzigkofen mit ihren drei doch selbstbestimmten Ortsteilen ist ein markantes Beispiel des schnellen Wandels im ländlichen Raum. Während man deutliche Einwohnerzuwächse verzeichnet, müssen gleichzeitig enorme Infrastrukturverluste, aussterbende Ortskerne und der Rückgang gemeinschaftsfördernder Kontakte "hingenommen" werden. Damit die Kommune mit ihrem bunten Kultur- und Vereinsleben nicht nur "Wohn- und Schlafstätte" von Bürgern ist und auch Ältere und Unterstützungsbedürftige Teilhabe und Perspektive erfahren, soll eine "Neubelebung" gestartet werden.
>Soziales Netzwerk - Leben und Wohnen< setzt mit ihrem Quartiersprojekt auf ein Miteinander von Kommune und Teilorten, Diensten, Bürger-Treff und Vereinen. Spannende Projekte des nachbarschaftlichen Miteinanders, ein neues Bündnis von Kultur-Bildung-Soziales, die Gestaltung einer Strategie für barrierefreien, bezahlbaren Wohnraum sowie eine Konzeption mit neuen Wohnformen versprechen eine interessante Bürgerbeteiligung.
In der Quartiersarbeit wird die Lebenssituation älterer Menschen und deren Bedürfnisse analysiert, Versorgungslücken werden ersichtlich. Mit Bürgern sollen entsprechende Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Der groß angelegte Prozess zur Entwicklung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts "Gutes Älterwerden in Karlsbad" ist in zwei aufeinanderfolgende Teilprozesse unterteilt. Jetzt steht Teilprozess II an. Basierend auf der vorangegangenen Haushaltsbefragung (Bedarfserhebung, Teilprozess I) umfasst dieser den bürgerschaftlichen Prozess zur Konzeptentwicklung. Bürgerinnen und Bürger sollen dabei bei der Zielsetzung und bei konkreten Maßnahmen und Projekten aktiviert werden. Es geht darum, selbstlaufende Strukturen ins Leben zu rufen. In diesem Zusammenhang soll auch die seit ca. 20 Jahren bestehende Bürgerbeteiligung neu aufgestellt werden, auch um Doppelstrukturen zu vermeiden. Beteiligte: Externe Berater (SPES/AGP), Agendarat, Seniorenbeirat, Zivilgesellschaft.
"Das Einzige, das uns helfen kann, ist das WIR" - Deshalb will die Gemeinde Kirchentellinsfurt (5.600 EW, Kreis Tübingen) im Ort ein Generationennetzwerk (GN) aufbauen. Unsere Einwohnerschaft verändert sich in vielerlei Hinsicht. Es gibt zunehmend ältere und immer weniger junge Menschen. In immer mehr Familien leben die verschiedenen Generationen nicht mehr am Ort. Die soziale Schere öffnet sich - nicht alle Menschen können sich die Unterstützung, die sie brauchen, einfach "kaufen". Unser Dorf soll trotz dieses Wandels auch in Zukunft ein guter Lebensort für Alle bleiben. Die Gemeinde verfolgt mit dem GN zwei Ziele: die Themen Generationenbezug und Teilhabe in Kirchentellinsfurt zu stärken und die Einwohnerschaft für die Herausforderungen des demographischen Wandels zu sensibilisieren. Im Schulterschluss mit Vereinen, Institutionen und Bürger*innen möchte die Gemeinde neue Unterstützungs- und Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen schaffen. Es geht darum, neue und nachhaltige Strukturen für bürgerschaftliches Engagement, ein gutes gesellschaftliches Miteinander und eine "sorgende Gemeinschaft" im Dorf zu schaffen und Teilhabe für Alle zu ermöglichen.
Vorhaben:
Aufbau einer kommunalen, bedarfs- und ressourcenorientierten Altenhilfeplanung und -entwicklung auf der Basis von Bürgerbeteiligung, mit der Prämisse, Zusammenarbeit und Vernetzung zu fördern, als einem festen Bestandteil von Gemeindeentwicklung.
Ziele:
- Weiterentwicklung des bestehenden Netzwerks 60plus und der Seniorenarbeit in Königsbach-Stein
- Aufbau von Beteiligungsstrukturen, Fördern von Eigeninitiative und Engagement
- Förderung und Aufbau von Zusammenarbeit und Vernetzung
Im Rahmen des Projektprozesses "Quartiersimpulse" werden wir die notwendigen Strukturen schaffen und die Grundlagen für die Planung und die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit erarbeiten.
In Lauchringen entsteht ein neues Qaurtier – der „Riedpark“, in der geographischen Mitte der Gemeinde. Neben dem Bau von Eigentums- und Mietwohnungen entsteht ein Mehrgenerationenquartier. Damit ein solches neues Lebens- und Wohnquartier nachhaltig und dauerhaft in der Bevölkerung akzeptiert und angenommen wird, müssen Vorurteile und Barrieren zwischen den Generationen abgebaut werden. Nach unserer Vorstellungen müssen generationsübergreifende Maßnahmen und Aktionen ein zentrales Element der Quartiersarbeit sein. Diese fördern das Verständnis zwischen den Generationen und können zu einer neuen Qualität des Zusammenlebens führen. Als Projektpartner wird das vom Bund geförderte Mehrgenerationenhaus als Quartiersmanager zur Verfügung stehen. Das Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Hochrhein wird mitten im Quartier „Riespark“ neue Räume beziehen und in die Quartiersarbeit einsteigen.
Im Rahmen des Motto "Lichtenstein - eine Gemeinde für alle" wurde das Projekt "Unser Bürgertreff" in den Mittelpunkt gestellt. Vor dem Hintergrund der ansässigen Menschen mit Fluchthintergrund war es ein Ziel der dortigen Nachbarschaftsgespräche die unterschiedlichen Einwohner zusammenzuführen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Um die Bürgerschaft zu erreichen, wirkte der Arbeitskreis Asyl vor Ort als Multiplikatoren mit. So gelang es sonst eher beteiligungsferne Personen zu erreichen.
Jugendliche, Berufstätige, Senioren, Einheimische, Geflüchtete, Ehrenamtliche und Hauptamtliche konnten sich in den Workshopformaten vor Ort einbringen. Die Moderation schaffte hierbei eine Atmosphäre des Vertrauens und des respektvollen Miteinanders. Die erarbeiteten Ergebnisse fließen in die Weiterarbeit zur Nutzungs- und Belegungsplanung ein.
Es soll auf Grundlage der Ideen aller Mehrstetter mindesten ein Gebäude geplant werden, das den Bedarf an neuen Wohnformen in Mehrstetten passgenau abdeckt. Außerdem wird der gesamte Marktplatz als lebendige und lebenswerte Ortsmitte überplant werden. Hierzu dient die Durchführung einer Ideenwerkstatt, die mit verschiedenen Veranstaltungen allen gesellschaftlichen Gruppen die Möglichkeit bietet, sich mit Ideen und Meinungen am Prozess zu beteiligen und einzubringen. Die Bürger*innen müssen dabei nicht zum Rathaus kommen, sondern werden direkt bei ihren Hobbies oder im lebensnahen Umfeld, wie z.B. beim Altennachmittag oder im Kindergarten abgeholt. Mit den Ergebnissen möchte die Gemeinde ein einem weiteren Schritt einen Architekturwettbewerb zur Umsetzung ausloben, welcher wiederum durch bürgerschaftliche Partizipation geprägt sein soll.
In der Gemeinde Möglingen wurde im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche ein Integrationskonzept erarbeitet. Damit war das Ziel verbunden, die kulturelle Sensibilität und das Wissen voneinander zu fördern sowie die Beteiligung von Menschen mit internationalen Wurzeln zu verstärken. Die Gespräche wurden als Schritt hin zu einem gemeinschaftlichen Zusammenleben ohne Zugangsbarrieren gesehen.
Zunächst wurden lokale Einrichtungen und Vereine zu einem Treffen der Integrationswerkstatt eingeladen. Danach wurde Ehrenamtliche, Kommunalpolitiker und interessierte Bürger zu einem Austausch eingeladen. An beiden Veranstaltungen wurde das Format des Worl-Cafés gewählt und in diesem Kontext jeweils die gleichen Fragen an die Teilnehmer gestellt. Dieses Vorgehen wurde von der Gemeinde Möglingen so gewählt, um ein gemeinsames Verständnis von Integration und Teilhabe zu erreichen. Die Vorgehensweise, die Gruppen zu trennen, war aus Sicht der Gemeinde für den Erfolg des Projekts von großer Bedeutung, um den unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen zum Thema Integration und Teilhabe gerecht zu werden.
Nach den zunächst getrennten Gesprächen fand eine gemeinsame Integrationswerkstatt statt. Zu dieser wurden unter anderem lokale Einrichtungen, Vereine und interessierte Bürger eingeladen. Ziel dieser gemeinsamen Veranstaltung war es, beide Gruppen zusammenzubringen. Aufbauend auf der Arbeit der bereits stattgefundenen Treffen wurden an der gemeinsamen Integrationswerkstatt Handlungsfelder identifiziert und definiert. Hierbei hatten die Beteiligten die Möglichkeit sich einem Handlungsfeld zuzuordnen und dieses gemeinsam mit den Anwesenden genauer zu besprechen. So konnten konkrete "Handlungsschritte" festgehalten werden.
Die Ergebnisse wurden in der Folge in der Gemeindeverwaltung analysiert. Danach konnten sie in Gesprächen mit Schulen, dem Jugendzentrum und Fachkoordinatorin für die kommunalen Kindergärten ausformuliert und erweitert werden. Schließlich wurden die entsprechenden Handlungsempfehlungen im Zuge einer Abschlussveranstaltung vorgestellt und mit den Anwesenden diskutiert.
Im Rahmen einer weiteren Förderung von Gut Beraten wird dem Wunsch der Teilnehmer der Nachbarschaftsgespräche nachgegangen, einen Verein der Vielfalt zu gründen.
Eine Zukunftskonzeption inkl. Sozialraumstudie hat die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen schon 2014/2015 mit ihren Bürgern entworfen. Für den Ortsteil Mühlhausen soll jetzt im vorliegenden Quartiersprojekt eine Basis geschaffen werden, in welcher vor allem die Bürgerschaft selbst gefordert ist, wenn es um die Konzipierung und den Aufbau von gegenseitigen, nachbarschaftlichen Diensten, interessanten offenen Treff- und Begegnungsangeboten und der Einrichtung von pflegeentlastenden Tagesangeboten geht. Dringender Handlungsbedarf ist zudem auch deshalb gegeben, da außerdem zeitnah eine neue belebte Ortsmitte auf dem "Alten Sportplatz-Areal" mit Begegnungsstätte, Mehrgenerationenwohnen u.a. und einer im Gemeinwesen integrierten betreuten Wohngemeinschaft entsteht. Verstärktes Bürgerengagement und profunde Bündnispartner (z.B. Caritas, AK Senioren) sollen Projekte mit auf einen nachhaltigen Weg bringen.
In der Gemeinde Mühlingen zeigt sich seit Jahren der demografische Wandel mit unterschiedlichen Aspekten (z.B. Zunahme von Pflegebedürftigen und an Demenz erkrankten Menschen, Belastung von Angehörigen, Wegfall von Infrastrukturangeboten, wenige Arbeitsplätze vor Ort).
Dies führt zu den Fragen:
- Wie möchte ich im Alter bei Versorgungs- und Pflegebedarf leben?
- Welche Wohn- und Hilfsmöglichkeiten werden mir in Mühlingen geboten?
- Ist die Infrastruktur für ein Leben im Alter in der Gemeinde Mühlingen ausreichend?
Um das Leben und Wohnen in der Gemeinde Mühlingen zu stärken und ggf. Begegnungs-, Hilfsangebote und ein funktionierendes soziales Netzwerk auf- und auszubauen, hat sich die Gemeinde entschieden in einem Bürgerprozess ein individuelles und tragfähiges Zukunftskonzept unter Einbezug aller interessierten Bürger*innen zu erstellen und in weiteren Schritten umzusetzen.
Die demografische Entwicklung Mulfingens steht seit dem Gemeindeentwicklungsprozess im Fokus kommunalen Handelns. Einer der Handlungsschwerpunkte ist die Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders und der Ausbau der sozialen Infrastruktur.
Mit der Entwicklung des innovativen Wohnquartiers auf dem ortskernnahen Wertplatz bietet sich die Chance, in einem beteiligungsorientierten Prozess diese Ansätze noch stärker zu entwickeln, die soziale Infrastruktur auszubauen und bedarfsgerechte Angebote, wie z.B. Treffpunkte für alle Altersgruppen zu schaffen. Die planerische Voraussetzung schaffte der Gemeinderat mit dem Satzungsbeschluss vom 20.7.2022 zum Bebauungsplan "Wertplatz".
In Vernetzung mit dem örtlichen Verein "ProMu" Gemeinsam Zukunft Mulfingen Gestalten e.V. und weiteren vorhandenen Akteuren vor Ort, wie die Kirchengemeinden, die St. Josefspflege Mulfingen und interessierten Vereinen/Initiativen der Bürgerschaft wird der Prozess zur Entwicklung von Quartiersimpulsen angelegt und durch den Bürgermeister/Verwaltung gesteuert.
In einem moderierten Prozess wird ein Konzept zum Thema Leben im Alter in Niedereschach erstellt. Das Konzept umfasst den Kernort Niedereschach und die Teilgemeinden Fischbach, Kappel und Schabenhausen. Im Rahmen des Prozesses werden die Bürger*innen aller Ortschaften eingeladen, sich an der Erstellung zu beteiligen. Dazu werden Veranstaltungen angeboten.
Die Gemeinde Niedereschach erhält im Rahmen dieses Projekts ein, zusammen mit der Bürgerschaft, erarbeitetes Konzept zur Versorgung ihrer älteren Bürger*innen.
Durch die vorgesehene breite Beteiligung werden derzeit ungenutzte Ressourcen aktiviert und die Akzeptanz wesentlich gesteigert. Die Beteiligung wird sich auf die nachgelagerten Umsetzungsschritte sicherlich sehr positiv auswirken, weitere Bürger*innen werden sich an den Folgeprozessen aktiv beteiligen.
"WIR" in Oberreichenbach als aktive Bürgerbeteiligungsplattform gestalten nachhaltige Lebensqualität durch Nähe in unserem Quartier indem wir unseren "Marktplatz Oberreichenbach" - als Projektidee von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Kommune gemeinsam entwickeln und mit Leben füllen. Mit dem Projekt soll eine Plattform geschaffen werden, bei der sich alle Akteure der Lebensqualität sowie die Bürger aktiv in das Gemeindeleben zur Stärkung der Gemeinde und der Gemeinschaft einbringen können. Neben einem tatsächlichen Marktplatz soll auch ein virtueller Marktplatz mit "Online-Plattform" entwickelt werden, die als ergänzendes Kommunikationsinstrument installiert werden soll. Gleichzeitig besteht die Chance, dass durch das neue Kommunikatiosinstrument, weitere und ganz andere Akteuere in das Netwzerk WIR in Oberreichenbach eingebunden werden und die Dienstleister eine neue regionale Verkaufsplattform erhalten.
In der Gemeinde Oberwolfach wurden unter dem Motto "vom ich zum wir" Gespräche zur Frage initiiert: Wie soll das Zusammenleben künftig aussehen? Das Ziel dabei war es, bisherige Aktivitäten und Engagement zu vernetzen und zusammenzuführen.
Hierfür wurde eine Begleitgruppe mit 15 Personen gegründet, die sich in extern moderierten Sitzungen zusammenfand. Auch Vertreter aus der Verwaltung waren vertreten. Ihre Aufgabe bestand vor allem im Aufsetzen des Prozesses, dem Stellen strategischer Weichen sowie in der Übernahme einer Multiplikatorenrolle in die Bevölkerung hinein.
In diesem Kontext fand eine Auftaktveranstaltung mit über 100 Personen statt. An diesem Tag konnten sich die Teilnehmenden untereinander austauschen und Zukunftspostkarten an die Gemeinde schreiben, aus denen im Nachhinein ein Zukunftsbild für Oberwolfach erarbeitet wurde. Im Nachgang des Auftakts wurden kleinere Veranstaltungen zu Themen abgehalten, die aus der Auftaktveranstaltung für das Zusammenleben in Oberwolfach ersichtlich wurden.
Auch die Vereine der Gemeinde erhielten mit dem Abschluss der Nachbarschaftsgespräche vor Ort im Zuge der Zukunftskonferenz des Ehrenamts die Möglichkeit, Bedarfe und Anregungen für das künftige Bestehen des Ehrenamts vor Ort miteinander und mit dem Bürgermeister zu diskutieren.
Beim Öhninger Bürgerdialog 2017 hat sich gezeigt, dass in Öhingen großes Interesse sowie ein hoher Bedarf an einem Mehrgenerationen-Angebot besteht. Dabei wird zum einen an ein gemeinsames Wohnen gedacht, aber auch an ergänzende Nutzungen, welche für den gesamten Ort wirken sollen, wie zum Beispiel ein Quartiersplatz. 2019 identifizierte der Städtebauliche Rahmenplan für ein Mehrgenerationenprojekt eine geeignete Potenzialfläche in der Öhninger Ortsmitte. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Projekt unter Einbindung der Bevölkerung mit höchster Priorität anzugehen. Bevor das Projekt in die Entwicklung kommen kann, soll gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet werden, was genau Öhningen braucht, welche Art des Mehrgenerationenwohnens zu Öhningen passt, wer dort tatsächlich einziehen würde, wie die Fläche genutzt und gestaltet sein könnte und welche Wirkungen ins Quartier angestrebt werden.
Die Gemeinde Ortenberg und dem Sozialen Netzwerk Ortenberg (SoNO) ist es wichtig die Ideen, Wünsche und Vorschläge der hier lebenden Menschen in die Planung der neuen Dorfmitte einfließen zu lassen und die Bürgerschaft an der Entscheidung über die Neugestaltung zu beteiligen. Das Projekt „Neue Mitte Ortenberg“ hat zum Ziel Menschen jeden Alters – vor allem aber den älteren Generationen – in Ortenberg ein gutes Leben mit Teilhabe an einer lebendigen Dorfgemeinschaft zu ermöglichen. Die Bürgerbeteiligung stellt eine breite Planungsbasis und hohe Akzeptanz sicher. Chancen und Defizite werden frühzeitig durch die kooperativen Prozesse mit Bürger*innen und Akteuren erkannt und Lösungsvorschläge können gemeinsam erarbeitet werden. Das Quartier umfasst den bereich der Ortsmitte zwischen Kirche, Rathaus und Seniorenzentrum „Sternenmatt“. Mit dem Projekt „Neue Mitte Ortenberg“ kann eine beispielhafte Erfahrung gelingender Bürgerbeteiligung bei kommunal bedeutsamen Bauprojekten ermöglicht werden.
Nach § 1 GemO soll die Gemeinde in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung das
gemeinsame Wohl ihrer Einwohner*innen fördern.
In Zeiten multipler Krisen, in welchen die Fähigkeit und der Sinn des demokratischen
Systems angezweifelt werden, bedarf es neuen Strukturen,
die das Miteinander und die Vielfalt unserer Gesellschaft positiv wahrnehmen und
den Diskurs und die Dialogfähigkeit stärken können. Dies begreift die Gemeinde Ostelsheim
als politische Aufgabe der Gemeinde.
Deswegen hat sich die Gemeinde vorgenommen, ein neues Format beziehungsweise eine
neue Plattform auf gemeinnütziger Basis zu etablieren, die all denjenigen, die in der
Gemeinde leben, eine neue Perspektive zur Vernetzung und somit einen Eingang zum
bürgerschaftlichen Engagement bieten soll. Zielgruppe und Mittelpunkt dieses
Angebots sind stets die Bürger*innen.
Das Projekt trägt den vorläufigen Arbeitstitel Dorf-Café.
Im Jahr 2019 sollte in Ottenbach ein kleines Pflegeheim entstehen. Kurz vor Realisierung der Planungen ist jedoch der Träger des Vorhabens abgesprungen. Damit konnte das Projekt nicht umgesetzt werden. Für die Gemeinde war das ein herber Rückschlag, zumal die Folgen des demografischen Wandels gerade für eine kleine Gemeinde sehr herausfordernd sind. Im November 2021 haben der Gemeinderat und die Verwaltung einen erneuten Vorstoß unternommen, um das Thema Älterwerden in Ottenbach neu und selbst anzugehen. In einem ersten moderierten Kreativ-Workshop ist die Idee für das Projekt "Gut Älterwerden in Ottenbach" entstanden: gemeinsam mit der Bürgerschaft, dem Gemeinderat, der Verwaltung und Fachleuten soll eine ganzheitliche Konzeption erstellt und in Umsetzung gebracht werden, um die Lebens-, Teilhabe- Wohn-, Unterstützungs- und Pflegesituation von älteren Menschen und deren Angehörigen im Ort zu verbessern.
Unter dem Projekttitel "Pfaffenweiler 2030 - Eine Gemeinde mit Lebensqualität für alle Generationen" soll ein umfassender Beteiligungsprozess zur Frage der Zukunftsentwicklung durchgeführt werden. Der demographische Wandel macht auch vor den Toren Pfaffenweilers keinen Halt. Im Beteiligungsprozess werden gemeinsam mit Akteuren der Bürgerschaft, des Gemeinderats und sonstigen Interessenvertretern künftig relevante Wohn- und Lebensformen im Alter, nachhaltige Strukturen im sozialen Miteinander und Fragen der Generationengerechtigkeit thematisiert. Dabei setzt das Projekt neben einer Analyse der grundlegenden Wünsche, Vorstellungen und Bedarfe der Einwohner auf deren Expertise in ihrer Rolle als Experten, die im Kontext von Beteiligungs-Workshops und Planungsrunden eingebracht und diskutiert wird. So wird im Zuge des Projekts eine gemeinsame Vision und konkrete Maßnahme für ein gutes Zusammenleben aller Generationen in der Gemeinde Pfaffenweiler erarbeitet.
Mit Pfinztal 2035 hat die Gemeinde ein strategisches Konzept in Zusammenarbeit mit Bürgerschaft und Politik für die Zukunft erstellt. Nun möchten die Akteure gemeinsam mit noch größerer Einbeziehung der Bürgerschaft die Visionen und Zielsetzungen des Konzepts Realität werden lassen. Mit Prozessbegleitung durch SPES sollen in allen Ortsteilen Bürgerbeteiligungsprozesse "LQN" durchgeführt werden. Ziel ist es, eine breite Basis der Bürgerschaft zu aktivieren, um generationenübergreifende, nachhaltige Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität umzusetzen. Schwerpunktthemen werden u.a. Unterstützung und Betreuung, Mobilität, Grundversorgung sowie innovative Wohn- und Pflegeformen sein. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf den älteren Menschen, sondern auf der Gesamtgesellschaft: Kinder, Jugendliche, Familien, Betriebe, Senioren, soziale und Bildungs-Einrichtungen, Kirchen, Politik und Verwaltung sollen teilhaben am Prozess. Ihre Ideen, ihr Wissen und ihr Engagement von Anfang an einbringen.
Die Evaluation des Leitbilds "Entwicklungsstrategie Rainau 2030" zeigt einen hohen Umsetzungsgrad. Neue Herausforderungen der Gemeindeentwicklung werden jedoch auch in Rainau spürbar, weshalb das Leitbild fortgeschrieben werden soll. Der Fokus dabei liegt auf einem "Dorfgemeinschaft(en)- Gedanken", der erstens die Einbindung der Einwohner*innen und zweitens die Notwendigkeit von Entwicklungsstrategien für die fünf Ortsteile (= Quartiere) und deren Zusammenführung hervorhebt. Einzuordnen ist der Gedanke vor dem Hintergrund, dass aktuelle Herausforderungen, wie zum Beispiel der demografische Wandel, kleinteilig und vor Ort mit ko-kreativen Methoden angegangen werden müssen, um sie zu lösen. Das neue Leitbild sucht dabei konkrete Antworten (u.a. Ableitung und Initiierung von Schlüsselprojekten) auf Fragen zur Sicherung des Ehrenamts und der bedarfs- und generationengerechten Versorgung in den Quartieren. Das Kredo dabei ist „was können wir im Ortsteil selbst organisieren und welche Unterstützung brauchen wir dazu?". Dazu nutzt das Projekt kompakte, jedoch kreative Beteiligungsmethoden (Zukunftswerkstätte auf Ortsteilebene, Projektgruppe, Workshops), produktiv dort, wo sie gebraucht werden.
Mit Hilfe der verschiedenen Formate der Nachbarschaftsgespräche wollte die Gemeinde Salach möglichst viele Anwohner erreichen, um eine Bedarfsanalyse in Salach zu erstellen. Hieraus sollten nachhaltige Maßnahmen erarbeitet werden, um das Enagagement zur Teilhabe vor Ort und des sozialen Miteinanders aller Kulturen und Generationen zu erhöhen. Die gewonnen Erkenntnisse sollten auf andere Ortsteile von Salach übertragen und auf eine Vernetzung aller Bewohner hinwirken.
Aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown musste das Konzept der Situation angepasst werden. Dementsprechend wurde die aktive Bürgerbeteiligung nicht in dem Umfang durchgeführt wie ursprünglich geplant. Dennoch konnten Gespräche an öffentlichen Plätzen stattfinden: Die Bewohner waren gegenüber den Aktivitäten aufgeschlossen.
Die geplanten Fragebögen, die von der Projektgruppe erstellt wurden, konnten an alle 3500 Haushalte verschickt werden. Hierin wurden Meinungen zur aktuellen Situation und den Bedürfnissen im Quartier abgefragt. Die weiteren Arbeitsgruppentreffen wurden online abgehalten. Es wurde darin an den Themen der Fragebögen weitergearbeitet.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.
Die IBA-Projektkommune Salach baut ein großes Gemeinschaftszentrum. Die Zeit bis zur Eröffnung im Jahr 2027 wird genutzt in Form von 12 circa dreistündigen Pop-Up Gemeinschaftszentren. Jedes Pop-Up wird bespielt von zwei benachbarten örtlichen Institutionen mit ihren speziellen Zielgruppen. Die Anwesenden werden nach ihren Programm-Ideen für das Gemeinschaftszentrum befragt und eingeladen, die Befragungsergebnisse in anschließenden Kochgruppen weiterzuentwickeln und zu dokumentieren. In eigenen realen und /oder in virtuellen Adventsfenstern im Salacher Boten und auf nebenan.de Salach präsentieren sich diese Pop-Up Gemeinschaftszentren von Mai 2024 bis April 2026 erneut mit ihren Gemeinschaftszentrum-Programm-Ideen. So entstehen in den 24 Monaten der Förderung verschiedene dezentrale Gemeinschaftszentren als Vorgeschmack auf 2027.
Salach verwirklicht mt dem kommunalen Großprojekt "Quartier Mühlkanal" eine Jahrhundertchance. Das "Quartier Mühlkanal" besteht 1. aus dem "Krautländer-Areal" mit seinen 3 denkmalgeschützten und stark renovierungsbedürftigen Fabrikgebäuden uns seiner großen freien Baufläche. Parallel zur baulichen Entwicklung unter dem Dach von IBA StadtRegion Stuttgart 2027 arbeitet die Salacher Verwaltung zusammen mit der Stiftung Haus Lindenhof, der Bürgerschaft und ehrenamtlichen Gruppen an der sozialen Entwicklung hin zu einer "Sorgenden Gemeinschaft", um die gesamte Gemeinde für die kommenden 40 Jahre "demografiefest" zu machen. Eine zu gründende "Bürgersozialgenossenschaft eG", oder ein "Quartiersverein e.V." werden hierbei eine Schlüsselrolle spielen, um die haupt- und ehrenamtliche Arbeit bestmöglich zu koordinieren.
Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplans fand ein intensiver Gemeindeentwicklungsprozess statt, bei dem alle Bürger*innen mit einbezogen waren und dabei eine intensive Kinder- und Jugendbeteiligung (Gemeindedektive und Jugendforum) statt gefunden hat. Die Ergebnisse des Prozesses, die in drei Bürgerforen gemeinsam erarbeitet worden sind, liegen in einer Prioritätenliste vor, die vom Gemeinderat nach dem dritten Bürgerforum verabschiedet wurde. Gemeinsam mit der gesamten Bevölkerung wollen wir auf Basis der Ergebnisse des Gemeindeentwicklungskonzeptes konkrete Handlungsschritte für die generationen- und altersgerechte Gestaltung der Gemeinde Sexau erarbeiten und soweit wie möglich umsetzen. Dabei werden wir die Verfahren Kinder- und Jugendbeteiligung erproben und ggf. "korrigieren" und eine Form des Generationendialogs entwickeln.
Mit den Nachbarschaftsgesprächen wurden folgende Ziele verfolgt:
- Zusammenleben aktiv gestalten
- Eröffnungsmanagement der neuen Unterkunft für Geflüchtete
- Transparenz durch offene Prozesse
- Implementierung einer Teilhabekultur in Tamm
- Verbesserte Vernetzung zwischen dem Ehrenamt und dem Hauptamt
- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Gemeindeverwaltung
- Schärfung der Identität Tamms
Für die Gewinnung der Teilnehmer wurden unter anderem 250 Bürgerinnen und Bürger per Stichprobe ausgewählt. Den Anfang des Projekts stellte das Treffen der zufällig ausgewählten Teilnehmer dar. Dieses Treffen hatte eine Zustandsanalyse und die Formulierung von offenen Fragen seitens der Teilnehmer zum Ziel. Konkret ging es darum festzustellen, was gut läuft und was verbesserungswürdig ist.
Darauf aufbauend formulierte eine Gruppe, die sich für die folgenden Nachbarschaftsgespräche zusammenfand, konkrete Handlungsempfehlungen und entwickelte eine Eröffnungsstrategie für die neue Unterkunft.
Leitfragen waren dabei: Was benötigen die Ankommenden? Was benötigen die Nachbarn? Welche Probleme wird es vielleicht geben?
Anschließend an diese Veranstaltung wurden die Ergebnisse in einem öffentlichen Dialog vorgestellt und die Handlungsempfehlungen mit Legitimierung des Gemeinderats umgesetzt. Als vorläufiger Abschluss des Prozesses fand eine Eröffnungsfeier der neuen Unterkunft auf Basis der Ideen der Nachbarschftsgespräche statt.

Die Gemeinde Tannheim gestaltet gemeinsam mit ihrer Bürgerschaft und sozialen sowie kulturellen Partnern ein Zukunftskonzept für Ältere, Jung und Alt, Pflegebedürftige und an Demenz Erkrankte. Im Quartier Tannheim wird vorab eine Sozialraumstudie des Lebens und Wohnens der Bürger und ihrer Erwartungen durchgeführt und reflektiert. Auf dieser Grundlage soll ein breiter Bürgerbeteiligungsprozess aufbauen mit einem nachhaltigen Zukunftskonzept, welches von den Bürgern selbst, den Gruppen im sozialen Netzwerk und der Gemeinde von Beginn an mit offenen Ergebnissen und viel Kreativität gestaltet werden kann. Neue Formen der Beteiligung wie der Einbezug einer Bürgerinteressengemeinschaft, dem Aushang von einem Briefkasten für Anregungen u.a. kommen im Prozess zum Tragen, wenn zentrale Themen wie beispielsweise Begegnung, niederschwellige Betreuungsangebote, vor allem alternatives Wohnen und die Schaffung einer zeitgemäßen "Pflegeeinrichtung" vor Ort konzipiert und geplant wird.
In insgesamt neun einzelnen Gruppen haben überwiegend zufällig ausgewählte Bürger darüber diskutiert, was "miteinander. füreinander" für sie bedeutet. Stets dabei: der Bürgermeister. Die neun Gruppen waren: Senioren, Jugendliche und junge Erwachsene, Frauen, Gemeinde- und Ortschaftsräte, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Helferkreis für Flüchtlinge, Neubürger und Gewerbetreibende. Bis auf die Gruppen Menschen mit Behinderung, Helferkreis für Flüchtlinge sowie Gemeinde- und Ortschaftsräte wurden alle Teilnehmer per Zufallsauswahl angeschrieben.
In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse der Diskussionen in insgesamt acht Bürgerversammlungen - je Ortsteil eine Versammlung - skizziert. Schließlich wurden die Ergebnisse der neun Gruppen zusammengefasst und in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung vorgestellt. Ziel der Veranstaltung war es, dass sich hierbei Arbeits- und Interessengruppen bilden.
«Wir in Umkirch» ist eine aus der Zivilgesellschaft entstandene Initiative, die in enger
Kooperation mit Verwaltung, Politik und Gewerbe das Miteinander in Umkirch stärken
und fördern möchte.
Bereits engagierte Umkircher*innen werden durch systematische
Vernetzungsmöglichkeiten, Bildungsangebote und Räume zum Austausch entlastet und
unterstützt werden, um so vom Wissen und den Ressourcen aller gegenseitig zu
profitieren. Personen ohne Zugang zu ehrenamtlichem Engagement sollen
angesprochen, eingeladen und an die Hand genommen werden, sich nach ihren
Möglichkeiten und Wünschen einzubringen.
Auch in Umkirch ist der demographische Wandel deutlich spürbar. Durch das gestärkte
bürgerschaftliche Engagement kann es gelingen, aus dem Dorf eine sorgende
Gemeinschaft aus Jung und Alt werden zu lassen.
Unter dem Motto „U’münkheim auf dem Weg zur Sorgenden Gemeinde“ sollten die Bedarfe der Bürger*innen in den Teilorten Untermünkheim, Enslingen und Übrigshausen erfragt werden. Auch sollten dabei die Bedarfe und die Bereitschaft für eine "Sorgende Gemeinde" von den vor Ort ansässigen Geflüchteten eruiert werden.
Nach einer intensiven Bekanntmachung des Projekts startete der Prozess mit einem Treffen für die örtlichen Vereine. Hierbei wurde über den konkreten Prozessablauf informiert und eine Übersicht über das bereits vorhandene Angebot erstellt. In einem nächsten Schritt informierten ehrenamtliche Botschafter in ihrer Nachbarschaft über den Prozess und teilten Fragebögen an die Haushalte aus. Diese Prozessphase wurde durch Gruppengespräche mit Unterstützung des Mittagstischs "Alt und Jung" sowie des örtlichen Arbeitskreis Asyl ergänzt.
Vor diesem Hintergrund wurden anschließend Bürgercafés in den drei Teilorten durchgeführt. Es galt dabei die Ergebnisse der Fragebögen weiter zu diskutieren und gegebenenfalls zu ergänzen. Die so gesammelten Aspekte wurden dokumentiert und in einer Abschlussfeier vorgestellt, weiterdiskutiert und auch dem Gemeinderat vorgestellt. Hieraus entstand eine Vielzahl an Ideen, die in einer Ideenschmiede nach der Abschlussveranstaltung aufgenommen wurden. Die Weiterarbeit an den entwickelten Ideen konnte so konkretisiert werden, sodass die Gemeinde und auch die Ehrenamtlichen einen Fahrplan für ihre weiteren Schritte erhalten.
Im Rahmen von Gut Beraten werden Ideen und Ansätze aus den Nachbarschaftsgesprächen weiter angegangen.
In Waldachtal-Hörschweiler wurde das alte Rathaus zu einer attraktiven Begegnungsstätte umgestaltet. Vereine, Gruppen aus der Ortschaft, Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, Senioren und Interessierte wurden hierzu im alten Rathaus zu einer Auftaktveranstaltung eingeladen.
Zur Auftaktveranstaltung kamen etwa 30 interessierte Bügrer. Es wurde über den Sachstand berichtet, anschließend hatten die Bürger die Gelegenheit ihre Ideen und Erwartungen zu äußern. Bei einem zweiten Nachbarschaftsgespräch wurden die meistgenannten und beliebtesten Projekte konkretisiert: Spiel- und Bastelnachmittage, Singen und Musikabende, Begegnungscafé, Biergarten/Bistro, Offenes Jugendhaus sowie Reparatur-Café.
Es fanden sich Arbeitsgruppen zusammen, die sich der weiteren Themenausarbeitung annahmen. Die entsprechenden Treffen wurden von Moderatoren begleitet und durchgeführt. Im Verlauf des Projekts zeigte sich, dass eine zusätzliche Veranstaltung für Jugendliche notwendig war, um ihnen einen besseren Raum für die Ausgestaltung zu bieten.
Die Ergebnisse wurden dokumentiert und an die entsprechenden Stellen weitergegeben.

In der Gemeinde können die Betreuungsplätze in den bestehenden Einrichtungen der Kinderbetreuung den Bedarf trotz deren Ausbau nicht mehr decken. Auch wegen des Bedarfs im neuen Baugebiet "Ortszentrum - Rück II" soll im Bebauungsplangebiet ein sechsgruppiger Kindergarten entstehen. Da die Gemeinde Waldbronn den Zusammenschluss der Teilorte Busenbach, Etzenrot mit Neurod und Reichenbach bildet, wünscht sich der Gemeinderat einen Ort der Begegnung im neuen Baugebiet, der Jung und Alt räumliche Begegnungsmöglichkeiten mit hoher Lebensqualität bietet. Um diese Art "Begegnungshaus" inkl. Kinderbetreuung zu realisieren, wird die gemeindeeigene Fläche im weiteren EU-weit ausgeschriebenen und an eine AG aus Investor und Planer vergeben. Vergabeziel ist die Realisierung des mit den beteiligten Bürger*innen und dem Gemeinderat erarbeiteten Konzepts für ein funktionierendes Mehrgenerationen-/Begegnungshaus und nachhaltige intergenerationelle Quartiersarbeit über Grenzen des Baugebiets hinaus.
Waldstetten-Wißgoldingen verwirklicht mit dem Bauprojekt "Löwenareal" eine einmalige Chance für ein Wohn- und Begegnungsprojekt für ältere und hilfsbedürftige Menschen.
Die Gemeinde wird mit der Quartiersarbeit noch mehr zum Kümmerer für die Menschen werden, die Hilfe und Unterstützung in ihrem häuslichen Lebensumfeld benötigen, so dass eine sorgende und fürsorgliche Gemeinschaft entsteht, eine, die sich gegenseitig stützt und trägt.
Die bedarfsgerechte Gestaltung des Lebensraums und der Lebenslagen aller Wißgoldinger Bürger wird gemeinsam mit der Stiftung Haus Lindenhof, der Bürgerschaft und ehrenamtlichen Gruppierung sowie dem Dorfverein Wißgoldingen e.V. umgesetzt. Vernetzung, Kooperationen, Nutzung vorhandener Ressourcen - die Wißgoldinger möchten im Alter so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben. Das soziale generationen- und kulturübergreifende Miteinander in Wißgoldingen wird so gestärkt und die soziale Infrastruktur und das Dienstleistungsangebot verbessert.
Wäschenbeuren verwirklicht mit diesem Quartiersprojekt "Zukunft gemeinsam gestalten - Wäschenbeuren" einen bereits im Jahr 2017 festgestellten Bedarf an Weiterentwicklung und Vernetzung von sozialen Themen zwischen den Vereinen, Einrichtungen und Diensten. Entwicklung einer Vision für ein gutes Leben in Wäschenbeuren unter Einbeziehung aller Generationen, alteingesessenen und neuen Bürger*innen, Menschen mit und ohne Handicap. Das Quartier soll sich durch das Einbringen der Bürger*innen und unter Zuhilfenahme der Maßnahme der Bürgerbeteiligung weiterentwickeln. Ein soziales, generationenübergreifendes und inklusives Miteinander soll zu einer "Sorgenden Gemeinschaft" wachsen.
Dahinter steht die Vision eines Ortes mit einer guten Infrastruktur vernetzt mit ehrenamtlichem Engagement, um in allen Lebenslagen ein möglichst selbstständiges Leben führen zu können. Dabei soll besonders die Zukunft im Alter in den Blick genommen werden, damit Menschen möglichst lange in ihrem Zuhause wohnen bleiben können.
Wir haben viele Möglichkeiten, wohin wir unser Dorf entwickeln können. Aber woher bekommen wir die Sicherheit, dass all das Neue auch angenommen wird? Hier soll uns die Quartiersentwicklung helfen. Wir wollen unseren Ortskern alters- und generationengerecht entwickeln. Wir haben ein Grundstück erworben, auf dem ein Angebot für Senioren entstehen soll. Wir haben das Zenhtstadel erworben, dessen Nutzung auch noch nicht geklärt ist und welches saniert werden muss. Wir werden durch den Bau des neuen Feuerwehrhauses und den Auszug der Feuerwehr aus dem jetzigen Gebäude weitere Räume zur Verfügung haben, deren Nutzung noch nicht geklärt sind. All diese offenen Fragen sollen durch die konkrete Beteiligung von Bürgern geklärt werden. Die angestrebte Förderung ermöglicht es uns, mit den Bürgern ein grundlegendens Nutzungskonzept und neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln, dass dann auch nach und nach realisiert werden soll.
Im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche in Wilhelmsfeld sollten Gespräche zwischen den vor Ort lebenden Personen in unterschiedlichen Lebenslagen und aus unterschiedlichen Herkunftsländern entstehen. Hierbei war es das Anliegen der Gemeinde Wilhelmsfeld, die Bedarfe der Bewohnerschaft zu erfahren sowie bewusst das Thema "Wohnen" zu diskutieren.
Zunächst wurde gemeinsam mit den Projektpartnern über die Projektkonziperung gesprochen. Die dabei erarbeiteten Ideen wurden in einem Projektbeirat diskutiert. Dieser setzte sich aus den Projektpartnern, Vertretern des Gemeinderats, der Flüchtlingshilfe und dem Integrationsmanagement aus unterschiedlichen Ortsteilen zusammen. Er diente dazu, die unterschiedlichen Interessen zu vereinen und Multiplikatoren für die weiteren Nachbarschaftsgespräche zu gewinnen.
Im Zuge einer Auftaktveranstaltung konnten Wohnungseigentümer für die Thematik sensibilisiert und das Gespräch eröffnet werden. Die Projektpartner erfuhren über die Sichtweisen der Eigentümer und im Gegenzug konnten diese über die Situation vor Ort erfahren. Hierbei wurde auch dafür geworben, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. In der Folge sollten in fünf Ortsteilen Nachbarschaftsgespräche mit den jeweiligen Einwohnern angeregt werden. Diese sollten sehr niedrigschwellig unter freiem Himmel stattfinden. Durch einen Kälteeinbruch musste jedoch auf Räume vor Ort wie jene eines Pflegeheims und ein Kirchenraum ausgewichen werden. Hierbei stand der Austausch über das Quartier und das Zusammenleben im Mittelpunkt. Da der Gemeinde Wilhelmsfeld kleinere soziale Konflikte in den Ortsteilen bekannt waren, wurde von den Projektpartnern zusätzliches Personal eingeplant. Hiermit sollte es möglich werden, dass nach einer offiziellen Veranstaltung aufkommende Themen weiter bearbeitet werden können. Dies war jedoch nicht notwendig.
Abgeschlossen werden sollten die Nachbarschaftsgespräche mit einer Sitzung des Projektbeirats, um anschließend in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung über die Ergebnisse zu berichten. Dieser Termin konnte pandemiebedingt nicht stattfinden. Er wird jedoch nachgeholt.
In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Wurmlingen mit einer großen Bürgerbeteiligung eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut, die vorhandenen weiteren Angebote wie ambulante Dienste, betreute Wohnanlagen, Tagespflege eingebunden und aktuell wird eine Wohnanlage nach WTPG realisiert. Das Projekt Quartiersimpulse verfolgt drei Ziele:
- Das Seniorenkonzept "Wohnen beim Schloß" (Wohnen nach WTPG) während der rund 1,5 jährigen Bauzeit noch stärker in die örtliche Gemeinschaft einzubinden, das Bewusstsein zu stärken und auch weitere qualitätssteigernde Maßnahmen umzusetzen.
- Die Angebote für die Senior*innen innerhalb der Gemeinde stärker miteinander zu verzahnen und vernetzen und Aufbau eines kleinen "Pflegestützpunkts/Seniorenbeauftragte" auf der örtlichen Ebene.
- Ergänzung und Aufbau von weiteren Angeboten für die Eigenständigkeit der Menschen im Alter, wie zum Beispiel Bürgertreff, offener Mittagstisch, Vesper am Abend, Seniorenwerkstatt und Internetschulung.
Beratung und Begleitung von Kommunen zu den Themen Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung
Der Stadtteil Ulm-Lehr möchte angesichts einer wachsenden Zahl von hilfe- und pflegebedürftigen Bürgerschaft, schrumpfenden personellen Ressourcen und neuer gesellschaftlichen Herausforderungen neue Wohn- und Unterstützungsformen von Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf entwickeln. In der Ortsmitte soll ein innovatives Angebot mit Wohn-, Unterstützung- und Begegnungsformen entstehen, das professionelle Hilfe sowie bürgerschaftliches Engagement gleichermaßen einbindet. Der aus einer Initiative des Ortschaftsrates hervorgegangene, in der Bürgerschaft verwurzelte Verein NachbarLe e.V. möchte gemeinsam mit der Bürgerschaft und der Kommune das Projekt "Mittendrin - Gemeinsam Älterwerden in Lehr" mitentwickeln und unterstützen. Beratung zu Umsetzung der Grundidee auf Basis der Bürgerbeteiligung, zur Entwicklung integrativen Wohn-, Unterstützungs-, Begegnungsformen.
Der Verein möchte durch viele Kleinprojekte, die Selbstständigkeit von Geflüchteten sowie das Kennenlernen von neuen Kulturen von Breisachern mit und ohne Fluchterfahrung fördern. Die geplanten Maßnahmen sind: gemeinsames Kochen, Unterstützung und Begleitung von Geflüchteten beim Lernen, Rechtskunde für Geflüchtete, Bürgerbeteiligung und Teilhabe an kulturellen Angeboten in der Stadt, Foto-Workshop, Fahrradwerkstatt und das Kennenlernen der Umgebung durch gemeinsame Ausflüge.
In diesem Verein haben sich Menschen im Rentenalter (60+) zusammengefunden, die in ihrem vertrauten Viertel wohnen bleiben möchten. Sie setzen sich gegen die zunehmende Vereinsamung und für gegenseitige Unterstützung ein sowie für gemeinsames Wohnen im Gemeinschaftshaus. Weitere Themen: Mobilität, Pflege im Alter und neue Wohnformen. Beratung erhält der Verein zu Umsetzung von Wohnprojekten wie Bürger AG und Baugemeinschaften, zu Kommunikation und zur sozialorientiertem Wohnungsbau.
Gemeinsam mit der Bevölkerung und zivilgesellschaftlichen Akteuren entwickelt die Stadt Lörrach und ihre Ortsteile Zukunftsideen weiter. Mit einer repräsentativen Bürgerbefragung unter Senioren ab 60 Jahren in den Ortsteilen Brombach und Hauingen werden die Themenfelder "Wohnen", "Freizeitangebote", "soziale Infrastruktur" "Entwicklungswünsche" und "Vorstellungen" gezielt abgefragt und zudem persönliches Engagement und die Mitwirkung an einem generationenübergreifenden Miteinander gefördert.
Ziel der Initiative ist es, gemeinschaftliches Wohnen in Tübingen zu stärken, um möglichst eigenständig und selbstbestimmt im Alter im vertrauten Quartier leben zu können. Fachliche Beratung und Prozessbegleitung rund um ein alternatives Wohnprojekt.
Der Verein K3 Winterlingen e.V. folgt ihrem Jahresthema "gemeinsam stark" und regt mit ihrem Projekt dazu an, Kooperationen zu schaffen, Vereine miteinander zu verbinden und somit eine vereinsübergreifende Zusammenarbeit zu kreieren und zu verankern. Die Beratung erfolgt auf vielfältige Weise zu dem Themen Kooperation, konkrete Projektumsetzung, Fundraising und Aufbau eines Pools von Ehrenamtlichen.
Die Interessensgemeinschaft Wohnwerkstatt hat sich mit der Vision einer nachhaltigen, generationsübergreifenden und gemeinschaftlichen Wohnform gegründet. Workshops und Interviews mit Bürger haben gezeigt, dass Interesse besteht, aber konkrete Ideen und funktionierende Wohnlösungen fehlen. Im Rahmen der Quartiersentwicklung der Fläche eines ehemaligen Texilunternehmens Lauffenmühle wird das Projekt im Baustein Wohnen berücksichtigt. Dafür werden Bürger an der Entwicklung eines generationengerechten, gemeinschaftlichen Wohnprojekts auf diesem Areal beteiligt.
Der Verein "Wurzel e.V." erarbeitet gemeinsam mit den Bürger*innen Ideen zur Ortsentwicklung und der damit verbundenen Schaffung von Wohn- und Lebensraum, nicht nur, aber besonders auch für ältere Menschen. Die Beratung erfolgt zu den Themen: Zusammenführung verschiedener innerörtlicher Entwicklungen, Erstellung eines Leitfadens zur Beteiligung, Erarbeiten von verschiedenen Methoden und deren Ausarbeitung.
Der Verein LaMa Lastenvelo Mannheim e.V. setzt sich für eine ressourcenschonende und emissionsarme Mobilität ein und ermöglicht durch das Projekt die gemeinschaftliche Nutzung von Lastenfahrrädern, um Neugier für Lastenfahrräder zu schaffen und eine effiziente Nutzung zu ermöglichen. Das kostenlose Angebot hat zum Ziel, die Verkehrswende voranzutreiben, indem der Fahrradverkehr stärker etabliert wird und soll insbesondere auch Familien und sozial schwächere Schichten ansprechen.
Im neuen Baugebiet wird gemeinschaftliches inklusives Wohnen in aktiver sozialer Nachbarschaft, als neue Wohn- und Lebensform in Reutlingen, möglichst vielen Menschen ermöglicht werden. Für die Vernetzung im Quartier hat die IG-GeWo-RT bereits mit Partner*innen eine Initiative für inklusive Quartiersentwicklung in Ringelbach mit derzeit 16 interessierten Organisationen an den Start gebracht. Beraten wird die IG-GeWo-RT, um konstitutive Projektziele wie soziale Wohnformen, Gemeinschaftsanspruch, Wirkung und Angebote fürs Quartier und die Stadtgeschichte zu erreichen. Im Rahmen einer Prozessberatung wird man sich eine Beratung zur Strukturierung von Einzelaufgaben und zur Moderation des partizipativen Prozesses der Projektentwicklung damit das Projektziel einer vielfältigen Bewohnerschaft bereits in der Struktur des Konzepts berücksichtigt wird. Desweiteren wird die Beratung genutzt sich hinsichtlich der Gewinnung weiterer Mitarbeiter*innen und Intreressent*innen zu kümmern, finanzielle und architektonische Rahmenbedingungen zu verfolgen und notwendige architektonische Vorentscheidungen und Gestaltung der Genossenschaftssatzung sowie der Realisierung von ökologisch nachhaltigen Konzepten umzusetzen.
Der Verein Stadtoasen Bad Säckingen e.V. hat das Ziel ein Grundstück in Bad Säckingen nach den Prinzipien der Permakultur zu bewirtschaften, um gesunde Lebensmittel zu produzieren und die teilnehmenden Bürger Wissen über Permakultur und Gartenbau zu vermitteln. Auch sollen Projekte rund ums Thema „urban gardening“ initiiert werden. Beratung erhält der Verein zur Prozessgestaltung.
Die Initiative öffnet mit ihrem Projekt eine bisher nicht zugängliche Fläche für eine gemeinschaftliche Nutzung als Garten, zum Anbau von Gemüse oder eben auch als naturnahe Erholungsfläche. Er dient als Lebensraum für Insekten und Kleintiere und sorgt für die Förderung der Artenvielfalt. Das Projekt ist ein Ort solidarischen Handelns und lädt zum Wissens-und Erfahrungsaustausch ein.
In Bergheim West entsteht ein Gemeinschaftsgarten, der unmittelbar zur Lebensumgebung ein Ort der kulturellen, sozialen und generationenübergreifenden Vielfalt darstellt. Dabei greift man auf Erfahrungen aus kleinen Gartenprojekten in den Hinterhöfen zurück, in denen mit Ehrenamtlichen bereits gemeinschaftlich Gemüse, Kräuter und Blumen gepflanzt wird. Die Erfahrung zeigt: Gärten bringt Menschen unterschiedlicher Sprache, verschiedenen Alters und Lebenssituation zusammen. Am Beet finden Nachbarschaftsgespräche statt, Begegnungsräume entstehen. Die Beratung erhält das Projekt für den Bürgerbeteiligungsprozess bei der Planung und Konzeption des Gartens.
Der Unterstützerkreis Flüchtlingshilfe Rielasingen-Worblingen begleitet den Integrationsprozess in der Gemeinde mit verschiedenen Angeboten und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Integration von Geflüchteten. Ziel des Projektes ist es, den Gemeinschaftsraum in der Unterkunft "Kupferdächle" zu beleben und daraus einem Raum für den Austausch, Kurse, Café, lebenswertes Wohnen und gemeinsames Arbeiten zu machen. Die Gestaltung und Nutzung des Raumes und des Gartens wird bei einer Auftaktveranstaltung gemeinsam mit den Bewohnern festgelegt. Außerdem wird das Organisationsteam gegründet, um den Prozess zu begleiten. Die Verantwortung für den Gemeinschaftsraum und für die Bewirtschaftung des Gartens wird langfristig durch die Bewohner und Ehrenamtliche aus der Gemeinde getragen. Das Projekt stärkt die Selbstwirksamkeit und die Beteiligung von Geflüchteten.
In Wangen entsteht ein soziales, generationenübergreifendes Wohnen in einem alten Quartier. Dazu werden 35 Mietwohnungen im Alt- und Neubau geschaffen. Ein Gemeinschaftsraum im Quartier ist geplant. Das Wohnprojekt soll unter Beteiligung von interessierten Personen aus der Region entstehen. Beratung erhält die eingetragene Genossenschaft zu Themen der Öffentlichkeitsarbeit und zu Fragen zum Energiekonzept.
Die Projektgruppe hat sich im Rahmen von Gut Beraten! ein Vorgehen erarbeitet, wie das Thema "Generation 60 Plus - Wohnen im Pfäffingen" inhaltlich und prozesshaft umgesetzt werden könnte. Im Zusammenhang mit der Erschließung eines neuen Wohngebiets in Pfäffingen initiiert die Projektgruppe eine öffentliche Beteiligungsveranstaltung zum Thema "Neue Wohnformen und Beteiligung". Ziel ist es, die Bürgerschaft einzuladen, eine erste Konzeption für eine neue gemeinschaftliche, altersgerechte Wohnform zu entwickeln.
Pfäffingen bietet durch ein Ärztehaus und mehrere Geschäfte gute Nahversorgung, mit der Ammertalbahn flexible Mobilitätsmöglichkeiten nach Tübingen, Herrenberg oder Stuttgart, außerdem noch aktives ein Vereinsleben und eine lebendige Kirchengemeinde. Das sind viele Faktoren für ein gutes Leben in der Gemeinde. Angebote und Ideen zum Thema Wohnen für Senioren fehlen jedoch. Das Ziel der Initiative ist es, zusammen mit der Bürgerschaft ein Konzept für alternative Wohnformen im eigenen Teilort zu erstellen, um lebenslang in der Ortschaft eingebunden leben zu können. Die Initiative wünscht Beratung hierzu.
In einer Fragenbogenaktion wurde deutlich, dass der Teilort Pfäffingen ein idealer Standort für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt für junge Senior*innen ist, weil dieser Teilort eine Bahnstation, ein Ärztehaus, mehrere große Lebensmittel- und Bekleidungsmärkte und ein aktives Vereinsleben bietet. Außerdem ist hier ein Neubaugebiet geplant, das noch inhaltlich ausgestaltet werden kann und es gibt bisher noch kein Wohnangebot für Senior*innen. Im Anschluss an die über den Beteiligungstaler geförderte Veranstaltung mit 50 interessierten Besucher*innen haben sich einige Interessierte gemeldet, die in einer Projektgruppe zu diesem Thema weiterarbeiten möchten. Die Beratung erfolgt zu folgenden Themen: Aufstellung eines Projektteams, Entwicklung und Konkretisierung altersgerechter Wohnformen, erste Konzeptionserstellung.
Der Verein Wohnvielfalt e.V. engagiert sich für Senioren und altengerechtes Wohnen und verfolgt das Ziel, Menschen in jedem Alter ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. In Eislingen arbeitet der Verein an der Vernetzung verschiedener Institutionen, um seniorengerechtes Wohnen in der Stadt zu ermöglichen. Dabei greift der Verein auch auf Ergebnisse eines Beratungsprozesses im Förderprogramm "Gut Beraten!" zurück. Diese Ergebnisse werden in einem Generationenworkshop aufgenommen und konkretisiert. In den Workshops ist die Teilnahme für Menschen jeden Alters möglich. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die durch den Generationenworkshop anfallen.
Das Generationen Netz Müllheim engagiert sich für ein generationenverbindendes, soziales Miteinander in Müllheim. Aktuelles Projekt ist die Errichtung eines Generationengarten, auf einem von der Stadt gepachteten Gelände. Ziel ist es einen Ort der Begegnung und der Naherholung aller Generationen, sowie des Gärterns zu schaffen. Vorrangige Zielgruppe sind Familien, Alleinerziehende, Senior*innen und Menschen, die gerne gärtnern. Auch für Besuchergruppen wie z.B. von Seniorenheime oder Schulklassen. An diesem Ort können Kindern den ökologischen Anbau kennenlernen und Ältere ihr Wissen an die Jüngeren weitergeben.
Mit dem Wohnquartier Höhwiesen auf einer Industrie-Brache im Stadtzentrum Blausteins wurde Wohnraum für 200 Menschen geschaffen. Im Bebauungsplan 2012 wurde eine Grünfläche als Generationenplatz ausgewiesen, der Stand heute noch nicht umgesetzt ist. Daher wird ein gemeinschaftlich nutzbarer Begegnungsort gestaltet. Als Anwohner*in hat man selbst die Initiative ergriffen, diesen Quartiersplatz als Generationenplatz zu projektieren und mit Leben zu füllen. Unter dem Motto "Gemeinschaft gemeinsam schaffen" wird man durch gemeinsame Arbeit am Generationenplatz Verbundenheit schaffen und eine sichtbare Einladung zur Begegnung gestalten und dabei im Einklang mit der Natur die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anwohner*innen gerecht werden. Die Beratung erfolgt zur Kooperation zwischen engagierten Bürgergruppen, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, Kommunalverwaltung und Gemeinderat, zur Strukturierung der Projektidee und zur Umsetzbarkeit eines inklusiven Angebots, sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten als auch ggf. Folgeantragstellungen.
Der Generationentreff LEBENSWert e. V. Bad Dürrheim wurde im Jahr 2010 ins Leben gerufen und gedieh in dieser Zeit zu einem Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger Bad Dürrheims. Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und Brücken zwischen den Generationen zu bauen. Es sollen vermehrt Netzwerke, speziell auch für ältere Menschen, aufgebaut und das freiwillige Bürgerengagement gestärkt und erweitert werden. Der Generationentreff bietet eine breite Palette an Möglichkeiten zur Beratung, Bildung und Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen. Monatlich wird ein vielfältiges Programm für alle Generationen organisiert und veröffentlicht. Das mit bürgerschaftlicher Initiative und kommunaler Unterstützung entstandene Projekt hat sich kurz nach seiner Gründung zum Verein entwickelt. Er ist ein Dachverband für 12 Untergruppierungen, deren ehrenamtliche Aktivitäten von den Lernlotsen, dem Teilhabekreis bis zum offenen Müttertreff reichen. Der Generationentreff LEBENSWert fördert und unterstützt das Entstehen von neuen Aktivitäten und Veranstaltungen.
Mit dem Projekt „Generationsübergreifendes Leben und Wohnen in Dachsberg und Ibach“ wird eine Quartiersentwicklung für ein gutes und gemeinschaftliches Leben und Wohnen in der sehr ländlich geprägten Region auf den Weg gebracht. Ein moderierter Beteiligungsprozess, der aus zwei Workshops und Marketingmaßnahmen besteht, findet statt. Ziel ist das Schaffen von Strukturen, die Ermittlung des Bedarfs und die Planung und Herstellung von Synergien durch generationsübergreifende Bürgerbeteiligung. Die Beratung erfolgt zur Entwicklung eines nachhaltigen und generationsübergreifenden Konzepts.
Das Ziel der Projektgruppe ist die Schaffung des Wohnraums für das generationsübergreifende und integrative Wohnprojekt, barrierefrei und rollstuhlgerecht ausgebaut, mit Gemeinschaftsräumen für gesellschaftliche und kulturelle Nutzung im Rahmen einer selbst organisierten Quartiersentwicklung. Beratung zur Projektentwicklung eines generationsübergreifenden Wohnprojektes.
Gründung einer Dachgenossenschaft für zivilgesellschaftliche, wohnwirtschaftliche Projektinitiativen, um den Marktzugang für preiswertes Wohnen in neuen Quartieren zu ermöglichen. Beratung zu Konzeptentwicklung, Organisation und Realisierung.
Die WoGe18 eG, eine Wohngenossenschaft in Gründung aus Dußlingen, hat sich zum Ziel gesetzt, selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Wohnen von Menschen in jedem Alter in Dußlingen zu ermöglichen. Ziel ist es, ein solidarisches und selbstverwaltetes Mehrgenerationenwohnen mit einer ausreichend großen Zahl von Wohneinheiten aufzubauen. Eine Beteiligung soll im Laufe des Prozesses durch Informationsveranstaltungen, Workshops und eine Einladung zu Beratungsstunden vor den regelmäßigen Treffen des Initiativkreises bzw. der Genossenschaftsmitglieder erfolgen. Beratung ist zur Entwicklung der Gruppe hin zur genossenschaftlichen Bewohner-Gemeinschaft sowie Fragen zur Erstellung einer Nachbarschafts- und Quartierskonzeption und zur Beteiligung vorgesehen.
Die Campus Galli Herbergen möchten eine Genossenschaft gründen. Mit zunächst 10 Gründungsmitgliedern aus inhabergeführten Kleinbetrieben der Gastronomie und der Hotellerie in der Region möchten sie ein eigenes Buchungsportal anbieten, um den global agierenden Portalen eine regionale Tourismus Kooperation entgegensetzen zu können. Beratung erhält die Initiative zur Gründung einer Genossenschaft.
Die Bürgerinitiative Essbare Stadt Waldkirch engagiert sich für Klimathemen wie Biodiversität, Boden, Wasser und Ernährung. In diversen Platzorten und Mitmachgärten setzen sie regelmäßig Bildungs- und Kulturprojekte um und fördern zugleich das gemeinschaftliche Miteinander.
Um das Thema Klimaschutz noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen und neue Engagierte zu erreichen, bietet die Initiative eine Klimaschutz-Ralley durch die Stadt an. Als handybasiertes Geo-Caching können Interessierte sieben Pflanzorte der Essbaren Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Dabei werden Informationen zu Klimaschutzthemen unterhaltsam vermittelt und durch konkrete Anschauung vertieft.
Der Gernsbacher Zukunftsraum erforscht, entwickelt und praktiziert gemeinsam mit regionalen Akteuren eine neue Kooperationskultur für eine zukunftsfähige ökosoziale Regionalentwicklung in der Stadt im Nordschwarzwald. Die Einwohner werden dabei über den Gernsbacher Zukunftsraum zusammengeführt und können sich dort austauschen. Über die letzten Monate haben sich zwei konkrete Themen herauskristallisiert, die die Menschen vor Ort bewegen: Lokale Ernährung und Orte für soziale Begegnungen. Im Gernsbacher Zukunftsraum werden dazu zwei Arbeitsgruppen initiiert. In den Arbeitsgruppen können die Bürger selbst organisiert die beiden Themenfelder bearbeiten, Projektideen weiterentwickeln und unter professioneller Begleitung eine neue Kommunikations- und Kooperationskultur entwickeln. Im Rahmen eines nachgeschalteten Markt der Möglichkeiten mit dem Titel Gernsbacher Zukunftstag können die Beteiligten ihre Ideen dann an Dialogtischen, Ständen und Workshops einer noch breiteren Öffentlichkeit präsentieren und weitere Mitstreiter gewinnen.
Das Projekt "Geschichten aufforsten" macht die wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Umwelt erlebbar. Mit kreativen Methoden wird die Auseinandersetzung mit der kulturellen Identität gefördert. Der Verein ermächtigt die Ortsgemeinschaft und beteiligt Bürger, ihre eigenen Zukunftsgeschichten zu entwickeln und stärkt die Bereitschaft, den eigenen Lebensraum in nachhaltiger Weise zu gestalten. Beratung zur Projektentwicklung und zum Fundraising.
Die Gesellschaft für Jugend- und Sozialforschung e.V. wurde vor über 30 Jahren von Wissenschaftlern und Praktikern der außerschulischen Jugendbildung gegründet, um neue und innovative Ansätze in der Jugendförderung zu entwickeln. Sie konzentriert sich vor allem auf didaktische Methoden in der beteiligungsorientierten Jugendarbeit.
„Wie gehen wir vor Ort als Gesellschaft mit Konflikten um?“ Diese Frage hat sich der Verein a.l.s.o. aus Schwäbisch Gmünd gestellt und richtet Nachbarschaftsgespräche aus. Im Verein a.l.s.o. treffen Fachkräfte auf unterschiedlichste Menschen, die die gesamte Vielfalt der Gesellschaft im Westen Schwäbisch Gmünds abbilden. Der inhaltliche Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Sensibilisierung für den Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten vor Ort sowie auf der Offenlegung von rassistischen Denk- und Handlungsmustern. Schwäbisch Gmünd lebt seit langer Zeit von und mit Zuwanderung und bot 2015 ein Beispielmodell im Umgang mit Geflüchteten.
Der ins Auge gefasste Stadtteil Schwäbisch Gmünd-West hat laut dem Verein a.l.s.o. seit Jahren immer weiter an Infrastruktur verloren, zum Beispiel durch den Rückbau von lokalen Einkaufsgelegenheiten. Auch der Anteil an Menschen in prekären Lebenssituationen sei in diesem Stadtteil größer als in den meisten anderen Stadtteilen. In Open Space-Runden wird nun der gelingende Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten in diesen Nachbarschaftsgesprächen bearbeitet. Der Verein erhoff sich durch die Nachbarschaftsgespräche ein stärkeres Miteinander statt eines Gegeneinanders der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Ergebnisse der Gespräche werden veröffentlicht. Die Stadtverwaltung unterstützt durch Bewerbung des Projekts sowie die Information des Gemeinderats.
Das Ziel der Initiative ist die Gründung eines Familien- und Gesundheitszentrums in und für Herrenberg als ein Raum für Begegnung, Gesundheitsförderung, offen für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen. Einen zentralen Schwertpunkt bilden die Themen der geburtshilflichen Versorgung. Der Beratungsgutschein wird für die konzeptionelle Konkretisierung der Projektidee unter Berücksichtigung der bisherigen städtischen Planung, unter Vermeidung von Doppelstrukturen sowie für die Gewinnung weiterer Kooperationspartner und für die Klärung der Rechtsform benötigt.
Die Initiative ist aus den Ortsgruppen von Fridays und Parents for Future entstanden und hat sich entschieden unter diesem Label aufzutreten, um für möglichst viele Akteure anschlussfähig zu sein.
Parents for Future hat bereits in Göppingen zum Klimagespräch eingeladen.
Ziel der Initiative ist es, beizutragen das Göppingen bis 2035 klimaneutral wird. Sie setzt sich dafür ein, dass Göppingen im Landkreis eine Vorreiterrolle übernimmt und schon 2035 klimaneutral wird. Mittels eines Einwohnerantrags erzielen sie, dass der Gemeinderat dazu Stellung bezieht. Die Gruppe sammelt dafür Unterschriften und entwickelt einen Klimastadtplan, um den Weg aufzuzeigen, wie Klimaneutralität erreicht werden kann.
Durch "Wir im Quartier" sollen, aufbauend auf der Bedarfserhebung durch eine Sozialraumanalyse, konkrete Handlungsschritte formuliert werden, die in der Projektphase umgesetzt werden. Die Sozialraumanalyse erfolgt gesamtstädtisch, während die Partizipations-, Planungs- und Umsetzungsphase auf das Pilotquartier Südlich Salamander-Stadtpark beschränkt ist. Hierbei liegt der Fokus auf generationenübergreifenden Angeboten sowie alters- und pflegegerechtem Wohnen.
Mit dem Projekt „Generationendialog Leutkirch" wird die Vision verfolgt, durch einen
nachhaltig angelegten Prozess der Quartiersentwicklung den sozialen Zusammenhalt
in Leutkirch zukunftsgerichtet und generationenübergreifend zu verbessern.
Das Ziel ist, dass sich Bürger*innen durch innovative Prozesse am
Generationendialog beteiligen, um gemeinsam Lösungen zur Verbesserung der
Lebensqualität der unterschiedlichen Altersgruppen zu entwickeln. Ein besonderer
Fokus liegt dabei auf der Zielgruppe der älteren Generation und der Schaffung von
guten Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung, das
schließt u.a. die Themen soziales Leben, Wohnen und Pflege mit ein.
Das Begegnungszentrum "Johanniter-Sonnentreff" in der Innenstadt dient dabei der
der Bündelung von Angeboten und bietet Raum für die Erprobung innovativer
Angebote. Um einen großen Teil der Gesellschaft für die partizipativen Prozesse zu
erreichen, wird intensive Netzwerkarbeit mit Vereinen und anderen relevanten
Einrichtungen betrieben.
Erstellung eines ganzheitlichen Grundkonzeptes zur Quartiersentwicklung unter Einbeziehung aller Bevölkerungs- und Altersgruppen für ein kulturelles und gemeinsames Miteinander. Beratung zu Integrationsperspektiven in der Quartiersarbeit, Vorbereitung und Durchführung einer Bürgerbefragung.
Professionelle Beratung und Begleitung der Initiative bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Bewohnerversammlung. Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag. Die erste Bewilligung erfolgte im Dezember 2018.
Der Arbeitskreis "Hilfe und Unterstützung im Dorf" hat sich als einer von insgesamt sechs Arbeitskreisen im Rahmen des kommunalen Gemeinde-Entwicklungsprozesses im Loßburger Ortsteil Wittendorf gegründet. Der Arbeitskreis will Unterstützungsangebote nach dem Gaienhofener Modell mit dem Titel "Hilfe von Haus zu Haus" vor Ort etablieren. Zusätzlich zur Vereinsgründung führt der Arbeitskreis eine öffentlichkeitswirksame Gründungsversammlung durch. An der Veranstaltung werden Bürger aktiv eingeladen, die Gründungsphase des Vereins zu unterstützten und eventuell auch selbst tätig zu werden. Ziel ist eine bürgerschaftlich getragene Unterstützungsstruktur für alle Menschen im Dorf, die Hilfe benötigen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel durch die Öffentlichkeitsarbeit für die Gründungsversammlung anfallen.
Die Initiative "gemeinsam 27" ist eine Gruppe aus privaten Wohnungssuchenden in unterschiedlichen Lebenssituationen, die mit ihrem Projekt urbane Orte aufspüren, bei denen Nachverdichtung möglich und sinnvoll ist und entwickelt darauf aufbauend gemeinschaftliche Wohnprojekte. "Gemeinsam 27" ist als Verein organisiert und arbeitet an der Gründung einer Genossenschaft, die mit Hilfe der Beratung erfolgt.
Der Freundeskreis Asyl Ammerbuch möchte eine Beschäftigungsinitiative gründen, um den Flüchtlingen vor Ort den Zugang zu Arbeit zu ermöglichen, Sprachbarrieren abzubauen und die Integration zu befördern. Das Prinzip der Initiative entspricht dem Gedanken der Nachbarschaftshilfe: Arbeiten im privaten Umfeld sollen an Flüchtlinge vermittelt werden. Beraten lassen möchte sich der Freundeskreis Asyl zu den Fragen wie eine nachhaltige Kostendeckung erreicht werden kann und welche Anforderungen es an die Koordination der Vermittlungsinitiative gibt.
Die Gemeinde Oberwolfach hat sich zusammen mit engagierten Bürger zum Ziel gesetzt im Rahmen des Klimaschutzpaktes seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aus der Oberwolfacher Energiewerkstatt ist ein Maßnahmenkatalog entstanden, der u.a. die Umsetzung von Windkraftanlagen mit Bürgerbeteiligung beinhaltet. Die Windkraftanlagen werden in Kürze in Betrieb gehen, sodass die Möglichkeit der Beteiligung konkret ist. Dazu hat sich eine zivilgesellschaftliche Gruppe zur Gründung einer Bürger-Energie-Gesellschaft in Oberwolfach zusammengeschlossen und braucht im nächsten Schritt Rechtsberatung für die Findung der geeigneten Unternehmensform. Die Initiative hat dafür eine Rechtskanzlei mit Schwerpunkt auf Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit vorgeschlagen. Nach Findung der Rechtsform wird die Beteiligungsmöglichkeit mit Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht.
Die Initiative "Demokratie stärken" ist eine Gruppe von elf ehrenamtlich engagierten Bürgern aus Oberteuringen, die es sich zum Ziel gemacht haben, den Zusammenhalt in der Bürgerschaft und die gegenseitige Fürsorge zu stärken. Mit dem Vorhaben der Gründung eines ehrenamtlichen Fahrdienstes in Oberteuringen möchte die Initiative die Mobilität von Senioren und Menschen mit Behinderung verbessern. Gerade in der ländlichen Region von Oberteuringen haben diese Menschen Probleme mobil zu sein, wenn sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Mit Hilfe eines ehrenamtlich betriebenen Fahrdienstes sollen diese Menschen in ihrer Mobilität bei den täglichen Verrichtungen wie Arztbesuchen, Einkaufen gehen oder für das Pflegen sozialer Kontakte und sozialen Angeboten der Gemeinde unterstützt werden. Beratungsgutschein zur Entwicklung eines geeigneten Fahrdienstmodells.
Im Rahmen des Förderprogramms „Nachbarschaftsgespräche“ wurde die „Integrationswerkstatt“ in der Gemeinde Möglingen durchgeführt. Ein Ergebnis davon war der Wunsch, einen „Verein der Vielfalt“ zu gründen, um die Diversität der Gemeinde aufzuzeigen, die Bürgerschaft zu aktivieren und Teilhabe zu ermöglichen. Dazu ist es das Ziel, bestehende Angebote weiterzuführen und neue bedarfsorientierte Angebote zu entwickeln. Die Beratung erhält die Initiative für den Aufbau des Vereins der Vielfalt, für die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen und für das Aufzeigen von Potenzialen einer Vereinigung.
Die Initiative hat sich zusammengefunden, um eine solidarische Landwirtschaft in Ettenheim zu gründen, angestoßen durch den Verein LebensMittelpunkt Ettenheim e.V. Bei einer ersten öffentlichen Informationsveranstaltung stoß das Konzept auf breites Interesse und weitere Unterstützer wurden gefunden.
Bei der solidarischen Landwirtschaft wird der Erzeuger durch die gemeinschaftliche Finanzierung vom Marktdruck befreit und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Felder ermöglicht. Durch das solarische Prinzip entsteht eine enge Bindung zwischen Produzent und Konsument. Die Abnehmer werden von Anfang am Anbauprozess beteiligt. Unter anderem auch bei der Mitarbeit auf dem Feld, in Arbeitsgruppe zu Anbau, Verteilung, Finanzierung, Organisation usw.
Basisberatung zur Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Grundversorgung mit der Bürgerschaft. Schwerpunkte sind Lebensmittel, täglicher Bedarf und Gastronomie.
Weissach KLIMAschutz konkret setzt sich mit außergewöhnlichen Aktionen zur Reduktion des persönlichen CO2-Verbrauchs ein und trägt dazu zur zukunftsfähigen Entwicklung von Weissach bei. Im Rahmen des Klimagesprächs ist die Idee entstanden, Grüne Hausnummern an Häusern einzuführen, die Strom regional erzeugen. Die am Haus angebrachten Plaketten zeigen, dass man mit dem Besitzer Kontakt aufnehmen kann und sich zu erneuerbarer Stromerzeugung beraten lassen kann. Mittels eines QR-Codes können Kontaktdaten abgerufen werden. Bürger*innen werden mit analogen und digitalen Austauschmöglichkeiten und kleinen Veranstaltungen begleitet. Mit dieser Projektidee wird die Mund zu Mund Propaganda genutzt, um den Ausbau von Solarenergie schnellstmöglich weiter auszubauen.
Die Vision des Vereins ist es, der Bau eines generationenübergreifenden, genossenschaftlichen Wohnens für mindestens 30-40 Menschen, die miteinander eine neue Kultur des gemeinschaftlichen Lebens und der Selbstbestimmung entwickeln. Ziel ist es, für verschiedene Generationen, Kulturen und Lebensphasen soziale, ökologische, gewerbliche und kulturelle Räume zu schaffen. Damit werden Lösungen für eine enkeltaugliche Zukunft entwickelt, thematisiert und gelebt. Der Verein erhält fachliche Begleitung bei der Gründung der Genossenschaft / Dachgenossenschaft.
Der Obst- und Gartenbauverein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Natur zu einem Erlebnis zu machen. Sie vermitteln Freude an der Natur und gestalten Kemnat grün und nachhaltig. Beim Gärtnern unterstützen sie mit fachlichen Informationen, persönlicher Beratung, Lehrgängen und Ausflügen. Mit Aktionen verschönern Sie den Ort Kemnat.
In einem breit angelegten kommunalen Stadtentwicklungsprozess werden die Bürger in die Planung folgender Themen mit einbezogen: Verkehrsbelastung, Klimawandelfolgen, Nahversorgung und Aufenthaltsqualität. Ziel des Obst- und Gartenbauvereins ist es in diesem Rahmen aufzuzeigen, wie eine zukünftigen Umgestaltung der Verkehrsräume auf die Aufenthaltsqualität auswirken kann. Mit einem Grünen Wohnzimmer soll eine öffentliche Aufenthaltsfläche geschaffen werden, die gerade in Corona-Zeiten Raum für Begegnung und Aktionen bietet. Neben digitalen Veranstaltungen ist das Grüne Wohnzimmer Dreh- und Angelpunkt der corona-konformen analogen Beteiligung des Stadtentwicklungsprozesses.
Bildung einer Projektgruppe aus Betroffenen und Interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in der Gemeinde verantwortlich ist. Die Betroffenen sollen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Beratung zur Aufnahme des Ist-Zustandes, Auswertung und Weiterentwicklung.
Bildung einer Projektgruppe aus Betroffenen und Interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in der Gemeinde verantwortlich ist. Die Betroffenen sollen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Beratung zur Aufnahme des Ist-Zustandes, Auswertung und Weiterentwicklung.
Bildung einer Projektgruppe aus Betroffenen und Interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in der Gemeinde verantwortlich ist. Die Betroffenen sollen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Beratung zur Aufnahme des Ist-Zustandes, Auswertung und Weiterentwicklung.
Bildung einer Projektgruppe aus Betroffenen und Interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in der Gemeinde verantwortlich ist. Die Betroffenen sollen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Beratung zur Aufnahme des Ist-Zustandes, Auswertung und Weiterentwicklung.
Zunächst kam es zur Bildung einer Projektgruppe mit Hilfe des VdK Rutesheim aus Betroffenen und interessierten Bürgern, die für die Barrierefreiheit in der Gemeinde verantwortlich ist. Anschließend erfolgt die Aufnahme des derzeitigen Ist-Zustandes, die Auswertung und Information über bereits bestehende Barrierefreiheit. Gemeinsam wird in weiteren Schritten besprochen und geplant, wie die Umsetzung der Barrierefreiheit für die Bürger in Rutesheim gestaltet werden soll, damit die Menschen in allen Lebenslagen solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können.
Die Initiative setzt sich für ein barrierefreies Leben in Renningen ein und erarbeitet mit interessierten Bürger*innen ein Konzept, damit Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben bleiben können. Ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung erhalten notwendige Hilfe und Unterstützung, wodurch ihre Lebensqualität gesteigert wird. Beratung erhält die Initiative bei einer Vor-Ort-Begehung für die Aufnahme des Ist-Zustandes, der Auswertung der gesammelten Daten und die Unterbreitung und Umsetzung von barrierefreien Lösungen.
Die BUND Ortsgruppe Althengstett vertritt umweltorientierte und regionale Themen und organisierte zwei regionale Klimagespräche. Im Rahmen dieser Gespräche beklagen die Bürger*innen ein erhöhtes Müllaufkommen durch die Gastronomie. Da immer mehr Gastronomen aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Hol- und Bringdienste einrichten, entsteht zusätzlicher Verpackungsmüll. Die Bürger*innen möchten gerne die Gastronomie unterstützen, dabei aber nicht unnötigen Verpackungsmüll produzieren.
Die entwickelte Projektidee umfasst die Einführung von Mehrweg-Geschirr in Althengstett und den umliegenden vier Gemeinden. Dazu soll das Pilotprojekt den Gastronomen die Hürde erleichtern auf Mehrweg-Geschirr umzusteigen und den Bürger*innen die Möglichkeit geben umweltfreundlich Essen zu bestellen. Während einer 6-monatigen Pilotphase können die Gastronomen kostenfrei ein Kontingent an Mehrweg-Geschirr über die Firma recircle beziehen. Im Anschluss an die Projektphase trägt der Gastronom die Nutzungsgebühr selbst, wenn er das Mehrweg-System erfolgreich eingeführt hat.
Beide Bürgervereine kümmern sich um die gute Nachbarschaft in den Stadtteilen Bulach und Beiertheim, die als zwei ehemalige Dörfer zu Beginn des 20. Jh. nach Karlsruhe eingemeindet wurden. Das Thema „Gut Älter werden im Stadtteil“ ist zentral. Im Rahmen des Projektes soll Quartiersentwicklung im Sinne aktiver und sorgender Gemeinschaft für und mit älteren Menschen vorangetrieben werden. Junge Menschen sollen ebenfalls in den Prozess einbezogen werden. Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung des Bürgerbeteiligungsprozesses.
Beide Bürgervereine kümmern sich um die Wahrnehmung und Vernetzung der Interessen und Menschen im Stadtteil für eine gute Nachbarschaft in den Stadtteilen Bulach und Beiertheim, die als zwei ehemalige Dörfer zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Karlsruhe eingemeindet wurden. Das Thema „Gut Älter werden im Stadtteil“ ist zentral. Im Rahmen des Projekts soll Quartiersentwicklung im Sinne aktiver und sorgender Gemeinschaft für und mit älteren Menschen vorangetrieben werden. Junge Menschen sollen ebenfalls in den Prozess einbezogen werden. Fachliche Unterstützung ist dabei notwendig. Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag.
Der Fachbeirat Wohnen und Leben im Leben entwickelt mit Hilfe eines Bürgerbeteiligungsprozesses ein Konzept zum Thema "Gut älter werden in Kirchentellinsfurt". Hier werden Kinder, Jugendliche, Bürger*innen aller Altersgruppen und insbesondere Senior*innen in verschiedenen Lebenssituationen abgebildet, um auf möglichst viele Ideen, Kompetenzen, Erfahrungen, Vorstellungen und Bedürfnissen zurückzugreifen. Die Beratung unterstützt den 3-4 teiligen Planungsprozess, in dem interessierte und engagierte Bürger*innen aller Generationen einbezogen werden, die Eckpunkte des Beteiligungsprozesses geklärt und in Handlungsschritte übersetzt werden.
Der Kreisjugendring Ravensburg möchte einen Prozess zur Neuausrichtung der Jugendarbeit im Landkreis Ravensburg anregen. Durch die Förderung aus „Gut Beraten!“ soll die Nachhaltigkeit von vorhandenen Strukturen gesichert werden und bereits gewonnene Erfahrungen für andere Gemeinden nutzbar gemacht werden. Des Weiteren sollen neue Konzepte entwickelt und erfolgreich etabliert werden. Beratung erhält der Kreisjugendring zu den Fragen: Wie lassen sich bereits entwickelte Beteiligungsstrukturen absichern? Und wie kann der Transfer auf andere Kommunen gelingen?
Im Nachgang der kommunalen Pflegekonferenz in Schwäbisch Gmünd hat sich im Stadtteil Hussenhofen/Zimmern eine Gruppe von Engagierten gebildet, die den Stadtteil zu einem altersgerechten Quartier weiterentwickeln möchten. Die Leitidee des Vorhabens ist die Entwicklung einer "Caring Community" und das Stärken der Sorgekultur vor Ort. Diese Ziele sollen jedoch nicht vorgegeben werden, sondern im Bürgerdialog mit den Einwohnenden vor Ort mit Leben gefüllt werden. Die Bürgerbeteiligung setzt direkt an der Zielgruppe an. Der ältere Mensch ist dabei Experte in eigener Sache und kann seine Bedarfe mit in den Prozess eingeben. Ziel ist es auch, auf den Bedarf von pflegenden Angehörigen einzugehen, der von den Angehörigen im Beteiligungsprozess formuliert werden kann. Die Ergebnisse des Dialogs werden im Anschluss an die verantwortlichen Entscheider in der Kommune weitergegeben.
Das Ziel des Projekts ist ein Bürgerbeteiligungsprozess „Gut und gerne alt werden in Leutenbach“. Die Bedarfe der Bürgerschaft werden dabei ermittelt. Was wünschen sich die Menschen vor Ort? Was brauchen sie, um hier gut alt werden zu können? Welche Faktoren steigern die Lebensqualität in der Gemeinde? Die Kommune agiert dabei als Partner. Das Zusammenwirken von Organisationen, Initiativen und Engagierten wird beim gemeinsamen Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten sowie der Umsetzung von Ideen und nachbarschaftlichen Netzwerken gefördert. Dabei soll das Interesse am eigenen Lebensumfeld und neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommune entdeckt und schätzen gelernt werden. Der Beratungsgutschein wird für die Umsetzung des Bürgerbeteiligungsprozesses zum Thema „Sorgende Gemeinschaft in Leutenbach“ gebraucht.
Virtuelle Familientreffen

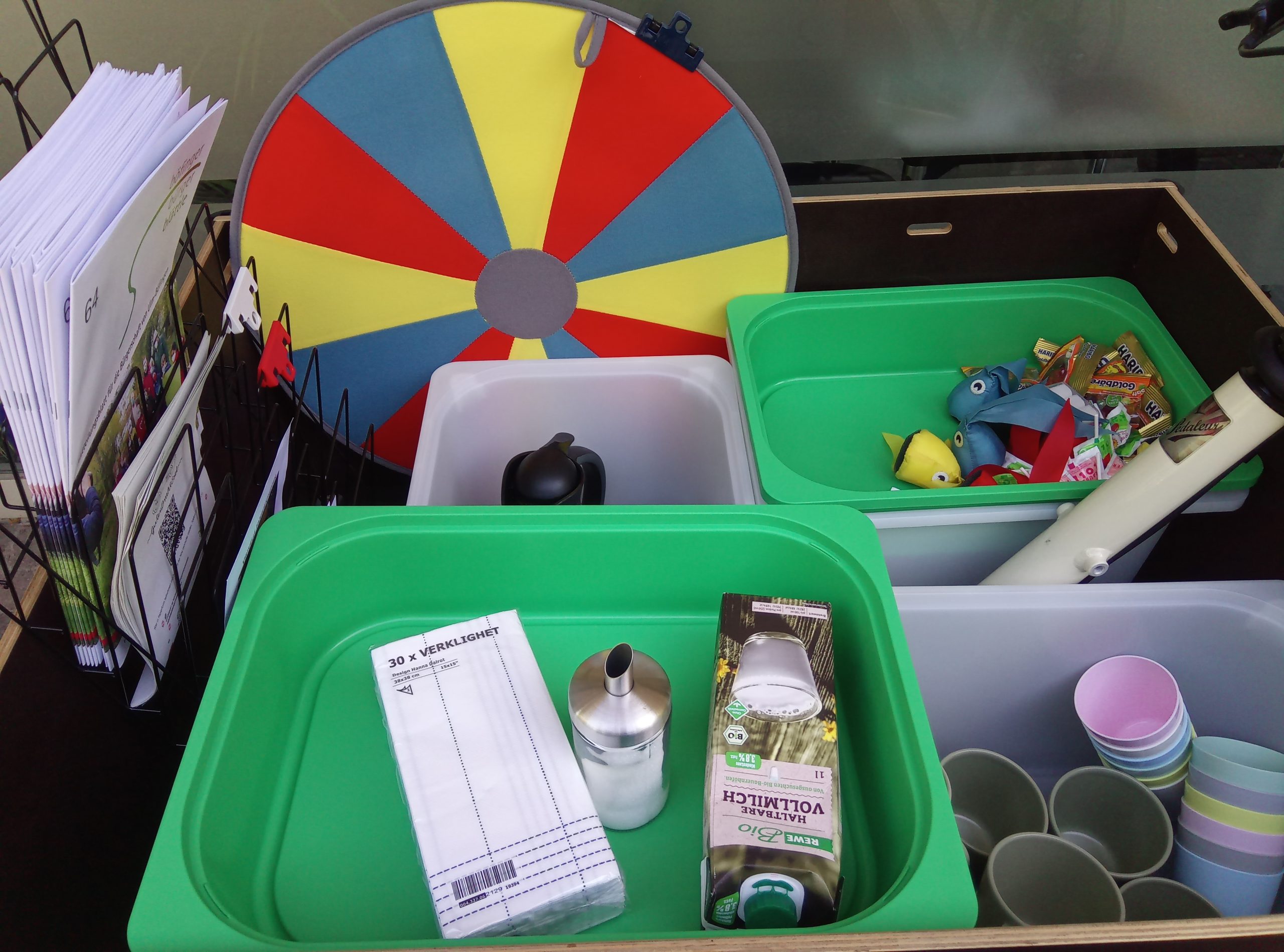
Zu Beginn des Vorhabens war zu spüren, dass nach langen Zeiten der Corona-bedingten Einschränkungen der Wunsch nach persönlichen Begegnungen sehr groß war.
Im Ulmer Stadtteil Böfingen, der im Laufe der Jahrzehnte sehr stark gewachsen ist, gibt es zwar eine zufriedenstellende Infrastruktur. Es wurde jedoch immer wieder der Wunsch nach Begegnungsstätten wie einem Café, auch für Familien und Kinder, geäußert. Böfingen verfügt über zahlreiche großzügige Grünflächen, auch größere Spielplätze, die gut besucht sind. Oft wird dort ein Kiosk oder Ähnliches in der Nähe vermisst. Da Veranstaltungen in der Vergangenheit oft weniger gut besucht waren, kam die Frage auf, ob Informationen über solche Angebote die entsprechenden Zielgruppen überhaupt erreichen.
Mit dem „Guten Draht“-Esel, einem Lasten E-Bike, sollten Menschen in Böfingen dort aufgesucht werden, wo sie sich sowieso aufhalten. Das Lastenfahrrad diente als „Hingucker“. Es wurde entsprechend beklebt und mit einer Beachflag ausgestattet. Es sollte dabei unterstützen, die Leute im Sinne einer aufsuchenden Beteiligung zum Mitmachen zu bewegen. Aufsuchende Plätze waren zum Beispiel Spielplätze und Flächen vor Einkaufsläden. Als nette Geste wurden in der Regel Getränke und kleine Spiele angeboten. Außerdem wurde auf den erstellten Fragebogen aufmerksam gemacht. Die Teilnahme war in Papierform oder online möglich. Auch verschiedene Informationen über Angebote der Stadt wurden weitergegeben.
Das Ziel, mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und sie über Angebote im Stadtteil zu informieren, konnte umgesetzt werden. Außerdem konnten die Menschen vor Ort Anliegen, Ideen, Kritik und Meinungen äußern, um – wenn möglich – Verbesserungen zu erreichen.
Künftig sollen auch weiterhin aufsuchende Aktionen mit dem „Guten Draht“-Esel durchgeführt werden.
Im Rahmen der Bügeltische zum Thema „Gutes Älterwerden in Herbertingen" ergab sich der Bedarf einer Bürgergemeinschaft. Diese wird demnächst gegründet. Das ZEITBANKplus Model soll als eigenständige Abteilung in diese Bürgergemeinschaft integriert werden. Das Konzept dafür wurde im Rahmen der Bürgertische vorgestellt und bekam viel Zuspruch. Der Beratungsgutschein wird für die Initiierung der ZEITBANKplus verwendet.
Die Initiative N! - Gutes Leben in Rottenburg setzt sich für die 17 Nachhaltigkeitsziele auf lokaler Ebene ein, als eine Voraussetzung für eine lebenswerte Stadt. Um die Nachhaltigkeitsziele kommunal zu verankern und im Lebensalltag umzusetzen, entwickelt die Initiative Ideen und Aktivitäten rund um die Themen Bildung, Energie, Konsum, Mobilität und Verwaltung. Sie unterstützt die Nachhaltigkeitsinitiativen von Vereinen und Bürgern und wird unterstützt von der lokalen Agenda 21, der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat.
Die 17 Nachhaltigkeitsziele hat die Initiative zusammen mit anderen Akteuren ins Schwäbische übersetzt und druckt diese auf Bierdeckel. Dieses Medium hat sich als niedrigschwelliges Transferinstrument bewährt, um über den Dialekt zu den Nachhaltigkeitszielen ins Gespräch zu kommen.
Der Verein „Lebensqualität Hochdorf e. V.“ plant eine Dienstleistungsbörse aufzubauen, um lebenslanges Wohnen in Hochdorf für Jung und Alt, Familien und Singles zu ermöglichen und benachteilige Mitbürger finanziell zu stärken. Beratung wird bei der Entwicklung und Umsetzung eines Beteiligungsprozesses zur Bedarfserhebung benötigt sowie für den Aufbau einer nachhaltigen Struktur der Dienstleistungsbörse.
Der AK Bürgerinformation setzt sich für ein vernetztes Ortsleben in Haubersbronn ein. Bürgern und vor allem Neubürgern fehlt bisher der Zugang zu aktuellen Informationen, die den Ort betreffen. Mit digitalen und analogen Lösungen wird diese Lücke geschlossen. Ziel dabei ist es, Informationen zugänglich zu machen, Ehrenamtliche zu vernetzen, soziale Kontakte zu fördern, Neubürger besser einzubinden und dadurch insgesamt mehr Lebensqualität vor Ort zu erreichen. Auf einer Webseite mit allen relevanten Informationen können sich Bürger informieren. Begleitende Flyer und analoge Maßnahmen weisen auf die Webseite hin, zudem entsteht ein Veranstaltungskalender in analoger Form für alle, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben.
Das Haus der Jugend Göppingen hat ein Jugendforum gegründet. Es sollte eine Neudefinition des Jugendhauses unter Einbezug von Migrantenvereinen und des Freundeskreis Asyl in Göppingen geschaffen werden.
Das Projekt „Haus der Nachhaltigkeit“ ist ein Zusammenschluss von engagierten Bürger*innen, NGO’s, Wissenschaft und Unternehmen, die gemeinsam einen Ort und Angebote für Nachhaltigkeit in Ulm, Neu-Ulm und der Region entwickeln wollen. Es soll ein Ort entstehen, an dem regional ein Beitrag zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen geleistet wird und sich alle - unabhängig von Einkommen, Weltanschauung, Alter, Herkunft und sozialer Stellung - über Nachhaltigkeitsthemen informieren und engagieren können.
Das Ziel ist, den sozialen, ökonomischen, ökologischen, technologischen und ethischen Wandel in Ulm, Neu-Ulm und der Region aktiv und demokratisch zu gestalten. Wir möchten auch bereits bestehende Angebote und Initiativen vernetzen und miteinander in den Austausch bringen.
Der Verein aus Leimen möchte das Haus der Vielfalt Wiesloch durch ein Bildungs- und Berufswerk für Geflüchtete erweitern. Angedacht ist die berufliche und berufsspezifische sprachliche Förderung von Köchinnen und Köchen, Küchengehilfen sowie Schneider. Um diese Sprachförderungen durchzuführen und die Planung von Veranstaltungen im Haus der Vielfalt realisieren zu können, wird eine Beratung in Anspruch genommen.
Das Haus Mosaik ist ein Projekt, das Raum für Lern-und Kreativangebote, selbst organisierte Treffen oder auch musische und kulturelle Angebote schafft. Ankerpunkt ist ein offener Mittagstisch, der dafür sorgt, Gruppen des zivilgesellschaftlichen Engagements zusammenzubringen. Die Beratung für die Initiative erfolgt zur finanziellen Umsetzung für die Langfristigkeit des Projekts und zur Umsetzung der Gemeinnützigkeit trotz Gaststätte.
Das Flüchtlingsnetzwerk Gomaringen ist 2015 entstanden mit dem Ziel, die Gomaringer Geflüchteten nach Möglichkeit zu betreuen und sie bei ihrer Integration zu unterstützen. Ziel des Projekts der digitalen Hausaufgabenbetreuung ist es, den Schülern der Grund-und Werkrealschule sowie anderer Schularten mit Hilfe der entsprechenden Hardware während der Schulschließung die Teilnahme am Unterricht und der Hausaufgabenbetreuung zu ermöglichen. Der Antragsteller weist daraufhin, dass das "Homeschooling" voraussichtlich noch länger aufrecht erhalten wird, wenn auch nicht wochenfüllend wie in der Corona-Krisenhochzeit. Die Hardware für die Geflüchteten unterstützt auch die Ehrenamtlichen, die laut Antragsteller allesamt zur Risikogruppe zählen und daher den direkten Kontakt im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung meiden müssen. Die benötigte Hardware soll dabei vom Antragsteller laut Antrag an die Geflüchteten nur verliehen werden, womit verschiedene Familien - unter Beachtung der Hygiene und Distanzregeln - von den Gerätschaften profitieren können. Der Antragsteller möchte dafür Sorge tragen, dass das Leihmodell zuallererst "besonders bedürftigen" Familien zugute kommt. Die Gerätschaften sollen auch nach vollständiger Schulöffnung zur Unterstützung im Projekt und der turnusmäßigen, wöchentlichen Hausaufgabenbetreuung eingesetzt werden.
Der Arbeitskreis Bürger-Energie Königsbronn möchte eine Bürger-Energiegenossenschaft gründen, die eine große Anzahl privater, öffentlicher und gewerblicher Bauten in Königsbronn über ein Nahwärmenetz versorgen soll. Beratung erhält der Arbeitskreis zu Fragen des Prozessmanagements.
Die Bürgerinitiative "Heddebör unser Ort" entwickelt Projekte, um Hettigenbeuern zukunftsfähig und attraktiv für Jung und Alt zu machen. Neue Impulse für die Dorfgemeinschaft wurden gemeinsam durch Informationsveranstaltungen und Workshops kanalisiert und realistische Projektziele festgelegt. Der Beratungsgutschein wurde zu Organisation und Durchführung einer Bürgerwerkstatt, zur Konzeptentwicklung für die Projektumsetzung anhand von Ergebnissen des Bürgerbeteiligungsprozesses eingesetzt.
Die Initiative „Heddebör unser Ort“ organisiert in Hettigenbeuern, einem Stadtteil von Buchen, eine Zukunftswerkstatt. Im kleinen Ortsteil ist der demografische Wandel für alle Einwohner spürbar. Zusammen mit den Bürgern sucht die Initiative in der Zukunftswerkstatt nach Lösungen, um „Heddebör“ aufzuwerten. Die Lösungen werden in einem Entwicklungskonzept für den Ortsteil festgehalten. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die rund um die Zukunftswerkstatt und die Kommunikation der Ergebnisse anfallen.
Zell-Weierbach ist ein Stadtteil von Offenburg, mitten im Rebland. Neben der Landwirtschaft und dem Weinbau waren früher fast alle Handwerksbetriebe im Ort vertreten. Die Zahl der Gaststätte und der Einkaufsmöglichkeiten ist in den letzten Jahren stark rückläufig geworden, die Lebensqualität ging verloren. Dieser Entwicklung setzt sich die Initiative des Heimats- und Geschichtsvereins entgegen. Das Projekt „Rebland Café See“ als ein Treffpunkt, ein Kommunikations- und Begegnungsort mit verschiedenen Angeboten von und für die Bürgerschaft. Fachbezogene Beratung erhält die Initiative zur Projektkonzeption und Organisation sowie der Machbarkeitsstudie.
Die Nachbarschaftshilfe Aasen & Heidenhofen bietet Unterstützung für pflegebedürftige, alte, kranke oder behinderte Menschen an, damit Menschen möglichst lange im häuslichen Umfeld bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben können. Ziel ist es, dass möglichst viele Bürger sich als Helfer beteiligen und sich für das Miteinander und das Gemeinwohl, der älter werdenden Gesellschaft einsetzen. Um das Ehrenamt wertzuschätzen und Helfer in den Gemeinden sichtbar zu machen, tragen Ehrenamtliche Shirts und Jacken während ihrer Tätigkeit. Damit wird das Wir-Gefühl gestärkt und die Außendarstellung verbessert, indem Helfer als solche erkannt werden.
Bürgerstiftung Deggenhausertal
Die "Herzens-Stunden im Tal der Liebe" waren ein Bildungsangebot für Erwachsene, die in moderierten Gesprächsrunden ermutigt und unterstützt wurden, für ihre eigenen Herzensangelegenheiten vor Ort aktiv zu werden. Sie sollten die eigene Lebenssituation reflektieren, persönliche Ressourcen und Talente entdecken und Neues ausprobieren. Was erfreut unser Herz? Was tut uns und unserem Herzen gut? Was liegt uns in unserer Gemeinde / in unserer Nachbarschaft am Herzen? Das waren Fragen, die es in professionellen Formaten persönlich zu beantworten galt.
Die Initiative UtopiAA richtet verschiedene niederschwellige Dialogformaten in Aalen aus. Beispiele sind die Gespräche bei Hefezopf und ein wöchentlicher Treffpunkt im Raum "UtopiAA" in der Aalener Innenstadt. Ziel ist es, mehr Begegnungen in der Stadt zu schaffen. Mit dem interaktiven Format "Forumtheater" wird es der Bürgerschaft möglich, auch kontroverse lokale Themen anhand einer Konfliktszene darzustellen. Beispiele können sein: Klimawandel, (lokale) Energiewende oder innerstädtische Versiegelung. Samstags zur Marktzeit werden auf dem Wochenmarkt Gespräche gesucht, um die Beteiligungsformate zusätzlich zu bewerben.
Die Initiative „Hilfe von Haus zu Haus“ setzt sich zusammen aus Bewohner der elf Ortsteile von Offenburg, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Strukturen nachbarschaftlicher Unterstützung in Offenburg zu etablieren. Die Initiative möchte organisierte und bedarfsgerechte Hilfe zur Unterstützung im Alltag in jedem Ortsteil von Offenburg anbieten, dadurch den Dialog zwischen den Generationen anregen, wie auch die soziale Gemeinschaft vor Ort stärken. Beratung erhält die Initiative zum Thema: Weiterentwicklung und Ausbau bereits vorhandener Strukturen.
Der Interessensverband für Post-Covid Erkrankte und deren Angehörige bietet eine Plattform für Austausch und Unterstützung für die noch relativ unerforschten Spätfolgen einer Coronaerkrankung. Da es momentan noch wenig fachkompetente Anlaufstellen gibt, reagiert der Interessensverband auf diesen Bedarf. Lokale Gruppen haben ihre Arbeit bereits aufgenommen, andere sind in Gründung.
Das Hilzinger Wohnzimmer ist ein Projekt, das die Gemeinschaft und das soziale Miteinander in der Gemeinde generationenübergreifend gestaltet. Die Initiierung und Ausgestaltung eines Treffpunkts unter aktiver Einbeziehung der Bevölkerung fließt in das Projekt ein. Der Seniorenrat sieht darin eine Bürgerstube, in der sich alle Bürger unverbindlich zu unterschiedlichsten Anlässen treffen können. Die Beratung erfolgt zu den Themen: Projektbegleitung, Strategien sowie Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung und Schaffung von Strukturen, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung der Bürgerbeteiligung, Konzeption und Moderation der Zukunftswerkstatt.
Der Bürgerverein Daheim in Harpolingen fördert das dörfliche Miteinander, schafft Kommunikationsmöglichkeiten und motiviert zur Umsetzung eigener Projekte. Der Fokus liegt dabei auf der Integration von Senioren, Alleinstehenden und Zugezogenen am sozialen Miteinander. Es wird Wert darauf gelegt, die Angebote niedrigschwellig und mit wenig Ressourcenverbrauch umzusetzen.
Mehrere Familien haben sich zusammengeschlossen und möchten einen Gemeinschaftsgarten unter Anleitung eines Permakultur-Experten anlegen. Vor allem berufstätige Eltern, Alleinerziehende und Familien ohne eigenen Garten haben hier die Möglichkeit naturnahes Gärten zu erlernen. Gerade Kinder profitieren von diesem Angebot, um nach langer Zeit im Homeschooling, sich wieder unbeschwert im Freien bewegen und sich mit Naturmaterialien beschäftigen zu können.
Ziel des Projektes ist eine nachhaltige Gestaltung des öffentlichen Raumes hin zu grünen Begegnungs- und Beteiligungsorten. Dafür sind verschiedene Formate angedacht: Neben Workshops und dem Anlegen von Bienenhotels und Blühstreifen werden Hochbeete angelegt und ein Gemeinschaftsgarten aufgebaut. Kooperiert wird hierzu mit Vereinen und Schulen vor Ort. Durch die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und Flächenaufwertungen soll ein Bewusstsein für den regionalen Obst- und Gemüseanbau geschaffen und gleichlaufend ehrenamtliches Engagement sowie Nachhaltigkeit gefördert werden.
„HÖRI – MIT“ ist ein Bürgerprojekt, das Mit-Fahrten zwischen der Höri und Radolfzell koordiniert. Um eine stärkerer Nutzung des Angebots zur Bildung von Fahrgemeinschaften zu generieren, plant das Bürgerforum Höri einen Workshop, in dem die strategische Ausrichtung sowie weitere konkrete Maßnahmen erarbeitet werden sollen. Beratung erhält das Bürgerforum zu Fragen des Prozessmanagements.
Die [p3]-Werkstatt betreibt in Freiburg eine gemeinnützige Werkstatt, die Menschen mit Migrationserfahrung auf ihrem Weg in Arbeit oder Ausbildung unterstützt. Als Gemeinschaftsprojekt im Stadtteil Freiburg-Vauban betreibt die Gruppe dazu eine Hydroponik-Forschungsanlage, mit der 3000 Salate und zusätzlich Gurken und Tomaten angebaut werden können - ohne den Einsatz von Erde sondern mit einer wässrigen Nährflüssigkeit. Zusammen mit verschiedenen Akteuren des Quartiers wird die Anlage den Bewohnern des Stadtteils zugänglich gemacht. In moderierten Workshops erhalten die Bewohner eine Einführung in die Anlage, um später selbstständig mit der Anlage zu gärtnern und Lebensmittel für den Eigenverbrauch anzubauen. Die Anlage trägt dazu bei, den Stadtteil nachhaltiger zu gestalten. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Moderation der einzelnen Workshops anfallen.
Begegnung, Hilfestellung und Ideenentwicklung. Und das einfach und gemütlich, während einer Tasse Kaffee im Sonnentreff. Dies ist das Konzept des Ideencafés. Ab dem 6.9.21 sind Carmen Scheich (Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt Leutkirch) Susanne Burger (Herz & Gemüt) Claudia Wahl (Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz) und Katja Baumgardt (Sonnentreff Leutkirch) abwechselnd jeden Montag von 14.00-16.00 Uhr in der Gerbergasse 8 zu finden. Neues Mitglied in der Runde ist Maria Söllner (Integrationsbeauftragte). Sie unterstützt das Team zu besonderen Anlässen.
Ziel ist der Dialog mit den Bürgern in und um Leutkirch. Egal ob Ideensammlung, was an Angeboten noch fehlt, oder ob man selbst ein Angebot starten möchte. Zudem dient es als einfacher Austausch, wenn man ein Ehrenamt
Die alte Schule in Warmbach ist ein historisches Gebäude im Dorfkern, welches aktuell den Vereinen und der Bevölkerung als Ort der Begegnung und Orientierung dient. Trotz der hohen Sanierungskosten begrüßen die Einwohner*innen die Idee, ein neues Konzept zur öffentlichen Nutzung zu erarbeiten und mittels einer Ideenwerkstatt ein Nutzungskonzept zu erstellen. Die Beratung erfolgt zu den Themen Beteiligungsformate, Gemeinschaftsbildung und Werkzeuge zum kollaborativen Arbeiten, sowie zum Systemverständnis unseres Ökosystems.
Die Ideenwerkstatt ist eine Initiative von ehemaligen entwicklungspolitischen Freiwilligen. Wir wollen globale- und wirtschaftliche Zusammenhänge in interaktiven Workshops an Schulen und mit Jugendgruppen erlebbar zu machen und durch künstlerische Aktionen ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Unsere Vision ist eine friedliche, bunte Welt in der sich alle Menschen frei begegnen können.
Die Projektsteuerungsgruppe hat sich zusammen geschlossen, um in einem Bürgerbeteiligungsprozess die Nutzung eines Quartiersraums in einer Senioren-Residenz für den Stadtteil zu entwickeln. In der Steuerungsgruppe sind Vertreter der Kirchengemeinde, dem Kindergarten und der Ev. Heimstiftung, die die Residenz betreibt. Weitere ehrenamtliche Bürger sollen zur Beteiligung an diesem Quartiersprojekt gewonnen werden. Ziel des Projektes ist es, im infrastrukturschwachen Wohngebiet einen Raum für Begegnung zu schaffen. Erste Angebote sind in Planung, die in drei Bürger-Workshops weiterentwickelt werden.
Ein bestehender urbaner Garten wird zu einer Klimagärtnerei von und für die Nachbarschaft ausgebaut. Damit werden fünf Hauptziele verfolgt, die Erhaltung und Vermehrung von Saatgut, Herstellung von Setzlingen, Anbau von Lebensmitteln, Ernten auf Streuobstwiesen sowie aktivierende und persönliche Ansprache der Bürgerschaft. Der urbane Garten dient als Lernort für die Nachbarschaft, die angrenzende Schule und die Kindertagesstätte. Mittelfristige Ziele sind Nachbar*innen mit Saatgut und Pflanzen für Beete, Gemeinschaftsgärten und Projekte der Essbaren Region Stuttgart zu versorgen. Damit einher geht die Sensibilisierung der Nachbarschaft für den Zusammenhang des Klimawandels mit Ernährung.
Kleine Wildnis Stuttgart | Projekt für eine Essbare Region Stuttgart
Auf einem Barcamp 2021 in Bietigheim (Baden) referierte Laurent Riche, Bürgermeister der Gemeinde Kingersheim im Elsass, über die dortigen Bürgerräte. Daraufhin organisierten einige Teilnehmer*innen einen Besuch vor Ort, der sehr beeindruckend war. Als Resultat fanden sich einige Bürger`*innen zusammen, die gerne bei den anstehenden Projekten (Dorfentwicklung, Wärmeplanung) die Ortsverwaltung unterstützen würden. Aktuell planen wir eine Informationsveranstaltung zur örtlichen Wärmeplanung. Eingeladen sind Bürgerinnen und Bürger, Experten verschiedener Bereiche und Vertreter der Verwaltung.
Wir sind eine Gruppe von Bürger*innen in der Gemeinde Bietigheim (Baden) bei Karlsruhe. Wir setzen uns dafür ein, dass auch unsere Verwaltung und der Gemeinderat sich mit dem Instrument \"Bürgerrat\" als Gefäß für eine breitere Mitwirkung der Bevölkerung auseinandersetzen und es unterstützen.
Der ERSTE Beratungsgutschein wird für die Realisierbarkeit von Projekten unter fachkundiger Begleitung genutzt. Hier geht es um die Entstehung eines Treffpunkts für alle Generationen sowie um eine tragfähige Struktur für die organisierte Nachbarschaftshilfe.
Die Gruppe "feministisches Dorfgeflüster" sorgt für einen Platz zum feministischen Austausch und Aktivismus auf dem Land und hilft dabei, Menschen auf einer neuen Ebene zu verbinden. Das Lernen aus geteilten Inhalten und Erfahrungswerten anderer, sowie der Reflexion eigener trägt zur Gendersensibilisierung bei und motiviert zum Handeln und Umdenken. Alteingesessene Strukturen werden hinterfragt und aufgebrochen. Die Beratung wird insbesondere bei der Unterstützung bezüglich einer Vereinsgründung, Finanzierungsmöglichkeiten und der deutschlandweiten Multiplikator*innenfunktion (Vereinsgründung, Finanzierungsmöglichkeiten und Vision) erfolgen.
Die Gemeinwohl Ökonomie--GWÖ ist eine Bewegung von Pionierunternehmen, welche mittels der Gemeinwohl Bilanz den gesellschaftlichen Wert ihres unternehmerischen Handelns ermitteln, und der Öffentlichkeit darstellen können.Sie werden durch neue aufgeklärte Käuferschichten, differenzierte Steuersätze und Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge belohnt.
Das Ziel des Projekts ist der Aufbau einer Struktur, die Organisation eines regelmäßigen Betriebs sowie das Erarbeiten einer Hausordnung und die Organisation einer Jugendversammlung. Dafür wird eine professionelle Beratung benötigt.
Die Initiative treibt den Einstieg der Gemeinde in eine klimaneutrale und zukunftsfähige Mobilität voran, mit dem Ziel der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und dadurch Schonung von Ressourcen. Einrichtung einer Mobilitätsstation für E-Fahrräder oder Leihräder, Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel, Definierung der Schulradwege, Etablierung eines E-CarSharing-Angebots, auch für Fuhrparks stehen dabei im Fokus. Der Beratungsgutschein wird zur Organisation von Beteiligungsveranstaltungen und zur Etablierung der Projektidee eingesetzt.
Im Dialog der Kirchengemeinde und der Bürgerschaft wird nach der neuen bedarfsorientierten Nutzung für das ehemalige Pfarrhaus gesucht. Soziale Zwecke der Gemeinde stehen dabei im Vordergrund. Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung des Beteiligungskonzeptes.
Die „Initiative Schlüssel für Alle e.V“ ist ein Verein für gehörlose und hörgeschädigte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wir stehen für ein gemeinsames Bemühen um bessere Verständigungsmöglichkeiten und mehr Selbstbestimmung sowie Partizipation von Menschen mit Sinnesbehinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Die heutigen Möglichkeiten von Integration und kommunikativem Miteinander können uns ein gleichberechtigtes, gemeinsames Leben trotz Sinnesbehinderung ermöglichen.
Ein selbstbestimmtes, von eigenen Bedürfnissen getragenes Leben ist Ziel jedes Menschen. Hörbehinderte Menschen sind da keine Ausnahme. Gerade für sie ist der Entwurf eines selbstbestimmten Lebens Ausdruck eines veränderten Selbstverständnisses. Und er ist zugleich der Kampf gegen kommunik
Die Gemeinde Steinen hat durch ihre Lage gravierende Verkehrsprobleme: Zwei Landesstraßen führen mitten durch das Zentrum, die Linie der Wiesentalbahn und die Bundesstraße trennen die Ortsteile, der Bahnübergang sorgt mit langen Schließzeiten für Staus im Ortskern. Nun entsteht in der Nähe zu Steinen das Zentralklinikum des Landkreises Lörrach, damit gehen verschiedene verkehrstechnische Veränderungen einher, die sich auch auf Steinen auswirken werden. Das Ziel der Initiative „Steinen im Wandel“ ist die Initiierung einer Bürgerbeteiligung, um die Bürgerschaft über die verschiedenen Varianten zu informieren. Im Rahmen dieses Prozesses kommen verschiedene Interessensgruppen zu Wort. Der Beratungsgutschein wird für die konzeptionelle Vorbereitung des Bürgerbeteiligungsprozesses benötigt.
Die Initiative „Bürger für Bürger“ aus Offenburg gründete sich aus dem 2014 durchgeführten Bürgerrat. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ideen, die aus dem Bürgerrat entstanden sind, aufzugreifen, zu ergänzen und umzusetzen. Die Initiative möchte die Themen Mobilität und Nahversorgung vor Ort stärken, indem sie die Einrichtung eines Bürgerbusses plant. Hierdurch sollen alle Menschen, egal welchen Alters, mit welchem finanziellen Hintergrund oder gesundheitlichem Zustand, so lange wie möglich mobil sein können und ihnen damit auch gesellschaftliche Teilhabe und Kontakt ermöglicht werden. Um die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen und das Projekt nachhaltig vor Ort zu verankern, erhält die Initiative Beratung zur Konzepterstellung, rechtlichen Fragen zu Personenbeförderungsscheinen und Beantragung von Zuschüssen.
Die Bürgerinitiative „Wir brauchen wieder einen Dorfladen“ aus Hiltensweiler setzt sich dafür ein, dass die Nahversorgung im Ort durch die Gründung eines Dorfladens wieder gewährleistet wird. Der Arbeitsausschuss, bestehend aus Mitgliedern des Ortschaftsrates, der Kirchengemeinde und der Bürgerinitiative, benötigt Beratung zu den weiteren Planungsschritten im Prozess der Dorfladengründung.
Das Ziel des Projekts ist die Initiierung eines Dorfladens mit einem Café in Hofsgrund, einem Ortsteil der Gemeinde Oberried. Dadurch wird die Nahversorgung gesichert und ein Begegnungsort für den Austausch und soziale Teilhabe geschaffen. Die örtlichen Landwirte sind an der direkten Vermarktungsplattform interessiert. Die Bürgergenossenschaft Oberried stellt ein Fahrzeug zur Verfügung, um die benachbarten Ortsteile/Dörfer mit diesen Produkten zu beliefern. Dabei können auch Fahrgäste in diesem Fahrzeug mitfahren (Bürger-Liefer-Bus). Der Beratungsgutschein wird für die Durchführung einer Basisanalyse eingesetzt.
Der Arbeitskreis „Zeitbankplus Bühl-Rebland“ möchte einen Nachbarschaftshilfe Verein gründen in Form eines ZEITBANKplus Vereins. Dies soll das soziale Miteinander und das generationsübergreifende Miteinander fördern und stellt einen weiteren Baustein des Sozialkonzepts der Gemeinde dar. Beratung wünscht sich der Arbeitskreis zum Aufbau eines ZEITBANKplus Vereins.
Das Mehrgenerationenhaus Zehnscheuer in Deizisau hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Treffpunkt für Jung und Alt zu sein. Wichtig ist ihnen hierbei, generationenübergreifend mit anderen Personen ins Gespräch zu kommen, wie auch das Publikum durch Kurse und Vorträge zu informieren und zu befähigen. Der Zuzug von geflüchteten Menschen nach Deizisau stellt das Gemeinwesen vor Ort vor eine neue Aufgabe. Das Mehrgenerationenhaus möchte sich dafür einsetzen, die zugewanderten Personen in der neuen Situation zu unterstützen, die Sorgen der Bevölkerung wahrzunehmen und neue Strukturen der Kommunikation und der Zusammenarbeit der Freiwilligen zu schaffen. Dies soll in Abstimmung mit dem schon vorhandenen Inklusionsprozess geschehen. Beratung erhält das Mehrgenerationenhaus Zehnscheuer zur Konzeptionierung von Fortbildungsinhalten, Beteiligungsprozessen mit Geflüchteten und der Bevölkerung.
Die Inklusionsinitiative Lenningen möchte Impulse zur Öffnung von Einrichtungen und Angeboten geben. Insbesondere sieht die Initiative noch Handlungsbedarf in der Entwicklung von Angeboten für Menschen mit Behinderung in den Vereinen vor Ort. Auch soll bei der Entwicklung einer Inklusionsagenda die Zuweisung von 150 Menschen mit Fluchterfahrung mitbedacht werden. Beratung wünscht sich die Initiative zur weiteren Gestaltung des Agendaprozesses.
Mariaberg e.V. entwickelt eine inklusive und sozialraumorientierte Jugendarbeit. Die gesamte Bürgerschaft, alle jungen Menschen, die Verwaltung und andere engagierte Initiativen sind eingeladen in einem Stadteilforum über die Nutzung des Jugendzentrums und die Anpassung bzw. Erweiterung der kulturellen Angebote mitzudiskutieren. Beratung erhält die Initiative zu Konzeption und Auswertung des Stadteilforums.
Das Ziel der Initiative ist es, ein bürgerschaftliches Konzept der Interessensgemeinschaft für die Nachnutzung des alten leerstehenden Feuerwehrgerätehauses neben dem Stammheimer Rathaus umzusetzen. Die Bürgerschaft hat sich für ein ehrenamtlich betriebenes Café als zentralen Ort der Begegnung ausgesprochen. Das Thema Inklusion, das unterschiedliche Begabungen und Beeinträchtigungen von Menschen aufzeigt, ist der Interessensgemeinschaft dabei ein besonderes Anliegen. Das Projekt trägt zu einer Belebung der Ortsmitte bei und fördert zudem das kulturelle Leben als Räumlichkeiten für Lesungen, Konzerte, Vereinsfeste oder private Feiern. Beratung zu Beteiligungsformaten, zu Rechtsfragen und in der Projektentwicklung sowie Projektorganisation.
Die Christophorus Gemeinschaft e.V. bietet Menschen mit Behinderungen Arbeits- und Wohnmöglichkeiten. Projektziel des Vereins ist ein inklusives Wohnquartier im Müllheimer Ortsteil Niederweiler. Dabei steht die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum im Vordergrund. Ziel der Beratung ist es, das Projekt mit einem Beteiligungsprozess zu begleiten, eine Trägerschaft zu etablieren und ein Quartiersbüro einzurichten, das die Arbeit vor Ort zukunftsfähig fortsetzt.
Durch Frühstückstreffen von Menschen über 60, die in Stuttgart-West leben, werden im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche niederschwellige Begegnungsmöglichkeiten und ein Raum des Austauschs geschaffen. Isolation und Einsamkeit wird damit aktiv vorgebeugt und Ideen zum Quartier werden gemeinsam entwickelt. Die Ideen für Stuttgart-West werden in einem Folgeschritt an die Kommune weitergegeben. Zudem sollen Kontakte unter den Teilnehmenden zwanglos geknüpft werden können. Ein weiteres Projektziel ist die Gewinnung von Ehrenamtlichen für zukünftige Projekte. Auf die Formate sollen Flipcharts in ortsansässigen Apotheken und Hausarztpraxen hinweisen, auf denen erklärt wird, was die Nachbarschaftsgespräche sind und worum es im Projekt geht.
Die Klimafreunde Lörrach möchten das bürgerschaftliche Engagement im Bereich Klimaschutz fördern. Sie möchten Strukturen schaffen, damit interessierte Bürger sich einbringen können und einen Austausch zum Thema führen. Die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse sollen dann auch zu gemeinsam umzusetzenden Projekten führen. Beratung erhält die Initiative zu Prozessmanagement, Moderation und Öffentlichkeitsarbeit.
Der Freundeskreis Asyl ist aus einer Vernetzungs- und Kooperationsinitiative hervorgegangen. Daraus sind verschiedene Untergruppen zu den jeweiligen Unterstützungsschwerpunkten entstanden: Patenschaften, Sprachen, Café International, Möbelkreisel, Freizeit für Mütter, Fahrradwerkstatt usw.. Ein Koordinationsteam schafft Strukturen für bis zu 100 Engagierte und koordiniert die Absprachen. Das Fernziel des Projektes "Gemeinsam weiter wirken" ist ein integriertes und inklusives Marktdorf. Integration wird als wechselseitiger Prozess verstanden. Deshalb wird eine lebendige Entwicklung in den Kommune mit zahlreichen Akteuren unterstützt. In einer durch externe Fachleute aus der Flüchtlingsarbeit moderierten Veranstaltung, werden die bisherigen Strukturen vor Ort überdacht, gute Erfahrungen weitergeführt und die Verbesserungsvorschläge gemeinsam abgesprochen. Die Gemeindemitglieder werden über das Amtsblatt darüber informiert.
Ziel des Arbeitskreises ist die Entwicklung eines Integrationskonzepts in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Brackenheim. Es sollen Rahmenbedingungen und Leitlinien entwickelt werden. Zudem möchten sich beide Akteure auf ein gemeinsames Ziel verständigen. Beratung ist zur Prozessbegleitung und zu Maßnahmen der Bürgerbeteiligung im Rahmen der Konzeptentwicklung vorgesehen.
Der Verein Therapie Raum e.V. plant gesundheitsfördernde Angebote, Projekte und aufklärende Informationsveranstaltungen zur Förderung der Gesundheitskompetenz im Integrativen Haus der Gesundheit, um professionelle Arbeit mit dem ehrenamtlichen Engagement im Verein als Träger des Hauses zu verbinden. Beratung bekommt die Initiative im Bereich der weiteren Projektentwicklung, -organisation und -durchführung.
Auf der 7,5 ha großen Fläche des ehemaligen Textilunternehmens Lauffenmühle entstehen neue vielfältige Nutzungsvorschläge und -ideen. Im Rahmen der Quartiersentwicklung steht mit dem Projekt der Baustein "Wohnen" im Fokus. Dafür werden Bürger*innen mit einer Bürgerbeteiligung zur Entwicklung eines generationengerechten gemeinschaftlichen Wohnprojekts auf dem Areal inspiriert, das nachhaltig, sozial fair, transparent und bereits in der Planung mit den zukünftigen Bewohner*innen zusammen gestaltet wird. Die Beratung dient der Optimierung des Konzeptes der Bürgerbeteiligung und dem Beteiligungsformat Zukunftswerkstatt.. Der Ablauf des Beteiligungsformats, die Anwendung der Techniken, damit die Veranstaltungen selbst oder mit Unterstützung des Beraters durchgeführt werden und auch bei der möglichen Adaption auf ein funktionierendes digitales Format hilft die Beratung.
Die Initiative etabliert mit ihrem Projekt ein interkommunales Netzwerk zur nachhaltigen Mobilität, welches verschiedene Interessengruppen wie kommunale Vertreter*innen, Arbeitskreise und Bürger*innen einbezieht. Durch dieses Projekt werden Synergien in Stühlingen und Umgebung geschaffen, um nachhaltige Mobilität neu zu denken. Die Beratung bezieht sich auf die fachliche Beratung zur nachhaltigen Mobilität, die Aktivierung verschiedener Akteur*innen und Expertise kommunaler Netzwerkprojekte.
Der interkommunale Bürgerbus "Linzgau Shuttle" soll die Gemeinde Salem und ihre Nachbargemeinden als sozialer Fahrdienst bedienen und die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner erfüllen, die ohne Auto Mitfahrgelegenheit und ÖPNV-Anbindung ihre Ziele nicht erreichen können. Die Kommunen sollen die operative Verantwortung tragen, während der Förderverein den Betrieb organisiert, Kommunikation und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements übernimmt. Der Linzgau Schüttle soll Ende 2019 in Betrieb gehen. Beratung zu Bürgerbus-, Fahrdienst- und Rechtsfragen.
Ziel des interkommunalen Bürgerbusses „Linzgau Shuttle“ ist die Gemeinde Salem und ihre Nachbargemeinden als sozialer Fahrdienst zu bedienen und die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner zu erfüllen, die ohne Auto Mitfahrgelegenheit und ÖPNV-Anbindung ihre Ziele nicht erreichen können. Die Kommunen tragen die operative Verantwortung, während der Förderverein den Betrieb organisiert, Kommunikation und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements übernimmt. Fachliche Beratung wird für die Bürgerbus-, Fahrdienst- und Rechtsfragen genutzt.
Die ARGE Kirche Urbach möchte eine interkulturelle Begegnungsstätte schaffen. Das Haus soll Aufenthaltsort, Begegnungsstätte und Ort zum Austausch für Menschen mit Fluchterfahrung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft werden. Ziel der Begegnungsstätte ist es, einen Treffpunkt zu schaffen, an dem Bürger, Schüler und Menschen mit Fluchterfahrung gesellschaftliche Kontakte schließen können.
Der CVJM-Landesverband Baden ist ein Zusammenschluss von über 70 CVJM-Ortsvereinen von Wertheim im Norden bis Lörrach im Süden. Im Projekt „Damit aus Fremden Freunde werden" setzt sich der Landesverband für Geflüchtete in Baden ein. In Kraichtal-Unteröwisheim richtet der Ortsverein in diesem Rahmen eine interkulturelle Weihnachtsfeier aus. Die Feier stärkt das bestehende Netzwerk zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten vor Ort. Die Weihnachtsfeier ist Teil einer Reihe von Begegnungsveranstaltungen in Kraichtal, wobei die Geflüchteten jeweils aktiv in die Veranstaltungsdurchführung mit eingebunden werden. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit der Ausrichtung der Weihnachtsfeier anfallen.
Der Arbeitskreis Asyl in Altdorf plant einen interkulturellen Garten. Das "Gärtnern" soll als Medium genutzt werden, um Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenzubringen und zum Austausch und zum Gespräch einzuladen.
Der Badisch-Kamerunisch e.V. setzt sich für nachhaltige und soziale Projekte in Kamerun und Baden sowie zur Völkerverständigung ein. In Kooperation mit dem Familienzentrum übernehmen sie die Koordination der Integration in der Gemeinde Forst.
Um gesellschaftliche Aktivitäten nach dem Corona-Lockdown wieder zu beleben, organisiert der Verein ein Fest mit dem Ziel das Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde Forst zu stärken. Mit dem interkulturellen kamerunischen Abend können Bürger*innen die kamerunische Kultur kennenlernen und mögliche Barrieren abbauen. Migrant*innen aus einer Anschlussunterkunft werden eingeladen, kostenfrei am Fest teilzunehmen, da sie momentan sehr isoliert vom gesellschaftlichen Leben sind. Mit der Veranstaltung wird der Startschuss für eine Reihe an Veranstaltungen in Kooperation mit dem Familienzentrum gesetzt.
Das Projekt „Lebensgarten – mit Freude die Natur erleben“ beinhaltet die Planung, den Bau und die Pflege eines Gemüse-, Kräuter und Obstgartens auf dem „Weidenhof“ nach permakulturellen Richtlinien. Das soziale, physische und psychische Wohlbefinden der Menschen wird dadurch positiv steigen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Region, unterschiedlicher Herkunft und Kulturen, mit und ohne Behinderung werden bei dem Ausbau des Gartengeländes und dessen Pflege aktiv miteinbezogen. Das Projekt versteht sich als Brücke zwischen einheimischen Familien und Familien mit Migrations- und Fluchthintergrund, die sich in Deutschland zurechtzufinden beginnen. Die Beratung wird zur Planung und Umsetzung des nachhaltigen Permakulturgartens benötigt.
Die internationale und generationsübergreifende Kochgruppe fördert den interkulturellen Austausch und macht die vielfältigen Küchen der Welt erlebbar. Die gesammelten Rezepte der Kochgruppe werden in einem Kochbuch herausgegeben. Neben internationalen Rezepten werden auch die Hintergründe der Teilnehmer aus Bulgarien, Indonesien, Türkei, Philippinen, Israel und Deutschland erläutert.
Der "Freundeskreis für Flüchtlinge in Fellbach" ist 2014 zur Unterstützung von Geflüchteten gegründet worden. In verschiedenen Formaten unter der Woche wird seitdem der Kontakt zu Geflüchteten aufgebaut und gehalten. Die Mitglieder unterstützen die Geflüchteten in verschiedensten Alltagssituationen. Ein Format des Freundeskreises ist das einmal wöchentlich angebotene Internationale Begegnungscafé von und für Frauen mit und ohne Fluchterfahrung. Im Format werden verschiedene gesellschaftlich relevante Themen im Rahmen eines abwechslungsreichen Programms behandelt. Das Programm wird durch eine Vorbereitungsgruppe ausgearbeitet und mit den Mitgliedern des Cafés vor der Veröffentlichung in der lokalen Presse gemeinsam diskutiert. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für eine kontinuierliche Kinderbetreuung anfallen. Gerade geflüchteten Frauen soll durch die Betreuung der Zugang zum Format erleichtert werden.
Die Bürgerstiftung Gomaringen führt zahlreiche Projekt bürgerschaftlichen Engagements durch. Zu den letzten Projekten gehören Spielplatzbau, Einrichtung und Betrieb eines Bürgerbuses, Aufstellen von Sitzbänken und Wildbienenhäuser. Da die Bürgerstiftung ihre Aktivitäten aus Spendenmitteln finanziert ist eine ansprechende Präsentation der Projekte zum Einwerben von Spenden wichtig. Darüber hinaus können auf diese Weise weitere Menschen zur Mitarbeit ermutigt werden. Dazu wird die vorhandene Webseite überarbeitet, die Einbindung von Livestreams möglich gemacht und ein Buchungsformular für den Bürgerbus integriert. Zukünftig werden Livestreams und Videos erstellt, um so die Bürger*innen auch aktuell stärker beteiligen zu können. Dazu ist eine professionelle Plattform und Hosting notwendig sowie das Einrichten und Hosten der neu überarbeiteten Webseite.
Die Initiative bildet eine Projektgruppe zur Barrierefreiheit aus betroffenen und interessierten Bürger*innen, ermittelt den Ist-Zustand in Jettingen, wertet die Informationen aus und informiert über die derzeit bestehende Barrierefreiheit. Die Beratung erhält die Initiative für die Sammlung der Daten und bei der Unterbreitung und Umsetzung von barrierefreien Lösungen.
Gemeinsam für MORGEN setzt sich gemäß seines Namens für Mobilität, Offenheit, Regionalität, Generationengerechtigkeit, Energie und Nachhaltigkeit im Wandel der Zeit ein. Dabei spielt die Kooperation mit anderen Akteuren und die Vernetzung eine wichtige Rolle.
In einem Kooperationsprojekt mit der Lebenshilfe Breisgau, der Mission Grün und der Gemeinde Bötzingen soll eine öffentliche Grasfläche in einen vielfältigen, robusten und nachhaltigen Staudenmischgarten umgestaltet werden. Zudem werden an diesem Aktionstag gemeinschaftlich Bäume gepflanzt. Hierbei wird Nachhaltigkeit und soziales Miteinander verbunden.
Die Initiative „New Point“ aus Bad Schussenried verfolgt das Ziel, jugendkulturelle Angebote in der Stadt zu initiieren und zu unterstützen. Dazu möchte sie ein tragfähiges und nachhaltiges Netzwerk zur Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und den Vereinen vor Ort aufbauen. Um dies zu erreichen, soll ein Beteiligungskonzept für Kinder und Jugendliche aus Bad Schussenried gemeinsam erarbeitet werde. Beratung bekommt die Initiative zu den Fragen: Wie kann aktive Beteiligung vor Ort realisiert werden? Wie kann man möglichst alle Personen der angesprochenen Zielgruppe erreichen? Was macht ein tragfähiges Netzwerk aus und was braucht es, um dieses nachhaltig zu installieren?
Das Jugendparlament Bad Säckingen möchte durch ein Jugendforum politische Bildung und eine Beteiligung am kommunalpolitischen Geschehen breiteren Schichten Jugendlicher zugänglich machen. Beraten und begleitet werden sie dabei zum Thema politische Einbindung von Jugendlichen in politische Prozesse.
Der Verein für kommunale Jugendarbeit und Bürgerengagement Schramberg e.V. möchte zielgruppenspezifische Beteiligung für Schramberger Jugendliche an Schulen anbieten. Dazu erhält der Verein Beratung zur Erarbeitung von Methoden zur Umsetzung von Jugendbeteiligung.
Der Stadtjugendring Lörrach möchte das Jugendengagement in Lörrach fördern und unterstützen. Dazu sollen Jugendliche von Anfang an mit in die Prozesse eingebunden und das Jugendparlament durch zahlreiche Aktivitäten unterstützt werden. Beratung erhält der Stadtjugendring zu Fragen der Projektentwicklung und zum Projektmanagement.
In Herrenberg wird eine neue Parkanlage geplant. Um hierbei auch möglichst viele Jugendliche in die Planung miteinzubeziehen, haben die bereits engagierten Jugendlichen eine online-Beteiligungsplattform entwickelt sowie offline Methoden zur Beteiligung genutzt.
"KulturGUT e.V. hat in Kooperation mit dem Landkreis Tübingen das erinnerungskulturelle Projekt Jugendguides entwickelt. Jugendliche und junge Erwachsene werden in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv und Kreisjugendreferat zu Multiplikator*innen der Erinnerungskultur vor Ort ausgebildet. Sie geben ihr Wissen nach dem Peer-to-peer Prinzip weiter und nutzen dabei Zugangsweisen der offenen Jugendarbeit. Nach abgeschlossener Qualifizierung können die Jugendlichen eigenständig in kleinen Teams Stadtgänge für Gruppen durchführen.
Aktuell ist das Projekt auf der Homepage des Landkreises Tübingen unter vielen anderen Themen aufgeführt. Gerade die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig Internetpräsenz ist. Mit dem Aufbau einer eigenständigen Homepage wird die Reichweite der Jugendguides erhöht und das digitale Spektrum der Erinnerungskultur deutlich erweitert."
Das Jugendhaus hat Jugendliche des Jugendgemeinderates als Moderatoren ausbilden lassen, damit diese als Mentoren zwischen Erwachsenen und Jugendlichen fungieren können.
Der Postillion e.V. ist ein freier und gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rhein-Neckar-Kreis, der junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördert. In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung setzt der Verein ein Projekt um, in dem Jugendliche Ideen für neue Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum in den Gemeinden Wilhelmsfeld und Dielheim entwickeln. Während des Gesamtprojekts wird ein Filmprojekt mit den Jugendlichen umgesetzt, das als Thema ebenfalls die Mobilität vor Ort aufgreift. Das Drehbuch für den Film entwickeln die Jugendlichen zusammen mit einer Fachkraft. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zur Erstellung des Projektfilms anfallen.
Der Postillion e.V. fördert im Rhein-Neckar-Kreis junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung. In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung entwickelt der Verein ein Projekt, in dem Jugendliche Ideen für die Mobilität im ländlichen Raum entwickeln. Vor Ort in den Gemeinden Wilhelmsfeld und Dielheim arbeiten sie an Vorschlägen zum Thema und stellen sie im Anschluss Politikern, Bürgermeistern und Vertretern der Busverbände vor. Während des Projekts wird ein Film am Standort Wilhelmsfeld gedreht, der ebenfalls das Thema Mobilität vor Ort aufgreift. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die professionelle Umsetzung des Films der Jugendlichen anfallen.
Der Freundeskreis Afrika setzt sich für Empowerment, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, globales Lernen und weitere Themen rund um die Agenda 2030 ein. Sie sind Träger des Freiwilligendienstes weltwärts sowie des interkulturellen Promotorinnenprogramms für die Region. Sie haben bereits ein Klimagespräch umgesetzt.
Mit dem Projekt werden migrantische Jugendliche weiter empowert über eine klimagerechte Zukunft von Schwäbisch-Hall nachzudenken. Die Visionssuche erfolgt mit unterschiedlichen Zugängen mit den Mitteln Kunst, Musik und Natur. Die Jugendliche sind bereits in die Vorbereitung involviert und gestalten den Workshop selbst mit.
Der Lenkungskreis „Jugendtopf Marbach“ hat ein Projekt initiiert für Jugendliche und Schüler. Diesen wird ein Budget zur Verfügung gestellt, das sie eigenverantwortlich verwalten können. Das Startkapital von 5000€ wird von der Stadt zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, mehr aktive Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu schaffen und dadurch auch eine Verbesserung der Infrastruktur der Stadt anzustreben. Beratung benötigt der Lenkungskreis zu Fragen der Ansprache von Jugendlichen, Öffentlichkeitsarbeit und Projektdurchführung.
Der Jugendtreff Achern hat gemeinsam mit der Initiative JUMP – Jugend macht Power – ein Jugendhearing initiiert und Workshops angeboten, um Jugendliche zu beteiligen und inhaltlich über politische Beteiligungsformen zu informieren.
Der Jugendtreff Malterdingen hat eine Jugendbefragung durchgeführt, um die Bedarfe der Jugendlichen vor Ort abzufragen.
Jugendliche aus dem Jugendzentrum haben anhand des virtuellen Spiels „Minecraft“ ihre Stadt nachgebaut und so aktiv an der Stadtplanung teilgenommen. Ein gemeinsam erarbeiteter Stadtteil wurde dann dem Gemeinderat und dem Bürgermeister vorgestellt.
Das Jugendzentrum Kehl hat gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat ein Politik Café initiiert, um die Jugendlichen der Stadt ins Gespräch mit Stadträten kommen zu lassen. Im Vorfeld wollen sie über diese Aktion an Schulen informieren.
Das Jugendzentrum hat eine Jugendbefragung durchgeführt und daraus entstandene Projektgruppen zur Verständigung zwischen Jugendlichen und Gemeinderat genutzt.
Das Lösungsorientierte Bildungs-, Beratungs- und Betreuungszentrum (LBZ) St. Anton in Riegel unterstützt junge Menschen und Familien in schwierigen Lebenslagen. Die Integration zugewanderten Familien und einzelner Erwachsener durch kommunales und bürgerschaftliches Engagement schreitet gut voran. Der Ansatz bei minderjährigen Geflüchteten gestaltet sich deutlich komplexer. Im Rahmen von „Junge ImpulsWerkstatt“ wurden junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturen dazu ermutigt ihre Ideen und Überlegungen vorzustellen, um gemeinsam passende Angebote für diese Zielgruppe zu entwickeln. Die Beratung wurde zu Veranstaltungsplanung und Moderation benötigt.
Die LBZ St. Anton in Riegel unterstützt junge Menschen und Familien in schwierigen Lebenslagen. Die Integration zugewanderter Familien und einzelner Erwachsener durch kommunales und bürgerschaftliches Engagement schreitet gut voran. Der Ansatz bei minderjährigen Geflüchteten gestaltet sich deutlich komplexer. Im Rahmen von „Junge ImpulsWerkstatt“ werden junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturen dazu ermutigt ihre Ideen und Überlegungen vorzustellen, um gemeinsam passende Angebote für diese Zielgruppe zu entwickeln. Die Beratung zu Veranstaltungsplanung und Moderation.
Uthukumana Afrika e.V. unterstützt, Opfer von Naturkatastrophen in Mosambik. Sie treten für nachhaltige Entwicklung und Überwachung von Risiken, die sich aus Naturkatastrophen ergeben, und für Bildung im Umgang mit Naturkatastrophen ein. Auf globaler Ebene möchten sie mit Lösungen zur Verringerung des Risikos für Bevölkerungen durch Naturkatastrophen unterstützen. Dabei liegt der Fokus auf der Vermittlung von Wissen über Klimaschutz und Ursache von Klimawandel.
Mit Jugendlichen aus Heidelberg und Beira (Mosambik) findet ein Online-Austausch über die Ursachen und Risiken des Klimawandels statt. Hauptthema ist die Überproduktion, als ein Verursacher des Klimawandels. Mit begleitenden Workshops zu Upcyling wird die Wiederverwertung von Rohstoffen anschaulich. Im Austausch unter den Jugendlichen aus unterschiedlichen Regionen der Welt werden Gefahren thematisiert und vor allem an Lösungen gemeinsam erarbeitet.
Die Kemnater Achsen ist ein Projekt, das bei den Ostfilderner Nachbarschaftsgesprächen entstanden ist und die erarbeiteten Aspekte aufgreift. Die Initiative möchte den Ort mitgestalten, die Integration und die Verbundenheit der Bürgern mit dem Dorf fördern und ein nachbarschaftliches Miteinander schaffen. Dabei ist der erste Schritt das Dorf und seine Umgebung wahrzunehmen und zu erkunden.
Die Initiative entwickelt dazu die Kemnater Achsen, ein Netz von Wegen durch Kemnat und seine Umgebung mit Punkten, an denen jeweils ein Informations-, Betrachtungs- oder Unterhaltungsobjekt zu finden ist. Die Punkte sind mit QR-Codes markiert, die zu einer Webseite mit ausführlichen Informationen zu jedem Wegpunkt führen. Ohne den QR-Code können die Unterseiten der Webseite nicht erreicht werden, da diese "erwandert" werden müssen.
Der Landfrauenverband Reutlingen bietet verschiedene Bildungs- und Förderangebote für Frauen im ländlichen Raum im Landkreis an. Der Verband sieht sich als Sprachrohr aller Frauen in der Region. Beim Kennenlernbrunch in Münsingen kommen interessierte Frauen aus der Region zusammen und erfahren mehr über die Arbeit und die Ziele des Verbandes. Mit einer Fragebogenaktion während der Veranstaltung sammelt der Verband Anregungen, welchen Fokus er bei seiner Arbeit für Frauen im ländlichen Raum zukünftig legen soll. Ziel ist es, mit der Veranstaltung das Netzwerk zu vergrößern und innovative Maßnahmen zu erarbeiten. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten wie die Raummiete finanziert, die im Rahmen der Veranstaltung anfallen.
Der Verein 3 Räuber e.V. setzt sich mit ihrem Engagement für kulturelle und soziale Projekte im ländlichen Raum ein, wobei sich der Schwerpunkt auf zirkuspädagogische Angebote bezieht. Mit dem Projekt möchte der Verein besonders Kinder und Jugendliche ansprechen, um ihnen durch Projekttage beispielsweise das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern nahe zu bringen und den Sanitärbauwagen mit Solarmodulen auszustatten.
Im Leitbild der Gemeinde Gundelfingen ist die Beteiligung junger Menschen als politische Richtschnur formuliert worden. Jugendliche sollen bei Vorhaben, die insbesondere ihre eigenen Interessen berühren, angemessen beteiligt werden. Der Verein „Bürger für Bürger – Bürgertreff Gundelfingen e.V.“ möchte mit Hilfe des Förderprogramms „Gut Beraten“ ein Modell für Jugendbeteiligung und freiwilliges Engagement in Gundelfingen konzipieren und umsetzen.
Der Arbeitskreis Markthalle Weitingen erhält durch das Förderprogramm „Gut Beraten!“ Beratung zur Betreibung einer „Kleinen Markthalle“ in Weitingen, einem Dorf mit 1640 EinwohnerInnen. Die Markthalle soll zur lokalen Grundversorgung beitragen und für weitere Aktionen wie Kunstausstellungen, Veranstaltungen, Adventsmarkt usw. genutzt werden.
Mit dem Projekt wird aufgezeigt, dass jede*r etwas im Klimaschutz bewirken kann. Hierzu startet die Initiative einen Aktionstag, an dem neben Infoständen ein Kulturprogramm, Vorträge, Chöre und Musik zu finden ist. Der Aktionstag spricht unterschiedliche Altersgruppen an, bindet unterschiedliche Akteur*innen des Klimaschutzes ein und zeigt den Menschen, was als Einzelne*r alles möglich ist.
Der Konstanzer Gemeinderat hat pressewirksam den Klimanotstand in der Stadt am Bodensee ausgerufen. Auf der zweiten Konstanzer Klimakonferenz lädt eine Gruppe engagierter Bürger zur Diskussion des Themas Klimaschutz vor Ort ins Konstanzer Konzil ein. Auf der Konferenz entwickeln die Teilnehmer Lösungen, die der Klimanotstand in der Stadt erfordert. Die Besucher erhalten durch Fachvorträge dazu Informationen über die Grundlagen des Klimawandels. Auch für Vernetzung unterschiedlicher aktiver Initiativen und interessierter Bürger bleibt Raum. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit der Ausrichtung der Klimakonferenz anfallen. Dazu zählen zum Beispiel Nebenkosten für das Konzil-Gebäude.
In Reutlingen gibt es neben der lokalen „Fridays for Future Bewegung" eine Elterngruppe: Auch die „Parents for Future" beteiligen sich an der Klima-Aktionswoche, die von der Bewegung ausgerufen wurde. Die Elterngruppe richtet in diesem Rahmen einen Klima-Aktionstag auf dem Reutlinger Marktplatz aus - an einem für die Bewegung typischen Freitag. Vor Ort kommen an diesem Tag verschiedene Organisationen und Unternehmen aus dem Umkreis von Reutlingen zusammen, die den Besuchern Ansätze zu einer nachhaltigeren und klimafreundlicheren Lebensweise aufzeigen. Mit dem Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die am Aktionstag anfallen.
Eine Gruppe von Schöckinger Bürgerinnen arbeitet an der Reduzierung des CO²-Austoßes vor Ort. Nach dem Motto "erstmal vor der eigenen Haustür kehren" will die Gruppe das Thema Klimaschutz für jeden Bürger erfahrbar machen. Klimaschutz ist für die Gruppe nicht nur Sache der Bundespolitik, sondern auch lokale Angelegenheit. Darum richtet die Gruppe eine Klima-Kampagne über mehrere Monate aus, in der örtliche Vereine und andere Gruppen zu Wettbewerben im Bereich Klimaschutz aufgefordert werden. Dazu kommt aktive Aufklärungsarbeit, was jeder Bürger selbst für den Klima- und Umweltschutz vor Ort beitragen kann. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit der Durchführung der Klima-Kampagne anfallen.
Die Initiative Klima und Umwelt hat sich gegründet, um Themen der Klima- und Umweltproblematik zusammen mit Lösungsansätzen einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, zu verstehen und gemeinsam anzupacken. Mit einer nötigen Leichtigkeit im Umgang mit den großen Herausforderungen möchten sie Abwehr- und Ausblendungsreaktionen umgehen und mit Lösungsansätzen und Kreativität den Themen begegnen.
Mit dem Projekt Klimacheck möchten die Initiative Bürger sensibilisieren, dass durch elektronische Geräte Energie verloren gehen kann. Mit Hilfe von Feinmessgeräte und Beratung zur Benutzungsweise kann unnötige Energieverwendung vermieden werden. Viele kleine Verbesserungen können in der Summe auch große Einsparungen erzielen. Bürger können ohne Kosten einen Beitrag fürs Klima leisten.
Die Initiative fördert eine gemeinsame Entwicklung und Verwirklichung von guten Ideen zur Förderung des Klima- und Umweltschutzes in Schöckingen mit Hilfe eines Beteiligungsprozess vor Ort sowie eine Vernetzung und Stärkung der Dorfgemeinschaft. Das Projekt baut auf dem bereits durchgeführten Klimadialog auf, bestehende Aktionen werden dabei vorgestellt und weiterentwickelt, neue Impulse und Mitstreiter*innen kommen hinzu. Die Beratung erfolgt zur Planung, Organisation und Dokumentation des Klimadialogs 2.0.
Zum Klimaforum Schallstadt haben sich Bürger*innen zusammengeschlossen, die den Klimaschutz in ihrer Gemeinde voranbringen wollen. Sie verbindet das Ziel, sich wirksam mit Maßnahmen des Klimaschutzes und Klimaanpassung für die Zukunft vor Ort zu beteiligen und weitere Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Das Klimaforum ermöglicht den Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren, arbeitet generationsübergreifend und stärkt das bürgerschaftliche Engagement. Im Rahmen von Gut Beraten! hat die Initiative das Klimaforum Schallstadt gegründet und entwickelt nun im nächsten Schritt den Klimaaktionsplan Schallstadt 2030. Dieser soll der Öffentlichkeit vorgestellt und erste Maßnahmen und Projekte umgesetzt werden. Für das strukturierte Weiterentwickeln in Arbeitsgruppen wird Moderationsmaterial und für die Vorstellung und Einbeziehung der Öffentlichkeit, Kommunikationsmaterial benötigt.
Die ‘Klimafreunde Lörrach' wollen den Klimaschutz in Lörrach durch Information, Bewusstseinsbildung und Projekte voran bringen.
Der Arbeitskreis „Energie, Ressource und Klimaschutz“ der Lokalen Agenda in Allensbach unterstützt den Ausbau der Elektromobilität in Allensbach. Das Ziel des Projekts ist es, die Elektromobilität in ein klimafreundliches, naturschonendes und soziales Gesamtkonzept für den Verkehr der Zukunft einzubinden, in dem umweltfreundliche Verkehrsarten (Zufußgehen, Fahrrad, ÖPNV) durch umweltfreundlichen elektrifizierten Individualverkehr ergänzt werden. Der Beratungsgutschein wird für die Erarbeitung des Konzepts eingesetzt.
Der Klimaschutzverein setzt sich für ein klimafreundlicheres Leben ein und führt dazu regelmäßig Aktionen durch, die Bürger*innen für das Thema sensibilisieren und aktiv zum Klimaschutz beitragen. Neben Baumpflanzaktionen, Stadtradeln und Ausstellungen, setzen sie sich für ein verbessertes Radwege-Netz und den Ausbau der S-Bahn ein. Für klimafreundliche Mobilität sind folgende Veranstaltungen geplant: Geführte Radtouren zum Thema sicherer Schulweg und Radwegen, Kurse für ältere Menschen zur Nutzung von Apps für Verkehrsverbünde und Baumpflanzaktionen.
Die Initiative Klimaentscheid Aalen setzt sich für die Erarbeitung von Klimaschutzmaßnahmen in Aalen ein und hat bereits einen Einwohnerantrag gestellt, in dem sie fordern, dass Aalen bis 2035 klimaneutral wird. Mit 1.500 Stimmen wurde dieser an den Bürgermeister übergeben.
Dabei ist es der Gruppe wichtig, dass die Einwohner*innen aktiv in die Erarbeitung von Klimaschutzmaßnahmen einbezogen werden.
Die Initiative plant ein Klimagespräch mit der Grundfrage: Aalen klimaneutral bis 2035 - was bedeutet das? In einem Workshopformat werden Ideen und auch Bedenken aus der Einwohnerschaft gesammelt und geclustert. Im zweiten Workshop werden die Themenfelder vertieft und Lösungsansätze entwickelt.
Die Veranstaltungen finden wenn möglich in Präsenz statt, die Verwaltung ist neben den Einwohner*innen, zivilgesellschaftlichen Gruppen auch eingeladen.
Der BUND engagiert sich für ein zukunftsfähiges Land und orientiert sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen. Mit dem Um-Welthaus, als Gemeinschaftsprojekt von Initiativen aus dem Natur- und Umweltschutz, führen sie regelmäßig Ausstellungen, Vorträge und Kurse in Kooperationsprojekten durch. Die Stadt Aalen hat durch einen Gemeinderatsbeschluss entschieden, bis 2035 die Klimaneutralität umzusetzen. Der BUND sieht im Verkehrsbereich noch großen Handlungsbedarf, sodass sie hierzu ein Klimagespräch organisieren, um das Thema zivilgesellschaftlich voranzutreiben. Geplant ist eine zweitägige Veranstaltung mit dem Stadt- und Verkehrsplaner Heiner Monheim. Am ersten Tag findet eine gemeinsame Exkursion mit Mitgliedern der Verwaltung, Polizei, Straßenverkehrsbehörde, politischen Gremien, Verbänden und Bürger*innen auf dem Fahrrad oder Bus zu besonderen Problempunkten und Stellen mit Lösungsansätzen statt. Am zweiten Tag wird das Thema in Workshops vertieft und mit einem Vortrag zur kommunalen Verkehrswende und der Vorstellung der erarbeiteten Ergebnissen abgeschlossen.
Diese Veranstaltung ist der Auftakt zu einem Prozess, um das Thema weiter gemeinsam zu entwickeln.
Der Arbeitskreis Energie, Ressourcen, Klimaschutz der Lokalen Agenda 21 Allensbach setzt sich für die Schonung der natürlichen Ressourcen und für Klimaschutz durch ein gesteigertes Umweltbewusstsein bei den Bürgern ein. Für die Kommune hat der AK bereits einen Klimaplan mit Handlungsfeldern und Lösungsmöglichkeiten entwickelt, der vom Gemeinderat verabschiedet wurde.
In einem Klimagespräch lädt der AK Bürger ein, ins Gespräch zu kommen, wie sie sowie die Gemeinde bei der Energiewende vorankommen und was der Einzelne dazu beitragen kann. Vorschläge der Bürger zum effizienteren Einsatz von Energie sowie Einsparpotenziale werden an Thementischen gesammelt und im Nachgang ausgewertet. Zur Veranschaulichung werden zudem Anbieter von Solar und Wärmepumpen sowie E-Carsharing eingeladen.
Der BUND Althengstett veranstaltet in Althengstett und den umliegenden Gemeinden regionale Klimagespräche im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
kit Jugendhilfe Ammerbuch e.V. veranstaltet als Klimadreieck zusammen mit dem Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz e.V. und der Mitmachzentrale Gerlingen e.V. in Ammerbuch ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Die Bürgerinitiative hat sich zusammengefunden, um Position zu beziehen, gegen die Bebauung eines Naherholungsgebiet mit Einfamilienhäusern, das bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Die Stadt hat Potenzial zur Innenentwicklung, daher befürwortet die Initiative die Nachverdichtung, anstatt Flächen zur CO2-Speicherung dem Klimaschutz und der Landwirtschaft zu entziehen. Eine Unterschriften-Aktion fand Zustimmung in der Bevölkerung, dennoch gibt es in zweiten Teilen der Stadt wenig Bewusstsein für das Thema Flächenschutz und Verdichtung der Innenstädte.
Bei einem Klimagespräch werden diese Themen mit Experten aufgegriffen und Bürger zum Gespräch eingeladen. In Kleingruppen können Aulendorfer Bürger gemeinsam mit den Experten diskutieren und sich austauschen. Nach jedem Impuls gibt es drei Fragen, die in den Kleingruppen besprochen und dokumentiert werden.
Die Projektgruppe "Dorf im Dialog" wurde ins Leben gerufen, da sich die Bürger*innen mehr Dialog innerhalb des Ortes wünschen. Insbesondere wurde der Wunsch geäußert, zum Thema Klimaschutz und Mobilität den Austausch zu verstärken. Auch während der Pandemie wurden Konzepte entwickelt, die unter den Auflagen funktionierten, z.B. Spaziergänge mit Fachleuten zu unterschiedlichen Themen.
Die Gruppe plant ein Klimagespräch mit Bürger*innen der sechs Gemeinden im Hexental, mit dem Ziel ein Klimaschutznetzwerk der Gemeinden im Hexental zu gründen und sich mit interkommunalen Themen auseinander zu setzten. Dies könnte z.B. die Planung einer Fahrradtrasse, einer Bürgerenergiegenossenschaft oder eine Konzeptentwicklung zur Verbesserung des ÖPNVs sein. In einer Workshopveranstaltung werden Vorschläge gesammelt, wie die Gemeinden das Thema Klimaschutz im Hexental gemeinsam angehen können.
Gemeinsam für Morgen veranstaltet in Bötzingen ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Die Ackerflurpaten setzen sich für den Erhalt von Bäumen auf der Feldflur ein. Im vergangenen Jahr haben sie ihre Aktivitäten mit dem Projekt "Ackerflur mit mehr Natur" über Crowdfunding gestartet und dabei den Austausch zwischen Bürger*innen und Landwirt*innen initiiert.
Dieser Dialog soll im Klimagespräch fortgesetzt werden und im Austausch zwischen Bürger*innen und Landwirt*innen Lösungen entwickelt werden, wie der Baumbestand erhalten werden kann, bzw. wie mehr Bäume gepflanzt werden können.
Das Klimagespräch umfasst Information zur Bedeutung von Feldgehölzen als klimarelevanter Faktor, die Aufbau von beidseitigem Verständnis für die Themen und Entwicklung von Formen, wie Landwirt*innen bei der Pflege der Bäume unterstützt werden können.
Im Vorfeld des Klimagesprächs werden Erstgespräche mit den Landwirt*innen geführt, um sie für die Thematik zu gewinnen.
Digitales Klimagespräch zum Thema "Feldgehölze" am 29.07.21 von 18 - 19:30 Uhr
Presseartikel der Badischen Zeitung
Der Heimatverein unterstützt engagierte Bürger, eigene Ideen vor Ort umzusetzen,
um Lebensqualität zu stärken und zu erhalten. Ziel ist die Initiierung von Bürgerprozessen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zum Erhalt der dörflichen Strukturen, des Umwelt- und Naturschutzes.
Die Arbeitsgruppe "Heimat beginnt jetzt" organisiert ein Klimagespräch, um die Möglichkeiten aufzeigen, wie die dörfliche Gemeinschaft sowohl klimagerecht, wie auch nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt werden kann. Aus einer Themenanalyse sind bereits Handlungsfelder identifiziert, die Bürger bei der Veranstaltung ergänzen und diskutieren können. Dabei werden konkrete Projekte vorgestellt und entwickelt. Ziel ist es, dass sich Bürger in Arbeitsgruppen organisieren und die Themen gemeinsam voranbringen.
Die Arbeitsgruppe befasst sich mit Thema, wie Landwirtschaft zum Klimaschutz beitragen kann. Themenschwerpunkte sind Agri-PV, Ausbau Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Gebäuden, effektive Nutzung von Biogas, CO2 Bindung durch Humusaufbau und Methanreduktion in der Tierhaltung.
Die Gruppe organisiert ein zweiteiliges Klimagespräch. Beim ersten Gespräch in Form eines Runden Tisches mit aktiven Landwirten aus den Landkreisen Freudenstadt und Calw wird der aktuelle Stand besprochen sowie Zielkonflikte thematisiert. Voraussetzungen und nächste Schritte werden verabredet. Bei der zweiten Veranstaltung steht der Dialog zwischen Landwirten, Bürger*innen und Vertreter*innen des Umwelt- und Naturschutzes im Mittelpunkt. Hier werden Vorbehalte abgebaut und Zielkonflikte gemeinsam bearbeitet. Um ein konstruktives Gespräch zu führen, legt die Arbeitsgruppe Wert auf Präsenzveranstaltungen.
Der VCD setzt sich für umweltfreundliche Mobilität ein und für die Interessen von Bus- und Bahnfahrenden, Fußgängern und Radfahrern.
Auftakt zum Klimagespräch ist eine Lesung der Autorin Katja Diehl mit ihrem Buch "Autokorrektur. Mobilität für eine lebenswerte Welt". Aufgeworfene Themen der Mobilitätswende werden anschließend in einem Klimagespräch vertieft. Ziel ist das Erarbeiten von Umsetzungsideen für eine Verkehrsentlastung. In einem World Cafe werden konkrete Ansätze weiter bearbeitet wie Radschnellweg, Mobilitätsstationen, Carsharing und andere.
Die Klimawerkstatt Dossenheim veranstaltet in Dossenheim ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Die Klimainitiative Edingen-Neckarhausen setzt sich dafür ein, dass ihr Ort bis 2035 klimaneutral wird. In diesem Zusammenhang planen sie die Gründung eines Bürger*innenrat, der Vorschläge zu Klimaschutz-Maßnahmen erarbeitet und Kontrollinstanz für den Gemeinderat und -verwaltung ist. Die Initiative basiert auf demokratischen und freiheitlichen Werten sowie gesellschaftlicher Teilhabe.
Im Klimagespräch mit externen Referent*innen werden Bürger*innen zu Klimaschutzaktivitäten ermutigt und zum Handeln motiviert. Die Teilnehmenden entscheiden die wichtigsten drei Handlungsfelder im Bereich Klimaneutralität vor Ort. In diesen Feldern werden gemeinsam Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität erarbeitet und dem Gemeinderat und -verwaltung vorgestellt.
Die AG Agenda 21 Ehingen veranstaltet in Ehingen ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Der Förderverein der UNESCO Schule GHSE Emmendingen bringt aktuelle Themen in die Schulgemeinschaft ein und engagiert sich dazu mit Aktionen.
Mit einem Klimagespräch in Form eines Klimaplanspiels werden die Schüler*innen für das Thema Klimaschutz sensibilisiert und motiviert sich im Rahmen von Bürger- und Jugendbeteiligungsformaten für das Thema weiter einzusetzen. Schüler*innen der 10. Klasse, die aus dem gesamten Landkreis Emmendingen kommen, können spielerisch in die Rolle der verschiedenen Akteuren und Stakeholder im Bereich Klimaschutz einsteigen und Lösungsideen entwickeln. In einer Auswertungs- und Transferphase wird das Planspiel auf die reale Situation des Landkreises Emmendingen adaptiert. Klimamanager des Landkreises, Expert*innen aus Verbänden, Politik und Fachstellen sind dafür als Gesprächspartner*innen dabei, um machbare Lösungsstrategien zu erarbeiten.
Das Klimagespräch zum Thema "Klimaneutraler Landkreis Emmendingen" wird gemeinsam von der Klimafit-Initiative Emmendingen und dem Förderverein SolarRegio e.V. durchgeführt und von weiteren sechs Organisationen unterstützt.
Ziel des landkreisweiten Klimagesprächs ist die Förderung des Austauschs, neue Bürger*innen zum Mitmachen durch Informations- und Vernetzungsarbeit zu gewinnen sowie die Planung von kreisweiten Aktionen. Das Klimagespräch teilt sich in zwei Treffen auf. Beim ersten Termin (online) geht es um die Einführung in ehrenamtliches Engagement für Klimaschutz und die Vorstellung bestehender Initiativen sowie Tipps für Neugründung. Beim zweiten Termin (präsent, wenn möglich) findet ein World-Cafe mit sechs Thementische statt. Erfolgreiche Projekte werden vorstellt und neue Projektideen gesammelt. Ergebnis wird ein Projekt-Ideen-Rucksack sein, der für die weitere Arbeit genutzt werden kann.
Die Initiative Klimabürger:innrat Region Freiburg hat einen interkommunalen Bürgerrat in der Region Freiburg angestoßen, bei dem sich neben der Stadt Freiburg 15 weitere Gemeinden beteiligen. In Abstimmung zwischen den kommunalen Verantwortlichen und der Initiative wurde der Schwerpunkt auf 100% erneuerbare Energien für den Klimabürgerrat festgelegt. In fünf Sitzungen und mit Unterstützung von verschiedenen fachlichen Experten wurden 48 Umsetzungsempfehlungen erarbeitet und in einem Bürgergutachten zusammengefasst. Den 16 Gemeinderäten wird dieses Gutachten nun vorgestellt. Die Umsetzung der Empfehlungen sollen durch regionale Klimagespräche unterstützt werden. Zum Klimagespräch in Emmendingen werden alle interessierten Bürger des Landkreises eingeladen, um zu den Umsetzungsempfehlungen ins Gespräch zu kommen. Die Vernetzung der örtlichen Klimaschutzinitiativen werden gestärkt und in die Vorbereitung einbezogen. Auch alle Bürgermeister und Kreis- und Gemeinderäte im Landkreis werden eingeladen, um die Schnittstelle zur Politik zu bilden.
Die Parents for Future Esslingen setzten sich für konsequenten Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. Ihr Fokus liegt auf dem Engagement zur Energie- und Mobilitätswende, dazu arbeiten sie in Arbeitskreisen und mit anderen Gruppen zusammen und suchen das direkte Gespräch mit Bürger*innen und Vertreter*innen der Stadt.
Bei Klimagesprächen an einem Platz in der Esslinger Altstadt kommen Parents for Future in direkten Kontakt und ins Gespräch mit Bürger*innen. Gesprächsanlass bietet eine Klimawaage, in deren Waagschale die Passant*innen Steine reinlegen können, je nachdem wie sie zu der jeweiligen Fragestellung zu Klimathemen stehen. Zielgruppe dabei sind alle Bürger*innen, da das Thema alle betrifft, daher ist das Gesprächsformat auch sehr niedrigschwellig gewählt.
Die Klimagesprächsaktion ist an mehren Terminen geplant. Die Ergebnisse werden gesammelt und daraus weitere Maßnahmen entwickelt.
Die Initiative GoodFood hat sich zum Ziel gesetzt Wissen, Erfahrung und Begeisterung rund um das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung anderen Menschen zugänglich zu machen, da die Auswirkung von Ernährung auf das Klima einer der Hauptfaktoren ist.
Mit einem Klimagespräch möchte die Gruppe verschiedene Akteure über das Thema Klima und Ernährung in den Dialog bringen. Hierzu lädt die Gruppe in den Bürgersaal ein, bezieht Kooperationspartner*innen mit ein, erarbeitet eigene didaktische Mittel zur Veranschaulichung des Themas und legt den Fokus auf eine breite Beteiligung.
Der Badisch-Kamerunisch e.V. hat zum Ziel nachhaltige und soziale Projekte in Kamerun und haben zu unterstützten und sich für Völkerverständigung und kultureller Austausch zwischen Baden und Kamerun einzusetzen.
Als Partnerschaftsverein setzt sich der Badisch-Kamerunischer e.V. für grenzüberschreitenden Klimaschutz ein. Sie möchten mit dem Klimagespräch Klimaschutz unter Berücksichtigung der globaler Perspektive thematisieren. Es finden zwei Klimagespräche statt, das erste hat den Fokus auf der Bestandsaufnahme von Klimaschutzaktivitäten in Forst und der Situation in Kamerun. Beim zweiten Klimagespräch liegt der Schwerpunkt auf der Ideenentwicklung und Projektplanung von Klima- und Partnerschaftsprojekten. Kooperationspartner sind der BUND, die interkulturelle Promotorin und die Gemeinde Forst.
regio Wasser e.V. veranstaltet in Freiburg ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Der Ernährungsrat Freiburg und Region e.V. veranstaltet in Freiburg ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Der Solawi Bodensee e.V. betreibt solidarische Landwirtschaft, bei der die Mitglieder den Betrieb finanzieren, mithelfen und sich die Ernte teilen. Ihr Anliegen ist es, eine Verbindung zur Lebensmittelgewinnung und -verteilung herzustellen und dabei gemeinwohlorientiert und nachhaltig zu handeln.
Thema des Klimagesprächs ist der Gemüse- und Obstanbau vor der Haustüre. Es geht um den lokalen Nahrungsmittelanbau, die eigenen Möglichkeiten des Urban Gardenings und um die Vernetzung von bereits Aktiven und denen, die es werden wollen. Zielgruppe sind alle, die Urban Gardening betreiben möchten, Vereinsmitglieder, Kleingärtner*innen, Biobauern, andere Solawis, Pädagogische Hochschule und Schulen.
Mitmachzentrale Gerlingen e.V. veranstaltet als Klimadreieck zusammen mit dem Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz e.V. und kit Jugendhilfe Ammerbuch e.V. in Gerlingen ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Die Göppinger Parents for Future Gruppe setzt sich analog zur Fridays for Future Bewegung für mehr Klimagerechtigkeit und Klimaschutz ein. Sie beteiligen sich beim ersten Klimathon in Göppingen und organisieren in diesem Rahmen ein Klimagespräch. Vom 05.06.-18.07.2021 findet unter dem Motto "42, 195 Tage für mehr Klimagerechtigkeit" der Klimathon statt, der alle Bürger*innen zum mitmachen einlädt. Bei diesem Wettbewerb treten Schulen und Stadtbezirke via einer App "Klimakompass" gegeneinander an, um Bewusstsein und Anreiz zur CO2 Reduktion zu schaffen. Weitere Begleit- und Mitmachveranstaltungen finden in diesem Rahmen statt.
Die Klimagespräche finden über drei Wochen hinweg statt und orientieren sich an der Design Thinking Methode. Sie bestehen aus den drei Blöcken: Klimawanderungen an sechs Tagen, Klimagespräch und Phase der Weiterentwicklung der Projektideen. Während der Klimawanderungen regen Reflexionsfragen auf Schildern zu Gesprächen über das Klima an. Das eigentliche Klimagespräch findet als 4-stündiger Workshop statt. Danach werden die Ideen weiterentwickelt und zur Antragstellung gebracht.
Die Initiative Klima Dialoge veranstaltet in Heidelberg ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Das Mehrgenerationenhaus Heidelberg (HABITO) veranstaltet in Heidelberg ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Der BUND Herbolzheim setzt sich für Natur- und Umweltschutz ein und organisiert zu diesem Ziel ein Klimagespräch. Dem Klimagespräch wird eine Autorenlesung des Buches "2,5 Grad - Morgen stirbt die Welt vorangestellt, die in das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einführt. Die angesprochenen Themen des Buches (Extremwetterereignisse, kommunaler Klimaschutz und Greenwashing) werden im Klimagespräch mit Bürger*innen diskutiert und auf das lokale Umfeld transferiert.
Die Arbeitsgruppe engagiert sich im Rahmen der Initiative Zukunft Hinterzarten für den Bereich Umweltschutz, Energie- und Verkehrswende. In einer detaillierten Untersuchung hat die Gruppe einen erheblichen Rückstand beim Ausbau von Photovoltaik in Hinterzarten im Vergleich zu Nachbargemeinden festgestellt.
Mit einem Klimagespräch lädt die Arbeitsgruppe Jugendliche und Erwachsene ein, über Probleme und Chancen des Klimaschutzes in Hinterzarten zu diskutieren. Vorgesehen sind drei Veranstaltungen und eine Exkursion, dabei sind folgende Themen vorgesehen: Chancen und Herausforderungen Klimaschutz in Hinterzarten, konkretes Handlungsfeld Ausbau Photovoltaik, bürgerschaftliches Engagement Klimaschutz in der Gemeinde. Mit einer Themenfeldanalyse werden die wichtigsten Handlungsfelder im ersten Termin bestimmt, im zweiten das konkrete Anwendungsfeld Photovoltaik thematisiert und im letzten ein praktisches Beispiel der alternativen Energiegewinnung als ein übertragbares Beispiel für Hinterzarten besucht.
Der Runde Tisch Lörrach ist offen für alle Bürger*innen und hat die Klimaneutralität der Stadt zum Ziel. Mit unterschiedlichen Projekten trägt er zur Verringerung des CO2-Ausstoßes bei und ermutigt Bürger*innen sich aktiv an der Reduzierung zu beteiligen. Dazu vermittelt er Wissen und trägt zur Bewusstseinsbildung bei.
Der Runde Tisch plant eine Veranstaltungsreihe von Klimagesprächen mit dem Titel Als Gesellschaft dem Klimawandel begegnen. Zu den 4-5 Veranstaltungen werden Bürger*innen, Politiker*innen und Vertreter*innen des Gemeinderates und der Verwaltung eingeladen. Mit dem Klimagespräch wird der Dialog zwischen allen Akteuren initiiert und gemeinsam konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Reduktion von CO2 in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Ernährung, Konsum erarbeitet.
Die Initiative Klima Dialoge veranstaltet in Mannheim ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Murg im Wandel ist eine bürgerschaftliche Initiative, die dem Transition Town Gedanke verbunden ist. Sie orientiert sich an der Transition Charta und arbeitet partnerschaftlich mit den politischen Gremien um der Verwaltung der Gemeinde Murg sowie mit anderen Gruppen zusammen.
Das Klimagespräch hat den Fokus auf nachhaltige Mobilität, als großer Baustein zum Klimaschutz. Die Gemeinde Murg hat sich schon seit einige Jahre mit dem Thema nachhaltiger Mobilität beschäftigt. Im Leitbild der Gemeinde und im Klimaschutzkonzept ist das Thema gesetzt und in einem Workshop bereits erste Lösungsansätze für nachhaltige Mobilität erarbeitet.
Im Klimagespräch werden die Erkenntnisse und Maßnahmen, die bereits im vorhergehenden Workshop erarbeitet wurden, dargestellt und erläutert. Diese Maßnahmen sollen im Gespräch konkretisiert und anhand ihrer Umsetzbarkeit priorisiert werden. Ergebnisse des Klimagesprächs können die Basis für ein Mobilitätskonzept bilden.
Die Initiatoren von Oberkirch mobil setzen sich für ein verbessertes Mobilitätsangebot ein, um in Zukunft auf ein Auto verzichten zu können. Für Mobilität im ländlichen Raum sehen sie den Bedarf, die vorhandenen Infrastruktur besser zu vernetzen.
Um weitere Bürger*innen für das Thema zu sensibilisieren und die Gruppe zu vergrößern sind folgende Maßnahmen geplant: Mobilitätstag mit Vorträgen und Ausprobieren von unterschiedlichen Formen der Mobilität, um Begeisterung für das Fahren von E-Bikes, Lastenfahrrädern und Carsharing-Elektroautos zu erreichen, Diskussion über Verbesserung der Radwege und Ermittlung von geeigneten Standorten zur Errichtung von Mobilitätsstationen.
Hierbei steht der direkte Austausch mit den Bürger*innen und die persönliche Abfrage im Vordergrund. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse und Bedarfe werden bei den Klimagesprächen berücksichtigt.
Beim Klimagespräch im Frühjahr werden neben den Bürger*innen auch Vertreter*innen der Stadt Oberkirch dabei sein, um eine koordinierte Mobilitätswende erreichen zu können.
Das Netzwerk 70599.Lebenswert versteht sich als Plattform für lokale Gruppen, Initiativen und Bürger, die an der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitszielen arbeiten. Alle Projekte werden grundsätzlich mit Netzwerk- und Kooperationspartnern durchgeführt.
Unter dem Titel 70599.Klimaneutral veranstaltet die Initiative ein Klimagespräch, um das angestrebte Ziel der Stadt Stuttgart bis 2030 klimaneutral zu werden, lokal in den Stadtbezirken Plieningen und Birkach zu thematisieren. Ort des Klimagesprächs ist das Alte Rathaus in Plieningen. In Arbeitsgruppen werden zu den Themen Energie, Mobilität, Umweltschutz und Ernährung Lösungsansätze erarbeitet. Die Ergebnisse werden dokumentiert und veröffentlicht. Der lokale Politik werden sie vorgestellt und fließen in zukünftige Planungen und Aktionen des Netzwerkes ein.
Parents for Future Singen/Radolfzell veranstaltet in Radolfzell ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Die NaturFreunde Rastatt gehören dem sozial-ökologischen und gesellschaftspolitischen aktiven Verband für Umweltschutz, nachhaltigen Tourismus, Sport und Kultur an.
Mit dem Klimagespräch thematisieren sie Klimagerechtigkeit und leiten daraus Handlungsoptionen vor Ort ab. Die NaturFreunde Rastatt haben eine kommunale Klimapartnerschaft mit einer senegalesischen Stadt Saint-Louis initiiert und diskutieren mit dem Klimagespräch Klimagerechtigkeit in Bezug auf die Beziehung zwischen Nord-Süd. Das Gespräch findet auf dem Rastatter Marktplatz statt, Experten und Bürger kommen hier gemeinsam ins Gespräch.
Die Wald Initiative Renningen zeigt auf, wie der Waldbestand mit Ansätzen der Biodiversität, Artenvielfalt und Klimarobustheit gestärkt werden kann. Sie setzten dabei auf einen integrierten Ansatz, um so den Herausforderungen des Klimawandels in Bezug auf den Wald zu begegnen.
Für das Klimagespräch sind zwei zusammenhängende öffentliche Veranstaltungen geplant. Ziel ist es, Wald als wichtigen Klimafaktor verstehen zu lernen. Am Abend ist ein Vortrag zum Thema "Der Wald im Klimawandel - vom Nutzen ungenutzter Wälder", am nächsten Tag folgt eine Exkursion und Workshop im Wald vor Ort. Hier ist das Thema "Ansätze für einen robusteren Wald im Klimawandel am Beispiel eines Wald-Refugiums". Die Zielgruppe der Veranstaltungen sind Bürger*innen, die mehr über Wald erfahren möchten.
Klima Aktiv Reutlingen ist eine Gruppe von Bürger*innen, denen das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit am Herzen liegt. Mitglieder des Organisationsteams sind teilweise in anderen Gruppen organisiert wie Fridays for Future, Parents for Future, Nachbarschaftsprojekt lebenswert und Citykirche Reutlingen. Gemeinsam möchte die Gruppe vor allem mit Menschen ausserhalb des eigenen Lebensumfelds über das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ins Gespräch kommen.
Ihre Beobachtung ist, dass viele Menschen eine aktivere Rolle im Klimaschutz einnehmen möchten, der Weg dahin aber unklar ist. In den Klimagesprächen soll daran angeknüpft und aufgezeigt werden, welche Gruppen und Initiativen in diesem Bereich bereits in Reutlingen existieren und welche Möglichkeit der Beteiligung es gibt. Nach der Auftaktveranstaltung sollen weitere Veranstaltungen folgen, um die Gespräche ggf. mit Gästen aus der Wissenschaft/Gesellschaft/Kommune zu vertiefen und konkrete Projekte anzustoßen. Zu den Veranstaltungen sind künstlerische Beiträge geplant sowie ein kleines Care-Paket für die Teilnehmenden, die mit einem Lastenfahrrad geliefert werden.
Initiative hat sich zusammengeschlossen, um sich für das Thema Klimaschutz in ihren Gemeinden stark zu machen. Sie möchten dazu beitragen, dass die Kommunen zusammen mit den Bürger*innen Klimaschutz vor Ort noch stärker voranbringen. Ihr Fokus liegt auf dem Zusammenspiel von sozialem Klima und ökologischem Klima.
Die Initiative bringt Menschen, Wissen und Kreativität zusammen, um soziale und ökologische Ideen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. Als zentralen Schlüssel für gelungenen Klimaschutz sieht die Initiative die Einbeziehung der Bürger*innen, die den Wandel mittragen.
Dazu organisiert die Initiative ein Klimagespräch mit begleitendem Klimafest, im Sinne eines Markt der Möglichkeiten. Bürger*innen haben die Möglichkeit sich zu informieren und sich darüber auszutauschen, wie sie sich in Zukunft ein Leben unter Berücksichtigung von Klimaschutz vorstellen können. Zudem wird über bereits bestehende Aktivitäten der Gemeinde und die Möglichkeiten des Engagements informiert.
Die ÖkoRegion Ottersweier vereint engagierte Bürger*innen, die aktiv etwas zum Klimaschutz beitragen wollen. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative LOS4Klima tragen sie dazu bei, dass die Gemeinden den Klimaschutz vor Ort noch stärker in die Hand nehmen. In unterschiedlichen Arbeitsgruppen beschäftigen sie sich mit Themen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in ihrer Region.
Zusammen mit der Bürgerinitiative LOS4Klima organisieren sie ein Klimagespräch mit Begleitveranstaltungen. Bürger*innen haben die Möglichkeit sich zu informieren und sich darüber auszutauschen, wie sie sich in Zukunft ein Leben unter Berücksichtigung von Klimaschutz vorstellen können. Zudem wird über bereits bestehende Aktivitäten der Gemeinde und die Möglichkeiten des Engagements informiert.
Engagierte Bürger*innen haben das Klimaforum Schallstadt gegründet, um in ihrer Gemeinde den Klimaschutz voranzubringen. Sie haben einen Klimaaktionsplan Schallstadt 2030 in Arbeitsgruppen entwickelt und ihn der Öffentlichkeit vorgestellt.
Im nächsten Schritt planen sie ein regionales Klimagespräch mit einem Markt der Möglichkeiten.
Mit der Veranstaltung in der Ortsmitte von Schallstadt soll
- die Bevölkerung für Fragen des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit durch Fachinput informiert und sensibilisiert werden,
- ein Gesprächsforum mit und zwischen der Bürgerschaft entstehen,
- zum aktiven Handeln angeregt werden und
- gute Beispiele und Aktivitäten in der Gemeinde sichtbar werden.
Die Veranstaltung setzt sich aus drei Formaten zusammen: Markt der Möglichkeiten mit Mitmachaktionen, Fachvorträgen und einem Klimagespräch. Dazu finden an vier Thementischen moderierte Diskussionsrunden zu den Themen Energie, Konsum, Wasser, Mobilität statt. Ausgangspunkt des Austausches sind die Inputs der Fachbeiträge sowie der Klimaaktionsplan Schallstadt 2030, der zum Leben gebracht werden soll. Im Dialog sollen Ideen gesammelt und Themenverantwortliche gefunden werden. Die Ideen werden abschließend im Plenum vorgestellt. Das Klimaforum Schallstadt setzt sich dafür ein, dass die Themen auch zur Umsetzung kommen.
Die Initiative besteht aus engagierten Bürger*innen, die in Schöckingen wohnen und etwas für die Umwelt tun wollen. Ihr Ziel ist es, möglichst viele weitere Schöckinger*innen zu gewinnen, sich ebenfalls für den Klimaschutz zu engagieren. Auf dem Klimagespräch möchten sie gemeinsam Ideen entwickeln, und sie auf ihre Machbarkeit prüfen. Hier wird ebenso an den aktuell laufenden Ideen-Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" angeknüpft, bei dem Bürger*innen nachhaltige Projektideen zu Naturschutz einreichen konnten. Diese Ideen sollen mit Hilfe des Klimagespräch identifiziert werden. Thematisch ist das Klimagespräch offen für weitere Ideen, die die Bürger*innen einbringen.
Die Veranstaltung ist im Präsenz geplant und findet digital statt, sollten es die Vorschriften bis dahin nicht ermöglichen.
Die Gruppe KlimaTeam Schöntal hat das Ziel, Bürger*innen der Gemeinde Schöntal im ländlichen Hohenlohekreis für Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren, gemeinsam Ideen zu entwickeln und aktiv in der Gemeinde generationsübergreifend Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben.
Im ersten Schritt möchten sie bei einer Auftaktveranstaltung in Form eines Klimagesprächs ihre Ziele vermitteln und eine Plattform für eine offene Diskussion mit den Bürger*innen ermöglichen. Im zweiten Schritt ist die Vereinsgründung geplant, um eine Struktur für die Umsetzung der zukünftigen Projekte und Vorhaben zu gewährleisten.
Das Klimagespräch findet in der Gemeindehalle statt und ist zweiteilig aufgebaut. Zunächst sensibilisieren drei Impulsvorträge für das Thema Klimaschutz, daraufhin können Bürger*innen an unterschiedlichen Thementische ins Gespräch kommen und gemeinsame Projekte entwickeln.
Engagierte Bürger haben sich zur Klimainitiative Schwäbisch-Gmünd zusammengefunden, um ihren Beitrag zur Klimaneutralität der Stadt zu leisten. Ziel der Gruppe ist es, Interesse zu wecken, aktive Mitstreiter zu gewinnen und gemeinsam den komplexen Weg zur Klimaneutralität zu gestalten. Mit Aktionen, Projekten und Veranstaltungen bringen sie klimapolitische Themen in die Öffentlichkeit.
Geplant ist eine Reihe an Klimagesprächen nach den Sommerferien 2022 zu den Themen emissionsfreier ÖPNV, Flächenverbrauch und Zukunftsszenarien Klima. Die Themen werden allgemein und lokal mit einem Fachinput und einem moderierten Gespräch diskutiert. Zielgruppe ist die breite Öffentlichkeit, die ihr Wissen erweitern kann, sich in die Diskussion einbringen und ins Nachdenken kommen kann.
Der Freundeskreis Afrika e.V. setzt sich u.a. für Empowerment, Bildung für Nachhaltige Entwicklung und die Agenda 2030 ein. Als migrantische Selbstorganisation sind sie Träger des interkulturellen Promotorinnenprogramms und des weltwärts Freiwilligendiensts.
Als internationaler Verein, der sich für eine global verantwortungsvolle post-migrantische Zukunft einsetzt, plant der Freundeskreis Afrika ein Klimagespräch anhand des Ablaufs der Toolbox. Mit seiner Ausrichtung bringt der Verein unterschiedliche Perspektiven in einem Klimagespräch zusammen. Zielgruppe sind alle Interessierten, vorwiegend Migrant*innen und Geflüchtete aus ihrem direkten Netzwerk. Im Fokus stehen Themen wie internationaler Klimaschutz, Hochwasser und Recycling. Die Veranstaltung ist für Ende Oktober in Präsenz im Haus der Bildung geplant.
Netzwerk Streuobst und nachhaltiges Sulz e.V. veranstaltet als Klimadreieck zusammen mit der Mitmachzentrale Gerlingen e.V. und kit Jugendhilfe Ammerbuch e.V. in Sulz ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Die Gruppen meinGemeinwohl-Stammtisch verfolgt verschiedene Projekte, die sich mit den Themen Gemeinwohl, Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigen. Ihr Ziel ist es, den aktuellen Krisen zu begegnen, Veränderungen herbeiführen, die ein nachhaltiges Leben ermöglichen.
Mit einem Klimagespräch möchten sie zu diesem Austausch einladen und gemeinsam überlegen, wie eine Veränderung gelingen kann. Tettnanger Bürger*innen kommen zusammen, bringen ihre Themen in einem Open Space ein, diskutieren im World Café die Themen und netzwerken mit anderen engagierten Bürger*innen.
Fuß- und Radentscheid Tübingen ist eine Bürgerinitiative, die sich für bessere Bedingungen für zu Fuß Gehende und Radfahrende in Tübingen einsetzt. Im Fokus ihrer Arbeit stehen in diesem Jahr Kinder und Eltern und insbesondere der Weg zur Schule. Gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat, den Fridays for Future und weiteren Akteuren wird ein Klimagespräch umgesetzt. Ort des Klimagesprächs sind die Parkplätze der den Schulen, diese werden abgesperrt und hier Klimagespräche zum Thema autofreie Schulwege und weitgehend autofreie Innenstadt durchgeführt. Zielgruppe sind die Schülerschaft, Eltern, Klimaktive, Vereine, Bürgerinitiativen. An diesem Tag werden weitere Schritte geplant, um dem gesetzten Ziel näher zu kommen.
Der Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V. setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung der Region ein. Die Mitglieder sind zu je einem Drittel Bürger*innen, Unternehmer*innen sowie Institutionen/Kommunen/Wissenschaft. Der unw versteht sich als Vermittler und Netzwerker und versucht Entscheider, Bürger*innen und Institutionen in nachhaltige Prozesse einzubinden.
Beim Klimagespräch stellen Ulmer Gruppen/Initiativen/Vereine aus dem Nachhaltigkeitsbereich ihren Schwerpunkt und ihre Arbeit vor. Mit der Veranstaltung möchte der unw diejenigen ansprechen, die im Bereich Klimaschutz mit machen wollen und Beteiligungsmöglichkeiten für konkrete Projekte suchen. In Kleingruppen werden Projekte erarbeitet und in einer abschließenden Diskussion Formen des zukünftigen Zusammenarbeitens entwickelt.
Um eine möglichst großer Wirksamkeit zu erreichen, ist der unw mit anderen Initiativen im Gespräch, um gemeinsam eine Trilogie der Klimagespräche zu veranstalten.
Der BUND Regionalverband Donau-Iller setzt sich regional für Natur-, Arten- und Klimaschutz sowie für die Energiewende ein. Zusammen mit anderen Umwelt- und Naturschutzorganisationen bildet er Bündnisse, um die Stimme für Umwelt und Natur noch mehr Einfluss zu geben.
Das Klimagespräch ist Teil einer Trilogie der Klimagespräche im Stadtkreis Ulm. Ein Klimagespräch wird vom unw und das andere von VCD durchgeführt. Ziel der dreiteiligen Klimagesprächsreihe ist es, Interessierten aus der Region die verschiedenen Organisationen, die sich für Klimaschutz einsetzen vorzustellen, als auch die Organisationen untereinander besser zu vernetzen. Zudem ist das Ziel, Mitwirkende für konkrete Projekte zu gewinnen.
Der VCD ist ein gemeinnütziger Umweltverband, der sich für eine klimaverträgliche, sichere und gesunde Mobilität für Menschen einsetzt.
Das Klimagespräch ist Teil einer Trilogie der Klimagespräche im Stadtkreis Ulm. Ein Klimagespräch wird vom unw und das andere von BUND durchgeführt. Ziel der dreiteiligen Klimagesprächsreihe ist es, Interessierten aus der Region die verschiedenen Organisationen vorzustellen, die sich für Klimaschutz einsetzen, als auch die Organisationen untereinander besser zu vernetzen. Zudem ist das Ziel, Mitwirkende für konkrete Projekte zu gewinnen.
Die Künstler*innen-Gruppe beschäftigt sich mit der demokratischen Mitbestimmung in der Stadt. Das Konzept der autogerechten Stadt des vergangenen Jahrhunderts dominiert immer noch die Städte der Gegenwart. Die Initiative stellt in Frage, ob die Nutzung der Straßen als Transitzone für PKWs erwünscht ist und was uns abhält den Status quo aufzubrechen und die Stadt klimafreundlicher zu gestalten. Sie eröffnet dazu ein Klimagespräch, wie die Stadt zukünftig aussehen könnte.
Dazu erklärt sie für einen begrenzten Zeitraum die König-Wilhelm-Straße, eine starkbefahrene Straße, zur verkehrsberuhigten Zone und verlegt eine Rollrasenfläche auf der Kreuzung. Der Rollrasen wird Spielfeld und Bühne, er bietet den Rahmen für Visionen und Fläche für gesellschaftliches Wirken.
Der Bürgerdialog wird in einer Online-Abstimmung mit der Frage begonnen, ob die Anwohner einer temporären Verkehrsberuhigung zustimmen und wird in einer umgenutzten ehemaligen Apotheke, als Zentrum des Austauschs und Information fortgesetzt.
Der Klimarat an der Freien Waldorfschule Wahlwies setzt sich zusammen aus Schulgemeinschaft und Bürgerschaft aus Wahlwies zusammen. Ziel ist es, die Schule bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu machen und während dieses Prozesses Akteure aus der Kommune einzubeziehen und zu motivieren, in anderen Bereichen gleichermaßen die Klimaneutralität voranzutreiben.
In einem Klimagespräch finden die Schulgemeinschaft, Bürgerschaft und Kommunalpolitik und regionales Gewerbe zusammen und entwickeln gemeinsam Ideen und setzten diese jeweils im eigenen Handeln um. Themen wie Energie, Mobilität, Konsum und Entsorgung werden in Workshops und Austauschforen diskutiert. Unterschiedliche Wissensstände und Hintergründe werden zusammengeführt und die Möglichkeit geschaffen, von einander zu lernen.
Nachhaltige Zukunft Waldstetten e.V. veranstaltet in Waldstetten ein regionales Klimagespräch im Rahmen des Projekts Dialog zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Der Verein setzt sich mit außergewöhnlichen Aktionen für die Reduktion des persönlichen CO2-Verbrauchs ein. Er ist gut vernetzt und trägt konkret zu einer zukunftsfähigen kommunalen Entwicklung bei. Mit seinem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbegriff sind die Stärkung der regionalen Wertschöpfungskreisläufe, Bürgerbeteiligung und Generationenverträglichkeit von zentraler Bedeutung.
Es sind zwei Klimagespräche geplant: Das erste findet online statt unter dem Titel "Mit der Sonne per du" und beinhaltet eine Podiumsdiskussion mit anschließender Workshopphase zur praktischen Umsetzung von solaren Anlagen. Im zweiten Gespräch liegt der Fokus auf dem persönlichen Austausch zum Thema Klimagerechtigkeit.
Das Klimabündnis Rems-Murr ist ein Zusammenschluss von sechs lokalen Klimaentscheid-Gruppen und Klimabündnis-Gruppen, die politische Gemeinderatsbeschlüsse zur Klimaneutralität 2035 anstoßen sowie Einzelpersonen und Organisationen wie der ADFC und NABU.
Das Klimagespräch findet als ein Netzwerktreffen aller Klima-Interessierten der Region unter dem Titel Vision Rems-Murr 2035 statt. Mit einem ganztägigen Programm wird ein umfassender Austausch auf unterschiedlichen Ebenen ermöglicht. Auf der einen Ebene geht es um inhaltliche Vorträge und Projektvorstellungen, die in Workshops vertieft werden auf der anderen Ebene geht es um ein vertieftes Kennenlernen der verschiedenen Akteuren (Politik, Verwaltung, aktive Bürger*innen) als vertrauensbildende Maßnahme, um zukünftig effektiver gemeinsam konstruktiven Klimaschutz zu gestalten.
Die Klimainitative setzt sich für die Umsetzung der Klimaschutzziele in Hockenheim ein, in enger Zusammenarbeit mit der Klimaschutzbeauftragten der Stadt.
Als Orientierung gelten die als AGENDA 2030 definierten Ziele, der Vereinten Nationen und das Pariser Klimaschutzabkommen.
Diese Ziele werden speziell für die Umsetzung in konkreten Projekten für Hockenheim erarbeitet und sollen dann gemeinsam mit Verwaltung und Gemeinderat umgesetzt werden. Ziel ist es, die Klimaschutzziele fest in der Stadt zu verankern und Klimaneutralität so schnell wie möglich umzusetzen.
Aktuell werden 3 Nachhaltigkeitsziele verfolgt. „Bezahlbare und saubere Energie“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ sowie „Nachhaltiger Konsum und Produktion“.
Beratung zur Initiierung eines CarSharing-Angebotes mittels Bürgerbeteiligung und in Kooperation mit der Kommune für die zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilität in Laufenburg.
Der Runde Tisch Klima Lörrach bringt Bürger*innen, Experten und Politiker zusammen, um über Klimawandel und Klimaschutz zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten. Es gibt sechs Arbeitskreise innerhalb des Runden Tischs, eine davon ist die AG Schule. Hier geht es um die Förderung von Wissen und Handeln von Kindern und Jugendlichen in Schulen. Parallel zum Projekt Lörrach verkleinert seinen CO2 Fußabdruck, als Angebot für alle Bürger*innen der Stadt, entwickelt die AG auch das Angebot für Schulen. Unter dem Titel Klimaneutrale Schule unterstützt die AG Schulen ihren CO2 Fußabdruck zu erheben und zu reduzieren. Mit dem Schneeballprinzip sollen möglichst viele Schulen erreicht werden, da die vom Runden Tisch betreute Schule, sich verpflichtet eine weitere Schule in Form einer Patenschaft zu betreuen.
Die Initiative GoodFood teilt ihr Wissen, Erfahrung und Begeisterung zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung mit anderen Bürgern. Mit einem Klima-Fahrradaufsatz wird ein multifunktionaler modularer Aufsatz für ein Lastenfahrrad oder Fahrradanhänger gebaut, der für folgende Zwecke genutzt werden kann: Mobiler Infostand, Präsentation von didaktischem Material, umweltfreundlichen Lebensmitteln und Rezepten, mobile Bibliothek und Transport von Material für Außenaktivitäten. Ziel dabei ist es, das Wissen, die Erfahrungswerte und das Bewusstsein in der Bevölkerung bzgl. klimafreundlicher Ernährung zu vergrößern, sowie die Bereitschaft das eigene Verhalten zu reflektieren.
Die Kerngruppe des Klimarats besteht aus engagierten Bürger*innen, Eltern, Kollegium, Schüler*innen, die unterschiedliche Expertisen zum Thema Klimaschutz einbringen. Der Klimarat ist kein Organ der Schule, sondern ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Personen aus der Schul- und Dorfgemeinschaft, die zusammen Ideen für mehr Klimaschutz entwickeln und diese setzen.
Ziel ist es, dass die Schule bis 2030 klimaneutral wird und gleichzeitig Klimaschutzbestrebungen in der Gemeinde voran gebracht werden. Es werden Maßnahmen in den Bereichen Energie, Mobilität, Verpflegung, Beschaffung und Entsorgung erarbeitet und dazu Aktionen, Workshops und Treffen mit der Zivilgesellschaft der Gemeinde umgesetzt.
Die Initiative Klima und Umwelt hat sich gegründet, um Themen der Klima- und Umweltproblematik zusammen mit Lösungsansätzen einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, zu verstehen und gemeinsam anzupacken. Mit einer nötigen Leichtigkeit im Umgang mit den großen Herausforderungen möchten sie Abwehr- und Ausblendungsreaktionen umgehen und mit Lösungsansätzen und Kreativität den Themen begegnen.
Mit diesem Projekt lädt die Initiative Kinder zu kreativen KlimArt-Workshops ein, in denen sie sich auf künstlerische und lösungsorientierte Weise mit dem Thema Umwelt auseinander setzen. Z.B. widmen sich die Kinder beim Aquarellmalen dem Wasser, bei der Luftakrobatik der Atmosphäre und dem Klimawandel, beim Tonen und Schnitzen den Eigenschaften von Holz und Erde, beim Blumenbasteln den ökologischen Zusammenhängen zwischen Pflanzen und Tieren. Jeweils werden die aktuellen Problematiken diskutiert und Lösungsansätze zusammen gefunden. Mit kleinen Vorführungen und Ausstellungen sollen zukünftig auch weitere Personen in den Austausch zu den Themen gebracht werden.
Die Lokale Agenda Ehingen bietet Bürger*innen eine Plattform, um sich zu vernetzen und Projekte zu entwickeln. In der Arbeitsgruppe Umwelt und Biosphäre sowie Soziales treffen sich bürgerschaftlich Engagierte und Interessierte mit Akteuren aus Politik und Verwaltung, um das Leben in Ehingen ein Stück nachhaltiger zu gestalten. Die Lokale Agenda organisierte zwei Regionale Klimagespräche. Hier wurde deutlich, dass sich viele Ehinger*innen persönlich auch in Zukunft für mehr Klimaschutz engagieren und Ideen im Austausch mit anderen entwickeln möchten. Daher ist dort die Idee entstanden, ein Klimatagebuch für alle Ehinger*innen zu entwerfen, das ermöglicht sein eigenes Verhalten zu reflektieren und damit einen ersten Schritt zur eigenen Verhaltensänderung und Entwicklung von weiteren Projektideen zu gehen. Das Klimatagebuch ist für alle kostenlos erhältlich, kann selbst ausgestaltet werden und individuell genutzt werden.
Zudem sind Treffen für alle Tagebuch-Schreiber geplant, um sich über die Beobachtungen auszutauschen und sich gegenseitig zu motivieren. Aus diesen Erkenntnissen können neue Projektideen entstehen. Als Anreiz für das Schreiben von Klimatagebüchern findet am Ende des Jahres eine Verlosung aller eingereichten Tagebücher statt.
Die Initiative "Bewegtes Laufenburg" engagiert sich für die klimaverträgliche Mobilität durch ein Carsharing-Angebot in Laufenburg, um Autoverkehr und CO2-Werte zu reduzieren. Mit Hilfe von Veranstaltungen und Ständen werden Bürger*innen vom Angebot überzeugt, sodass zukünftige Mobilität in Laufenburg entsteht. Die Beratung erhält die Initiative für das Ausrichten und die Organisation zur Bürgerbeteiligung und bei der Verstetigung der Projektidee.
Der BUND setzt sich für den Schutz der natürlichen Existenzgrundlage ein und damit auch für den Klimaschutz. Um junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren organisiert der BUND mit Azubis des Landratsamts Reutlingen ein Planspiel zur Klimaneutralität in Kommunen. Ziel ist es, dass Azubis ein Verständnis für kommunalen Klimaschutz entwickeln und künftig eigene Projekte umsetzen. Neben dem BUND ist auch die Klimaschutzagentur des Landkreises eingebunden, um auch darüber hinaus weitere Klima-Planspiele anzustoßen.
Anhand des fiktiven Ortes Weitingen werden 60 Rollen besetzt, vom Gemeinderat über Genossenschaften und Landwirte, um ganz konkret das Thema durchzuspielen. Während des Planspiels erleben die Beteiligten, wie eine Verständigung in der Praxis stattfinden kann, wo es Konfliktpotenziale aber auch Lösungen gibt. Danach wird das erlebte auf den Landkreis Reutlingen transferiert.
Die Initiative engagiert sich für das lebenswerte Miteinander im Klosterviertel. Es geht dabei um nachbarschaftliche Unterstützung von älteren Bewohner/innen, um das Einbinden von neu zugezogenen Familien und anderen Personen. Die Eröffnung von zwei neuen Wohnhäusern für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten bringt neue Herausforderung für das Quartier. Die Initiative möchte ein gutes Ankommen und die Integration vorbeitreten sowie einen neuen sozialen Treffpunkt für alle Bewohner/innen einrichten. Beratung erfolgt zu unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten sowie zu Gewinnung von weiteren Mitmachenden.
Ein Offener Kochtreff soll das Gemeinschaftsgefühl stärken, kulturelle Vielfalt im Ort sichtbar, erlebbar und schmackhafter machen. Freiwillige Helfer sollen im örtlichen Gemeindeblatt zum gemeinsamen Kochen eingeladen werden.
Das Ziel des Projekts ist die Aktivierung der sozialen Nachbarschaft. Die Kommunale Daseinsvorsorgegenossenschaft Eisental (KoDa) ist eine hybride Bürgergenossenschaft, die gemeinsam von Mitbürgern, Vereinen und Unternehmen der Region gegründet und betrieben werden kann. Die zentralen Themen sind dabei Nahversorgung, Mobilität, Pflege und erneuerbare Energien. Eine Veranstaltungsreihe informiert die Bürgerschaft über die erfolgreich durchgeführten Projekte zur Daseinsvorsorge und über die möglichen gemeinsamen Aktionen. Der Arbeitskreis benötigt fachliche Unterstützung für die Aktivierung der Bürgerschaft sowie in der Vorbereitung der Gründung einer regionalen hybriden Genossenschaft zur Daseinsvorsorge.
So lange und so gut wie möglich selbstständig zu Hause leben zu können, ist ein zentraler Wunsch älterer Menschen. Sie bei der Erfüllung dieses Wunsches zu unterstützen, ist ein zentrales Ziel der Gesundheits- und Sozialpolitik in Deutschland. Zur Erhaltung der gewünschten Selbstständigkeit braucht es familiäre und private Netzwerke und Unterstützung, aber auch professionelle Angebote und Hilfeleistungen. Mit einer neu eingerichteten Stelle zum Case-Management bei Senior*innen, also einer eingreifenden und steuernden Einzelfallbegleitung, soll das Projekt ältere Menschen in ihrem häuslichen Umfeld unterstützen und Eigenständigkeit, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe fördern und sichern. Dabei setzt das Projekt auf die vorhandene Vernetzung im Gemeindeverbund Rheinfelden und Schwörstadt. Beide Kommunen verfügen über ein breites Netzwerk zivilgesellschaftlicher Akteur*innen und engagierter Bürger*innen, die im Rahmen des Projekts eingebunden werden.
Für den Landkreis Lörrach ist das Projekt ein Exemplar für die Einführung von Case-Management für Senior*innen auf kommunaler Ebene. Die Ergebnisse des Projektes fließen auf Kreisebene sodann in die Weiterentwicklung von Pflegestützpunkten im Landkreis Lörrach mit ein.
Der Verein K3 stärkt in Winterlingen die Kultur des Einander-Zuhörens mit dem Format Demo-Slam. Mit lokalen Bauernprotesten und weiterhin spürbaren Pandemie-Auswirkungen liegen (lokale) Themen dafür auf der Hand. Durch die Demo-Slammer*innen, die direkt aus der Bürger*innenschaft kommen, können verschiedene Meinungen künstlerisch dargestellt und im Anschluss miteinander diskutiert werden. Das Format eignet sich auch um kontroverse Themen zu besprechen. Nicht nur die Demo-Slammer*innen lernen voneinander, sondern auch das Publikum, das Haltungen nachvollziehen kann, ohne sie selbst teilen zu müssen. Bei der Einladung setzt der Verein zunächst auf eigene Netzwerke (lokale Vereine, Kirchen, Unternehmen etc.) und eine aufsuchende Beteiligung. Um Menschen mit extremer Meinung ebenso für das Projekt zu begeistern, wird auch das private Umfeld der Vereinsmitglieder direkt angesprochen. Zudem ermöglicht der Verein es durch Kinderbetreuung und Fahrdienste eine niederschwellige Beteiligung. Diese Fahrdienste werden kostenlos angeboten, da die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus umliegenden Orten derzeit noch kaum möglich ist.
Durch das Projekt wird ein Konzept für den Bürgerbusbetrieb in Vaihingen an der Enz entwickelt, um die Teilorte besser miteinander zu verbinden. Somit wird die Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten und der Innenstadt verbessert und somit die Verbindung untereinander gestärkt. Die Beratung erhält die Initiative zu rechtlichen und technischen Leistungen rund um das Konzept.
Die Freiwilligenagentur (FWA) ist eine Initiative zur strukturellen Förderung des freiwilligen Engagements in Reutlingen. Hier gibt es eine vitale Vereinslandschaft, ein hohes soziales Engagement, viele Initiativen und Projekte in den Quartieren. Auf der Basis von einer aktivierenden Befragung in den Stadtbezirken wird ein neues Konzept entwickelt, um das Engagement an die neuen Herausforderungen wie den demografischen Wandel, Zuzug von neuen Menschen und die Veränderungen durch die sozialen Medien anzupassen. Eine Steuerungsgruppe wird unter fachlicher Begleitung die Ziele die Befragung definieren und die Fragebögen entwickeln. Die Durchführung ist im Frühjahr/Sommer 2020 geplant.
Die Sozialgemeinschaft Herrenzimmern hilft älteren und betreuungsbedürftigen Mitbürger*innen, indem sie u.a. Nachbarschaftshilfe anbietet, bei Antragsstellungen zum Pflegegrad und bei Unterstützungs- und Entlastungsleistungen hilft. Gemeinsam mit der Gemeinde erarbeitet die Initiative ein Finanzierungskonzept, um ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen neu zu gestaltet und dort barrierefreie Wohnungen zu realisieren. Beratung erfährt das Projekt hierbei insbesondere zum Personalaufwand, Unterhalts- und sonstigen Betriebskosten und Ertragsquellen.
Murrhardt zählt zu den „Demenzfreundlichen Kommunen“ und hat ein gutes Versorgungs- und Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Das Projekt „AnKer (aufsuchende neutrale Kontaktstelle) für Demenz“ benötigt gute Öffentlichkeitsarbeit, um stärker im Quartier verankert zu werden. Der Schwerpunkt liegt bei alleinstehenden, immobilen Menschen, und Mitbürgern mit Migrationshintergrund. In vielen Kulturkreisen ist Demenz ein Tabuthema. Eine professionelle Beratung, die die bereits geleistete Arbeit berücksichtigt und reflektiert, soll neue Möglichkeiten aufzeigen, wie die Menschen im Quartier einbezogen werden können.
Der Verein für die Jugend Elzach e.V. ist mit dem Ziel gegründet worden, die offene Jugendarbeit in Elzach zu fördern und das städtische Jugendhaus zu tragen. In einem neuen Projekt ermöglicht der Antragsteller die Erstellung von Gruppen-Portraits junger Menschen durch onlinebasierte Gruppendiskussionen in virtuellen Räumen, um damit in Erfahrung zu bringen, wie in Zeiten von Corona eine eigene und solidarische Lebensbewältigung der Jugendlichen konkret aussieht. Es geht auch um Bilder und Zukunftsvorstellungen der Jugendlichen für eine Zeit nach Corona. Die Zukunftsideen zu Bildungsperspektiven, zur Digitalisierung (u.a. digitale Lernumgebungen), zu politischen Einstellungen, zur Wahlalter-Debatte und zum Klimaschutz werden dabei aufgegriffen. Mit diesen Erkenntnissen werden bei wieder gegebener realer Begegnungsmöglichkeit Generationen übergreifende Veranstaltungen gestaltet und wird mit politisch Verantwortlichen in den Dialog getreten. Ziel ist es laut Antragsteller auch, die Motivation der jungen Menschen in Bezug auf die Gestaltung ihrer Lebenswelt mit einzubeziehen und ihnen eine Idee mit an die Hand zu geben, wie junges Leben in Zeiten nach Corona konkret und selbstwirksam aussehen kann.
Der Verein Ziegelhütte e.V. hat ein brachliegendes historisches Gebäude übernommen und mit Spenden wieder aufgebaut. Um hier nach Fertigstellung Aktivitäten wie Kunst, Kultur, Vereinsarbeit, etc. aufleben zu lassen, führt der Verein eine Bürgerbeteiligung durch. Für die Bürgerbeteiligung erhält der Verein die Beratung, um ein ganzheitliches Nutzungskonzept zu erstellen.
Das alte Schulhaus in St. Johann wird in ein Kulturzentrum, Kulturcafé oder Bürgerhaus umfunktioniert, um das Leben in ländlichen Regionen attraktiver zu gestalten. Die Sanierung des Hauses übernimmt die Gemeinde. Ein Konzept für die Planung, Gestaltung und die zukünftige Nutzung wird in einem Bürgerbeteiligungsprozess erarbeitet. Betreutes Wohnen und/oder Jugendtreff sind ebenfalls möglich. Beratung wird zur Konzept- und Angebotsentwicklung genutzt.
Versorgungsstrukturen mit Nahrungsmitteln sowie einer nachhaltigen, fairen Landwirtschaft wird vor dem Hintergrund des Klimawandels, Artensterbens und der Coronakrise immer deutlicher. Das Projekt bringt hierfür Schlüsselakteur*innen aus Lebensmittelwirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft aus Stadt und Umland zusammen, um den Weg zu klimafreundlichen, nachhaltigen Versorgungsstrukturen in Freiburg und Region zu ebnen. Dabei wird die Ist-Situation der regionalen Ernährungssysteme analysiert und strategische Handlungsfelder definiert. Dazu gehören intelligente Logistiksysteme mit alternativen Mobilitätskonzepten für eine Reduktion des Lebensmittelabfalls auf ein Minimum sowie der Ausbau regionalen, saisonalen Versorgung auf ein Maximum. Darauf aufbauend wird die Beratung bei einem Fahrplan für einen umfassenden, regionalen Beteiligungsprozess aufgestellt, mit dem eine Ernährungsstrategie für die Region als Handlungsempfehlung entwickelt wird.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung BW e.V. ist ein Netzwerk, das sich für Gemeinwesen- und Quartiersarbeit in einer sozialen Stadt- und Stadtteilentwicklung einsetzt. Sie bündeln Fachwissen und begleiten Soziale-Stadt-Projekte in ehrenamtlicher Tätigkeit. Gemeinsam mit LAG anderer Bundesländern arbeiten sie zusammen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadt und Gemeinwesenarbeit.
Vernetzung, Qualifizierung und Austausch sind zentrale Bereiche der LAG, dazu bieten sie regelmäßig Fachtagungen und Netzwerktreffen an. Die Tagung im Oktober mit dem Tittel "Von der Krise zur Chance" soll Raum zum Netzwerken bieten und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Stadtentwicklungsthemen in Hinblick auf die Post-Corona-Zeit ermöglichen. Wichtiger Bestandteil der Tagung sind Workshops zu fünf Fachthemen.
Im Stuttgarter Süden wurden Nachbarschaftsgespräche als Fortsetzung des zuvor durchgeführten kommunalen Flüchtlingsdialogs gesehen, in dessen Rahmen Fragen offen blieben, die nun wieder aufgegriffen wurden. Insgesamt sind die Dialogrunden in einen 5-Jahres-Plan eingebettet, der sich der Frage widmet: „Wie entwickeln wir gemeinsam das Zusammenleben im Quartier?“
Begonnen mit Einzel- und Gruppengesprächen an öffentlichen Plätzen wie auf Straßenfesten, Märkten und an U-Bahn-Haltestellen wurden Bürger zum Zusammenleben vor Ort befragt. Hierbei stellte sich heraus, dass vor allem die Aspekte „Armut“ und „fehlende Zugänge für sozial Schwächere“ eine große Rolle im Stadtteil spielen.
Vor diesem Hintergrund wurden fünf Nachbarschaftsgespräche mit unterschiedlichen Fokussen durchgeführt wie: "Diskriminierung – und wie erlebe ich es persönlich?", "Kulturelle Missverständnisse – welche Erfahrungen habe ich gemacht?", "Soziale Situation: Zuhören – Teilen – Austauschen". Das große Ziel dabei war es, einen "Wir-Raum" zu bieten, um unterschiedliche Personengruppen mit und ohne Migrationsgeschichte zusammenzubringen. Festgehalten wird in diesem Kontext, dass es im Rahmen der Gesprächsrunden hinsichtlich der jeweiligen Ansprache von Vorteil sein kann, Moderatoren aus der zu beteiligenden Zielgruppe zu wählen.
Eine Begleitgruppe, die sich aus Vertretern der Verwaltung, aus zivilgesellschaftlichen Partnern und der Berater zusammensetzte, unterstützte und koordinierte den Prozess insgesamt.
Die Nachbarschaftsgespräche im stark durchmischten Wohnquartier in der Paul-Lincke-Straße 2-14 sollten die Bewohner dazu einladen, sich aktiv mit ihren Nachbarn und dem Wohnumfeld auseinanderzusetzen. Sie bekamen die Möglichkeit, ihre Vorstellungen von einer gut funktionierenden Nachbarschaft einzubringen sowie diese mitzugestalten. Das Bezirksamt Botnang, das Sozialamt, das Kinderbüro, SWSG, AWO und eva nutzten die Rückmeldungen aus der Bewohnerschaft, um das Zusammenleben im Quartier zu unterstützen.
Nachdem ein erstes Nachbarschaftsgespräch noch mit ausreichend Abstand draußen stattfinden konnte, wurden weitere Treffen in den virtuellen Raum verlegt. Die digitalen Formate waren dabei kein Ersatz für den persönlichen Austausch, sie bauen jedoch eine Brücke, bis dieser wieder möglich ist. Mit zwei kreativen Postkartenaktionen wurden die Bewohner der Nachbarschaft aktiv: Ein Ideenwettbewerb mit der persönlichen Bedeutung davon, was gute Nachbarschaft bedeutet und Dankeskarten, die direkt an die eigenen Nachbar verschickt werden. Ein Verantwortungsgefühl für die eigene Nachbarschaft sollte durch eine Pflanz-Aktion geweckt werden, bei der die Bürger selbst ausgesuchte Pflanzen im öffentlichen Raum einpflanzten und umsorgten.
Darüber hinaus wurde auch ein Beteiligungsmodul für Kindes gemäß des Aktionsplans vom Kinderbüro für ein kinderfreundliches Stuttgart durchgeführt.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.
Ziel des Projekts ist der Aufbau und die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Seniorenarbeit und dessen Vernetzung im Landkreis. Dazu werden mittels Sozialraumanalyse in den Städten Langenau und Schelklingen die jeweiligen Ausgangssituationen betrachtet und anschließend notwendige Faktoren und Strukturen erarbeitet und in die Praxis umgesetzt.
Mit dem Projekt sollen im Alb-Donau-Kreis (ADK) Impulse für den Aufbau einer zukunftsorientierten Pflege im Landkreis erwirkt und erfolgreich etabliert werden.
Der Landkreis begegnet damit generationsübergreifend und integrativ der Vereinsamung und der sozialen Ungleichgewichte in der Bevölkerung. Altersisolation soll vorgebeugt und die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen im Quartier ermöglicht werden.
Weiter wird der Austausch auf Landkreisebene gestärkt und nachhaltig verankert.
Die Frage "Wie muss ein Dorf aussehen, damit alle Menschen, mit oder ohne Hilfebedarf, in dem Dorf dauerhaft wohnen können?" ist leitend. Modellhaft wird der Landkreis Biberach gemeinsam mit der Gemeinde Schemmerhofen einen breit angelegten Beteiligungsprozess zum Aufbau einer Sorgenden Gemeinschaft umsetzen. Angesichts des demografischen Wandels gilt es die soziale Infrastruktur mit besonderem Blick auf die Zielgruppe "Hochaltrige" und "Neue Generation Alte" in den Blick zu nehmen. Präventive Hausbesuche sollen Versorgungslücken aufdecken und Unterstützung vermitteln. Der Dialog zwischen Jund und Alt wird angeregt und Barrieren entdeckt. Die gegenseitige Sorge wird in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit von Bürger*innen, Kommune, Landkreis, Organisation der Zivilgesellschaft und professionellen Dienstleiter gestellt. Die Erfahrungen aus dem Prozess werden in andere Kommunen übertragen.
Der demografische und gesellschaftliche Wandel stellt Kommunen und Gesellschaft
vor immense Herausforderungen in der Sorge und Pflege älterer Menschen. Diese
lassen sich nur in engem Schulterschluss von Kommunen, Zivilgesellschaft und
Pflegedienstleistern gut bewältigen.
Der Lösungsansatz des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist die Entwicklung der lokalen Strukturen hin zu Sorgenden Gemeinschaften, die, eingebettet in das örtliche Gefüge, Beteiligung und
Mitverantwortung ermöglichen. Grundlage hierfür ist ein gutes Zusammenwirken auf
Augenhöhe und in gemeinsamer Verantwortung von Angehörigen, engagierten
Bürger*innen, zivilgesellschaftlichen Organisationen/Initiativen, sozialen Dienstleistern
und Kommunen.
Der Landkreis möchte sich mit sechs speziell ausgewählten kommunalen
Leuchtturmprojekten auf den Weg zu Sorgenden Gemeinschaften machen, an deren
Ende eine Infrastruktur steht, die es älteren Menschen ermöglicht - auch bei Pflege -
und in Würde alt zu werden. Dabei sind die einzelnen
Kommunen unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung. Der Landkreis möchte die
Projekte vernetzen und Erkenntnisse für eine künftige Unterstützungsstruktur
sammeln, die in einem späteren Schritt allen Kreiskommunen zugutekommen soll.
Das Projekt "Kommunale Quartiersentwicklungsplanung - Älter werden im Quartier" qualifiziert kommunale Mitarbeitende der einzelnen Städte und Gemeinden im Landkreis, um die Ergebnisse des bisherigen Projekts "Quartiersforscher - Gestaltung lokaler Altenhilfelandschaften" nachhaltig in einem Quartiersentwicklungsplan zu sichern. Die Kommune agiert als "Motor im Sozialraum" und begreift Quartiersentwicklung als festen Bestandteil der Quartiersbewohner über 60 Jahre im Mittelpunkt der weiteren Planung stehen. Ebenso soll der besondere Fokus auf die älteren Generationen helfen, Senioren nicht nur als ein Hauptfaktor des demographischen Wandels, stattdessen jedoch als wertvolle Ressource für Ehrenamt und freiwilliges Engagement in lokalen Verantwortungs- und Entwicklungsgemeinschaften zu begreifen.
Das Projekt ist Teil der Strategie des Landratsamtes Karlsruhe zur Förderung der Quartiersentwicklung in den Kommunen des Landkreises. In der Großen Kreisstadt Waghäusel soll auf Initiative des örtlichen Seniorenbeirats ein generationenübergreifender, integrativer Bürgertreffpunkt aufgebaut werden. Geplant ist ein niedrigschwelliges Angebot, das der wachsenden Gefahr sozialer Isolation und den Folgen sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. Das Angebot richtet sich nicht nur an ältere Bürger, sondern auch an Menschen in herausfordernden Lebenslagen, an Menschen mit Behinderung und an Menschen mit Migrationshintergrund. Intensive Bürgerbeteiligung und externe Beratung werden von Beginn an durchgeführt. das Modellvorhaben bildet die Grundlage zur Planung zukünftiger Quartiersentwicklungsprojekte im Landkreis.
Steigende Bedarfe nach ambulanten Versorgungsstrukturen und einer alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung im Landkreis Tübingen waren der Anlass für die Gründung der "Beratungsstelle Pflege-WG" für ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften. In Kooperation zwischen dem Landkreis Tübingen und dem Kreisseniorenrat Tübingen e.V. wurden mit Hilfe des Förderprogramms Quartier 2020 drei Bürgerinitiativen mit der Idee der Gründung und Umsetzung einer selbstverantworteten ambulanten Pflegewohngemeinschaft im Rahmen des Projekts begleitet und unterstützt. Im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 sind nun aus den Initiativen drei Vereine in Gründung im Tübinger Neckartal entstanden. Diese sollen nun in einem weiteren Prozess unterstützt, beraten und begleitet werden. Mit Hilfe der Quartiersimpulse haben Landkreis und Kreisseniorenrat in Kooperation mit der Stadt Tübingen das Ziel, die notwendige Unterstützung zu gewährleisten und die ehrenamtlichen Strukturen zu verstetigen und weiter auszubauen.
Das Generationenhaus im Zentrum der Stadt Balingen ist mit seinen vielfältigen Angeboten eine viel genutzte Anlaufstelle für Jung und Alt. Von der Kinderstube, einen Kleiderbasar und das Repaircafé bis hin zu Beratungsangeboten für Eltern, Senior*innen und Pflegebedürftige reichen die vielfältigen Aktivitäten, die vom Landkreis der Stadt Balingen und verschiedenen Vereinen getragen werden. Kernstück des Hauses ist der Cafétreff des Bürgerkontaktes. Neben offenen Cafénachmittagen organisiert der Bürgerkontakt viele weitere niedrigschwellige Angebote, wie z.B. Spielenachmittage und internationales Frauenfrühstück.
Die sich – insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel – verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sollen mit Hilfe des Projekts Quartiersimpulse zu einer Weiterentwicklung des Generationenhauses Balingen führen. Unter Beteiligung der Bürgerschaft werden Bedarfe ermittelt und passgenaue Lösungen entwickelt.
Kommunales Netzwerk zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (BE) auf Ebene der Landkreise. Die Federführung liegt beim Landkreistag Baden-Württemberg.
Entwicklung eines Konzeptes für den Aufbau eines landesübergreifenden Frauennetzwerkes. Beratung zu digitaler Vernetzung im ländlichen Raum über Landkreisgrenzen hinweg, bessere Nutzung von Angeboten, Veranstaltungen usw.
Der Kreisfrauenrat Ostalb plant den Aufbau eines landkreisübergreifenden Frauennetzwerks. Ziel des Netzwerkes ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit Themen wie „Beteiligung von Frauen“, „Geschlechtergerechtigkeit“ oder „Weiterentwicklung von Infrastrukturen im ländlichen Raum“. Die Beratung nutzt der Kreisfrauenrat für den Aufbau und die Etablierung des Netzwerks.
Ziel des Projekts ist es, nachbarschaftliche Strukturen zu festigen und die nachhaltige Vernetzung von Akteur*innen und Institutionen in Dietenheim zu etablieren. Der Alb-Donau-Kreis unterstützt beim generationengerechten Älterwerden im Quartier. So soll trotz des demografischen Wandels ein Verbleib in der gewohnten Umgebung so lange wie möglich realisiert werden können. Altersisolation soll vorgebeugt und die Teilhabe aller gesellschaftlicher Gruppen im Quartier ermöglicht werden. Intensive Bürgerbeteiligung mit Unterstützung durch die externe Beratung werden durchgeführt.
Gemeinsam mit dem Kreisseniorenrat Alb-Donau-Kreis möchte das Landratsamt wichtige Impulse zur Quartiersentwicklung setzen und generationenübergreifend und integrativ Vereinsamung und sozialem Ungleichgewicht begegnen.
Dazu wird ein aktives Quartiersmanagement in einer Kleinstadt im ländlichen Bereich erprobt, welches übertragbar sein könnte für andere Gemeinden des Alb-Donau-Kreises. Die Einbindung der integrierten Sozialplanung und des Pflegestützpunktes vor Ort stellt eine wichtige Komponente dar.
Das Projekt will die Bevölkerung zum Erhalt von Feldgehölzen ermutigen, die trotz ihrer wichtigen Funktionen für Natur, Mensch und Klima (Schatten, Feuchtigkeit, Erosionsschutz, Windschutz, Kohlenstoffbindung) vielerorts im Rückgang begriffen sind. Vor allem die Bedeutung für das Klima soll innerhalb des Projektes hervorgehoben werden. Der Austausch zwischen Landwirten und der Bürgerschaft wird fokussiert. Um die Motivation zu stärken setzt das Projekt auf die gemeinschaftliche Anstrengung beider Seiten (Ackerflurpaten-Konzept). Das beidseitige Engagement für Baum- und Heckenpflanzungen wird so zum sichtbaren Zeugnis eines Umdenkens auf Augenhöhe, das auch die Öffentlichkeit erreicht.
habito e.V. betreibt das Mehrgenerationenhaus Heidelberg und beschäftigt sich mit der Frage, wie ein gutes Leben in einer besseren Welt gelingen kann. Der Verein schafft generationsübergreifende Projekte, bietet ambulant betreutes Wohnen, schafft vielseitige Orte der Begegnung. Das Projekt "Lass uns zusammen..." ist eine nachbarschaftliche digitale Workshopreihe im Quartier Hasenleiser. Das wertvolle Wissen der Nachbarschaft im Quartier wird digital in einer besonderen Plattform für Interessierte angeboten. Im Rahmen des Workshops kann dieses Wissen miteinander geteilt werden. Ein Austausch der Generationen wird hergestellt und gemeinsame Angebote werden dabei entwickelt. Mit diesem Projekt wird zugleich die Bürgerbeteiligung gestärkt.
Die Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt des Altbaus der WG Fessenbach mit Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus ein. Hier wird ein neues und lebendiges Dorfzentrum für Jung und Alt, für Familien und Singles mit vielfältigen Möglichkeiten für Kommunikation, Nahversorgung und Veranstaltungen entstehen. Die Idee dazu hat sich währen eines Beteiligungsprozesses zur Nutzungskonzeption in Kooperation mit der Gemeinde herauskristallisiert. Beratung zu möglichen Trägerkonzepten, zur Rechtsform und zur Einrichtung des Treffpunkts.
Café Mondial Konstanz e.V. ist ein Begegnungszentrum für die Nachbarschaft und für einen (inter-) kulturellen Austausch. Der Verein möchte sich in Zukunft mehr gegenüber dem Quartier öffnen und seine Angebote an die Bedarfe weiterer Zielgruppen anpassen bzw. erweitern. Eine sorgfältige Themen- und Akteursanalyse ist geplant, die die Grundlage für weitere Beteiligungsprozesse im Stadtteil bilden soll. Dafür erhält der Verein qualifizierte Beratung.
Das Orschel-Hagen Forum, als Zusammenschluss verschiedener sozialer und gemeinnütziger Akteure im Stadtteil, verfolgt seit vielen Jahren im Sinne der jetzigen und zukünftigen Bewohner (zwei Neubaugebiete sind geplant) die Förderung eines sozialen Miteinanders und die Festigung eines Wir-Gefühls im wachsenden Quartier. Das Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit der Bürgerschaft zu überlegen, welche Strukturen für eine gute Quartiersentwicklung für ein aktives Leben von Jung bis Senioren in Orschel-Hagen gebraucht werden und diese anschließend umzusetzen. Beratung zu Evaluierung von bestehenden Strukturen der Beteiligung und Gemeinwesenarbeit evaluiert und zur fachlichen Unterstützung bei der Projektplanung.
Das Forum Orschel-Hagen ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren im Reutlinger Trabantenstadtteil Orschel-Hagen. Mitglieder sind zum Beispiel Vertreter der örtlichen Grundschule, der Stadtteilbibliothek oder einer Bürgerinitiative. Vor Ort sind derzeit zwei neue Wohngebiete geplant, auf deren Fertigstellung die Gruppe mit einer frühzeitigen Quartiersentwicklung reagiert. Die Auftaktveranstaltung des Prozesses wird als Nikolausfest ausgerichtet. Auf dem Fest werden bereits vor Ort wohnende Menschen aktiv angesprochen und eingeladen, sich in der Quartiersentwicklung einzubringen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten wie zum Beispiel Einladungsflyer finanziert, die durch die Ausrichtung des Fests anfallen.
Die Mitglieder*innen von LebensWunsch verbindet der Wunsch nach einem nachhaltigen und lebendigen Lebens- und Wohnprojekt. Sie bietet ein starkes gemeinschaftliches Leben und gleichzeitig der Bevölkerung einen Ort für Begegnungen zur Stärkung von Gemeinschaften. Die Schwerpunkte liegen dabei in einer naturnahen und nachhaltigen Lebensweise und in sozialen, kreativen sowie kulturellen Angeboten, die der Umgebung und der Nachbarschaft einen Mehrwert bieten. Die Beratung erfolgt zu den Themen Gemeinschaftsbildung, Projektentwicklung (u.a. passende Rechts- und Finanzierungsform), planerischen Umsetzung der angestrebten Nutzung, Anleitung zur Moderation von Gruppensitzungen und Veranstaltungen sowie Begleitung bei Gesprächen auf kommunaler Ebene.
LebensSpielRäume ist ein Quartiersprojekt in einem bestehenden Gebäudekomplex (zwei Häuser + Garten) mit rund 250 m² Nutzfläche in Freiburg-Wiehre. Das Ziel der Initiative ist es den Raum für Menschen in Unterschiedlichen Lebensaltern und –lagen, für Begegnung, Prävention, Bildung und Therapie, für Körperarbeit und Bewegung, für Kreativität und Kunst sowie für Persönlichkeitsentfaltung und Spiritualität zu schaffen. Das Projekt wird durch solidarisches und nachhaltiges Wirtschaften und soziale Teilhabe ermöglicht. Beratung rund um die Entstehungsphase: künftige Rechtsform, Struktur, Finanzierungsmodell und zukunftsfähige Organisation.
Elf Mädchen aus dem Raum Sindelfingen, Böblingen und Herrenberg engagieren sich seit Herbst 2016 im Medienprojekt "Lebenswege-Zeitung". Sie interviewen Bürgermeister, Staatsrätinnen, Menschen mit Fluchterfahrungen oder Weihnachtsmarktbesucher. Die Teilnehmerinnen sind zwischen neun und 15 Jahre alt und stammen aus Familien mit und ohne Zuwanderungserfahrung. Sie schreiben Berichte, machen Fotos und Videos und stellen sich und ihre Arbeit im Herbst in einer Projektzeitung sowie einer Ausstellung bei den Literaturtagen in Sindelfingen vor. Ola Momen vom NISA-Frauenverein e.V. Sindelfingen leitet, und die Journalistin und Autorin Liane von Droste begleitet und berät das Projekt.
Der Verein „ARGE für Waldsprechtweier e.V.“ möchte einen Beteiligungsprozess zur Stärkung der „historischen“ Dorfmitte in Waldsprechtweier initiieren. Gemeinsam soll ein Konzept entwickelt werden zum Erhalt einer funktionsfähigen und identitätsstiftenden Ortsmitte. Beratung erhält der Verein zum Prozessmanagement des Beteiligungsprozesses.
Das Ziel der Initiative ist es, Vorschläge für ein attraktives und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für ältere Menschen im Teilort Öschingen zu erarbeiten, im Hinblick auf den demografischen Wandel. Beratung zu Wohnformen für ältere Menschen, zu Betreuung und Versorgung.
Die Initiative engagiert sich für das Thema altersgerechtes Wohnen und Betreuung in der Dorfgemeinschaft und auch im Ortschaftsrat mit dem Ziel, die Vorschläge für ein attraktives und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für ältere Menschen in Öschingen zu erarbeiten. Die Seniorengemeinschaft in Riedlingen dient dabei als Vorbild. Dieses Modell für Dienstleistungen wird zuerst in einer Infoveranstaltung vorgestellt, um die Bürgerschaft im Hinblick auf den demografischen Wandel zu sensibilisieren und die notwendigen Schritte zur Umsetzung von Nachbarschaftsstrukturen aufzuzeigen. Der zweite Schritt besteht aus einer Umfrage in Öschingen. Die Initiative erwartet dadurch eine breite, aktive Beteiligung und viele Anregungen für die Verbesserung der Lebensqualität im Ort.
Durch die Schließung des Altenwohnheims und der Himmelfahrtskirche im Stuttgarter Stadtteil Schönberg entfallen zwei wichtige Anlaufstellen für die Menschen vor Ort. Die Initiative setzt sich für ein integratives, inklusives und lebenswertes Schönberg ein und zeigt somit auf, wie eine soziale Quartiersentwicklung in Zukunft gelingen kann. Bei der Erarbeitung zur Bestandsaufnahme, Herausforderungen, Zeilgruppen, Zielsetzungen und Maßnahmen bekommt die Initiative Beratung.
Landesweite Vernetzung ehrenamtlicher Energie- Initiativen (LEE) mit örtlichen Beispielen zu Energie- genossenschaften und Bürgerenergieprojekten. Örtliche Projekte werden in Abstimmung noch genau festgelegt.
In Form eines Einwohnerworkshops möchte die Spurgruppe Tengen gemeinsam mit der Bevölkerung ein Leitbild für die Stadt erarbeiten. Das Leitbild soll zukünftig als gemeinsame Grundlage für Verwaltung, Bürgerschaft, Wirtschaft und Vereine dienen. Besonders wichtig ist hierbei das Thema „Zusammenhalt und Zusammenarbeit der einzelnen Teilorte“. Beratung erhält die Spurgruppe zum Vorgehen der Leitbilderstellung und der Prozesskoordination des Einwohnerworkshops.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung Rottweil möchte die Initiative einen Leitfaden für mitgestaltende Bürgerbeteiligung im Rahmen des Prozesses „Implementierung der Agenda 2020“ erstellen. Dafür benötigt die Initiative eine Beratung zur Prozessbegleitung.
Leutkircher Bürger kaufen ihren Bahnhof. Leutkircher Bürger sanieren Ihren Bahnhof. Leutkircher Bürger beleben Ihren Bahnhof wieder
Das Jugendhaus „Bohrturm“ Bad Dürrheim möchte ein zusätzliches Angebot für Jugendliche über 16 schaffen. Wie dieses Angebot aussehen könnte, sollen die Jugendlichen selbst mitbestimmen können. Durch die Abfrage der Bedarfe soll gemeinsam mit den Jugendlichen ein passendes Konzept entwickelt werden. Beratung zur Durchführung des Projektes erhält das Jugendhaus zum Thema Projektmanagement der Jugendbeteiligung.
Die Lokale Agenda Plankstadt ist ein interparteiliches Bürgerprojekt, bei dem jeder Bürger Ideen einbringen und mitmachen kann.
Der Verein AllWeDo engagiert sich mit Beteiligungsformaten für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte. Beispielformate in der Vergangenheit waren zum Beispiel die Marktplatzgespräche oder das Freiburger Netzwerktreffen. Um den Herausforderungen der Corona-Pandemie zu begegnen, findet im Freiburger Stadtteil Haslach eine lokale, virtuelle Bürgerkonferenz statt. Die Konferenzergebnisse werden von den Bürgern weiter ausgearbeitet und möglichst auch im Stadtteil umgesetzt. Zu bearbeitende Herausforderungen und Bedarfe der Bürger für das Quartier werden im Vorfeld der Konferenz auf einer Online-Plattform gesammelt. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für das Honorar der Hauptmoderation der Bürgerkonferenz anfallen.
Der Verein AllWeDo engagiert sich mit Beteiligungsformaten für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte. Beispielformate in der Vergangenheit waren zum Beispiel die Marktplatzgespräche oder das Freiburger Netzwerktreffen. Um den Herausforderungen der Corona-Pandemie zu begegnen, findet im Freiburger Stadtteil Vauban eine lokale, virtuelle Bürgerkonferenz statt. Die Konferenzergebnisse werden von den Bürgern weiter ausgearbeitet und möglichst auch im Stadtteil umgesetzt. Zu bearbeitende Herausforderungen und Bedarfe der Bürger für das Quartier werden im Vorfeld der Konferenz auf einer Online-Plattform gesammelt. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Pressearbeit der Bürgerkonferenz anfallen.
Beim Projekt „Stadtteilkonferenz“ geht es darum, in dem stetig wachsenden Freiburger Stadtteil Haslach in einem breit angelegten Diskussionsprozess dringende Probleme zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Umsetzungsmöglichkeiten für die Vermeidung von Durchgangsverkehr in Wohnquartieren und die Verkehrsberuhigung des Stadtteilzentrums, beides mit dem Ziel, die Lebensqualität im Stadtteil und dabei vor allem die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu steigern. Die Veranstaltungen werden in Kooperation des Lokalvereins Haslach mit der Bürgerinitiative Fuß- und Radentscheid Freiburg durchgeführt und schaffen einen Raum für akute Verkehrsfragen im Stadtteil. Die Beratung erfolgt zur Gestaltung der Diskussionsformate, auch online und zur Erreichung von Menschen vor Ort.
Die Kinderspielstadt wird von einem ehrenamtlichen Team alle zwei Jahre in Ammerbuch organisiert und durchgeführt. In der Kinderspielstadt üben Kinder Berufe des alltäglichen Lebens spielerisch aus und stellen Produkte und Dienstleistungen bereit, die für das Zusammenleben in der "Stadt" gebraucht werden. Die Kinder erleben dabei gesellschaftliche Prozesse, übernehmen Verantwortung, üben sich im sozialen Miteinander und erfahren ihre Selbstwirksamkeit. Durch das Tragen eines Spielstadt-Shirts solidarisieren sich die Beteiligten und entwickeln ein Wir-Gefühl.
Die Initiative Dorftreff entstand aus dem Interesse der Bevölkerung von Römlinsdorf, einem Teilort von Alpirsbach, ihr Dorf für Jung und Alt attraktiver zu gestalten und der Landflucht entgegen zu wirken. In regelmäßigen Treffen sammeln die Bewohner Ideen dazu, bewerten diese nach Dringlichkeit und Realisierbarkeit. Hier geht es um die Entstehung eines Treffpunkts für alle Generationen sowie um eine tragfähige Struktur für die organisierte Nachbarschaftshilfe. Der Beratungsgutschein wird für die Realisierbarkeit von Projekten unter fachkundiger Begleitung genutzt.
Die Initiative lädt regelmäßig die Bevölkerung von Römlinsdorf zu Dorftreffen ein. Während eines Beratungsprozess haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die Projekte umsetzen.
Eine Arbeitsgruppe organisiert einen wöchentlichen Regionalmarkt, bei dem umliegende Kleinerzeuger vertreten sind. Ebenso können Vereine, Kindergärten und Kirchen sich mit ihren Aktivitäten beteiligen.
Eine weitere Arbeitsgruppe bereitet die Neugestaltung des einzigen Spielplatzes in Römlinsdorf vor, der in einem sehr schlechten Zustand ist. Unter Anleitung eines professionellen Beraters können die Bewohner selbst mit Hilfe der Stadt Alpirsbach den Spielplatz neugestalten.
Für die Eröffnung des Wochenmarktes werden die Bürger mit Flyern in den Briefkästen eingeladen. Zudem werden Info-Tafeln aufgestellt, um auf die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft und die Gestaltung des Spielplatzes hinzuweisen.
Netzwerk für 50 Einrichtungen der Familienselbsthilfe
Die Initiative „MachEbbes Bürgerbeteiligung Ehningen“ hat es sich zum Ziel gesetzt, den Ortskern (wieder-) zu beleben und dem Ladensterben im Ort etwas zu entgegnen. Im Trialog zwischen Bürger, Gemeinderäten und Gemeindeverwaltung sollen Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität und die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde gemeinsam gefunden werden. Beratung erhält die Initiative zur Ausgestaltung eines Beteiligungsprozesses.
Die Initiative Kultur für Alle aus Stuttgart verfolgt das Ziel, Menschen mit wenig Geld die kostenfreie Teilhabe an Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. An einem Spätsommerfest kommen Mitglieder des dazugehörigen Vereins, die Trägerorganisationen, Kultureinrichtungen, Sportvereine und interessierte Personen aus der Lokalpolitik zusammen. Das Fest stellt das Thema Inklusion in Stuttgart in verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft in den Vordergrund. Teil des Festprogramms ist ein Vortrag und Austausch mit Simone Fischer, der Beauftragten der Landeshauptstadt Stuttgart für die Belange von Menschen mit Behinderung. Mit dem Beteiligungstaler werden Sachkosten für Raum- und Veranstaltungstechnik sowie für das Rahmenprogramm des Fests finanziert.
Aus dem Programm "Integration durch Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" hat sich das Bürgernetzwerk "Engagiert zusammenleben in Dielheim" gegründet. Dieses besteht aus unterschiedlichen Gruppen, die z.B. in den Bereichen Geflüchtete, Klimaschutz und Zusammenleben aktiv sind. Auch die Gruppe Malatelier ist Teil des Bürgernetzwerks und bietet gemeinsames Malen für alle an. In einem geschützten Rahmen kommen Menschen zusammen, um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten und dabei sich emotional auf ganz andere Weise ausdrücken zu können. Entspannung und Reflexion sind hierbei möglich. Das Angebot ist offen für alle, für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Es wird stetig weiterentwickelt, z.B. mit dem Angebot Gestaltung mit Ton.
Fossil Free Karlsruhe setzen sich für eine Bürger*innen-Energiewende hin zu Erneuerbaren Energien ein. Sie orientieren sich dabei am 1,5 Grad Ziel und dem Pariser Abkommen.
Im Rahmen des Wattbewerbs zum Ausbau von Photovoltaik findet begleitend ein Malwettbewerb in Kitas und Schulen statt. Damit soll die Idee der Photovoltaik in die breite Bevölkerungsschichten getragen werden. Kinder und Jugendliche in Schulen basteln und malen ihre Ideen einer Zukunft mit Sonnenenergie. Über die Kinder kommen auch die Eltern in Kontakt mit der Thematik. Um Kinder und Jugendliche an der Teilnahme zu motivieren, werden Preise ausgelobt.
Initiative "Runder Tisch" Marbach GbR






Mit dem Projekt sollten interessierte Bürger angesprochen werden, die Ideen haben, Marbach am Neckar aktiv zu gestalten und sich einzubringen. Es sollte gemeinsam der Frage nachgegangen werden: Wie kann ein Bürgerzentrum im Stadtkern entwickelt werden?
Ziel ist und war der Aufbau eines Netzwerks, die Sammlung von Meinungen, deren Aufbereitung und Ausgestaltung. Als Projektabschluss wurde das Ergebnis den Bürgern, dem Bürgermeister, der Stadtverwaltung sowie dem Gemeinderat vorgestellt.
Die Nähstube Marbach ist eine Gruppe von ehrenamtlichen Nähern, die während der Corona-Pandemie Behelfsmasken für Einrichtungen und Bürger der Stadt nähen. Die Gruppe verfügt über eine über eine Hauptansprechpartnerin, die Bürger zu den Behelfsmasken berät. Die Ehrenamtlichen leisten mit der Nähaktion einen solidarischen Beitrag vor Ort und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gemeinsam mit der Stadt Marbach hat die Initiative in der örtlichen Presse einen Aufruf gestartet, um die Einwohner auf dieses Masken-Angebot aufmerksam zu machen und weitere ehrenamtliche Näher für das Projekt zu gewinnen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Nähmaterialien der Gruppe anfallen.
Die MarhaBAR in Achern hat durch das Angebot von ausländischen Speisen das soziale Miteinander in Achern gefördert. Zusätzlich wurden in den Räumen der MarhaBAR Vorträge mit anschließenden Gesprächsrunden zu gesellschaftspolitischen Themen durchgeführt.
Der Freundeskreis Asyl ist aus einer Vernetzungs- und Kooperationsinitiative hervorgegangen. Daraus sind verschiedene Untergruppen zu den jeweiligen Unterstützungsschwerpunkten entstanden: Patenschaften, Sprachen, Café International, Möbelkreisel, Freizeit für Mütter, Fahrradwerkstatt usw. Ein Koordinationsteam schafft Strukturen für bis zu 100 Engagierte und koordiniert die Absprachen. Integration wird als wechselseitiger Prozess verstanden. Nach den ersten Jahren haben sich die Unterstützungsmöglichkeiten verfestigt, die jetzigen Strukturen müssen auf das Fernziel der Integration überdacht werden und notwendige Veränderungen und Neuausrichtungen diskutiert werden. Im ersten Schritt wurde ein Fragebogen zu Erfahrungen mit Geflüchteten erarbeitet und ausgewertet. Mit dem Projekt "Markdorfer Integrationsprozess: Neue Wege suchen - neue Wege finden" werden bisherige und zukünftige Akteure zu einer Integrationswerkstatt eingeladen, um den Veränderungsprozess gemeinsam zu diskutieren.
Die MGH Initiative „Auf den Härten“ Kusterdingen plant im Ort ein Mehrgenerationenhaus einzurichten. Mit dem Projekt soll die Idee verwirklicht werden, dass es sich im gegenseitigen Austausch und mit gegenseitiger Unterstützung besser lebt. Unterstützung und Beratung erhält die Initiative zur Erarbeitung von Lösungsansätzen, Fragen zu rechtlichen und baulichen Voraussetzungen und für die Moderation des Entscheidungsprozesses.
Eine Bürgergruppe plant in Lahr ein Mehrgenerationen-Wohnen damit die Nachbarn unterschiedlichen Alters und mit verschiedensten biografischen Hintergründen in einem gemeinsamen Wohnumfeld zusammenkommen (inklusive Einrichtung einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung). Beratung wird zur Entwicklung eines Konzeptes und zur Klärung der Trägerschaft des Mehrgenerationenwohnen eingesetzt.
Die Initiative „Miteinander Wohnen Lahr“ arbeitet an einem gemeinschaftlichen Wohnkonzept. Menschen sollen dabei so lange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben können. Nachbarschaftliche Hilfsstrukturen ergänzen im Konzept der Gruppe die vorhandenen Pflegedienstleistungen in Lahr, damit Menschen Begegnungen und stetigen Austausch im Wohnumfeld haben. Auch die Schaffung zusätzlicher Wohnbereiche für am Wohnmarkt benachteiligte Gruppen, wie zum Beispiel wohnsitzlose Frauen, sieht das Konzept vor. In einem weiteren Schritt ist angedacht, vor Ort ein Nachbarschaftsbüro im Quartier zu etablieren, indem Anwohner Rat einholen oder weitergeben können. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für Druckkosten eines Infoflyers über das Projekt anfallen.
Der ehrenamtlich betriebene Bevölkerungsschutz des Johanniter-Ortsverbands Mannheim zielt darauf ab, im Rahmen des Betreuungs- und Verpflegungsmoduls auf nachhaltiges Handeln umzustellen. Statt Einwegplastik wird künftig bruchsicheres Mehrweggeschirr für die Getränke- und Mahlzeitausgabe verwendet. Dies ermöglicht eine ressourcenschonende, abfallreduzierte und klimafreundliche Verpflegung in Notfällen und Großschadenslagen.
Integrative Wohnformen e.V.
Podcasts sind in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Informationsquellen aufgestiegen. Ob im Auto, beim Putzen oder gemütlich auf dem Sofa – fast überall kann man sich den per Handy oder Computer abrufbaren Mediendateien widmen. Die Themenpalette, die in Podcasts behandelt wird, ist sehr variantenreich und durch ein Projekt im Förderprogramm „Nachbarschaftsgespräche“ noch um eine Facette bereichert worden.
In einer Workshop-Reihe mit dem Titel #meineDigitaIeNachbarschaft – Wie bringt uns das Netz zusammen? hat der Verein Integrative Wohnformen ältere Menschen aus dem Stuttgarter Stadtteil Fasanenhof eingeladen, sich mit den digitalen Möglichkeiten und ihrer Bedeutung für eine gute Nachbarschaft auseinanderzusetzen. Der Clou: In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) fanden die Workshops zwar analog statt; sie wurden jedoch digital in einer Podcast-Serie mit den Bewohnern dokumentiert.
Damit möglichst viele Bewohner im Fasanenhof erreicht werden konnten, fanden die Workshops in der unmittelbaren Nachbarschaft in einem Quartierstreffpunkt am Europaplatz statt. An drei Terminen wurde gemeinsam mit den Teilnehmenden die Frage geklärt: Wie kann der soziale Zusammenhalt gestärkt und die Lebensqualität im Quartier verbessert werden? Und welche Möglichkeiten bieten Digitale Tools hierbei?
Gemeinsam wurde überlegt und erzählt, was es an digitalen Angeboten bereits im eigenen Wohnquartier gibt und welche Erfahrungen die Teilnehmenden damit bisher gemacht haben. Ebenso besprochen wurde, welche digitalen Formate es zukünftig noch braucht, um den Zusammenhalt im Quartier weiter zu stärken.
Während des Kurses kamen dann auch Fragen auf, die über das Thema Nachbarschaft und Podcasts hinausgingen: Ein allgemeiner Einblick in die sich immer schneller wandelnde digitale Welt war gefragt, wobei manche Teilnehmende bisher selbst zum Beispiel noch kein Smartphone besaßen. Mit der Zeit fanden aber sowohl Einsteiger in das Thema wie auch Fortgeschrittene gut zusammen in den drei Workshops.
Mit der Veröffentlichung der Podcast-Folgen im Internet können hoffentlich ähnliche Prozesse in anderen Quartieren angeregt werden. Auch wir von der Allianz für Beteiligung haben mit Interesse in die Podcast-Reihe hineingehört und freuen uns, wenn die Reihe vielen Menschen Freude bereitet und zur weiteren Debatte digitaler Möglichkeiten – gerade auch in der Quartiersentwicklung – anregt.
Der Verein s' Blochinger Wichtele wurde durch den Runden Tisch Fonds für Beteiligung initiiert und hat die zielgruppenübergreifende Teilhabe, basierend auf einem breiten Inklusionsverständnis zum Ziel. Er fungiert als Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und ist Partner der Stadt Mengen in Projekten der Strategie Quartier2030.
Mit Hilfe moderner Technik möchte der Verein innovative Beratungs- und Informationsangebote aufbauen und damit verstärkt Teilhabe sowie bürgerschaftliche Vernetzung fördern. Bürgern, die aufgrund unterschiedlicher Gründe nicht an analogen Veranstaltungen teilnehmen können, wird über hybride Veranstaltungsformate die Möglichkeit der Teilhabe an Informations-, Beratungs- und Bildungsangeboten des Vereins gegeben.
Das „Netzwerk Generationenhaus Möhringen" ist ein Zusammenschluss aus gemeinnützigen Organisationen, Bürgern sowie dem Bezirksamt des Stuttgarter Stadtteils Möhringen. Das Netzwerk sieht sich als Ideengeber und ideelles Dach von Möhringer Organisationen und Bürgerschaft. Neben dem jährlich veranstalteten inklusiven Beteiligungsprojekt "Kunst.Gemeinsam.Machen" wird zusätzlich ein spezielles Jahresthema durch das Netzwerk aufgegriffen. Aktueller Schwerpunkt ist das Thema Migration und Integration. Um sich den Themen vor Ort zu nähern und neue Kooperationen anzuregen, bietet das Netzwerk zum Beispiel einen thematischen Stadtteilspaziergang an. Dieser führt Interessierte zu allen Einrichtungen in Möhringen, die sich mit den beiden Themen befassen. Der Fokus liegt auf der Situation von Migranten sowie anderen Randgruppen vor Ort. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerks und dessen Themenreihe finanziert.
Informiert wird von einer Expertin über die Wichtigkeit und Vorteile von Hausbäumen. Ziel ist es, die Biodiversität vor Ort zu steigern. Hierfür werden über 30 Bäume an verschiedenen Stellen in Bötzingen gepflanzt. Die Bäume werden unter fachmännischer Anleitung und Begleitung gepflanzt, sodass ein Anwachsen möglichst gewährleistet wird. Grenzabstände werden eingehalten, somit wird der richtige Baum an der richtigen Stelle gepflanzt. Durch die Anleitung und Durchführung erhalten Menschen die Erfahrung der Selbstwirksamkeit.
Das Handeln der Menschen wird durch Fotos festgehalten und in eine digitale Landkarte eingepflegt. Zu Weihnachten soll sich ein Gefühl etwas sehr Gutes vor Ort in Gemeinschaft mitgestaltet zu haben einstellen. Weitere Menschen werden durch diese Aktion und bildhafte Ergebnisse motiviert, ein Teil der Klimaschutzbewegung zu werden. Bestenfalls entsteht ein ''Wir-Gefühl" und die Menschen gewinnen wieder mehr Zuversicht in die Zukunft.
Der Bürgerverein der Oststadt e.V. in Karlsruhe bringt Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung des Stadtteils bei der Stadtverwaltung vor und unterstützt Projekte zur Verbesserung des Zusammenlebens und der Integration sowie der Förderung von Jugend und Senioren.
Mit dem aktuellen Projekt werden Miniplätze in Kooperation mit Studierenden des KIT im Stadtteil gebaut, um die Kommunikation und das Zusammenleben unter den Bewohner zu fördern, vor allem auch zu Klimaschutzthemen wie Teilen, Tauschen, Reparieren und Gärtnern. Zudem bieten die Orte einen abkühlenden Aufenthalt im Freien unter Straßenbäumen bei Hitzeperioden. Bürger werden aufgerufen, sich am Bau und Gestaltung der Plätze zu beteiligen. Im Vorfeld wurden diese bereits in der Ideenphase einbezogen. Nach Fertigstellung der Miniplätze gestalten Bürger an diesen neuen Räumen, Angebote zum Mitmachen und Teilen.
Eine Gruppe von Ehrenamtlichen hat sich zum Arbeitskreis Bücherei zusammengefunden, um die Bücherei in Mehrstetten ehrenamtlich zu betreiben. Ziel ist es, die Bücherei attraktiv zu halten, die Öffnungszeiten und den Medienbestand auszubauen und die Buchleihe zu digitalisieren. Zudem soll die Bücherei ein Ort des Verweilens und Kennenlernens werden, dazu ist der Betrieb eines Cafés und kulturelle Veranstaltungen geplant. Die Bürger*innen finden hier einen Raum für bürgerschaftliches Engagement und können sich beim Betrieb der Bücherei beteiligen oder Projekte anstoßen wie z.B. Lesepaten, Autorenlesungen, Kooperationen mit Grundschulen, etc.
Der FC Esslingen möchte ein Sportangebot schaffen, das Esslinger_innen unabhängig von Alter, Herkunft, Status und Geschlecht zusammenbringt. Über den Sport sollen Begegnungen ermöglicht werden.
Das Projekt setzt sich aus 5 Bausteinen zusammen:
- Sport
- Gemeinschaft/ Netzwerken/ Austausch
- Schulung für Trainer + Multiplikatoren
- Mitwirkung: Vielfalt im Verein und Quartier leben
- Steuerung/ Orga/ Netzwerkaufbau/ Durchführung
Der Verein Freunde und Förderer der Schillerschule Aalen e.V. möchte mit einem Theaterprojekt „Miteinander in Vielfalt“ zur Integration von Flüchtlingskindern beitragen. Das Theaterprojekt soll in Zusammenarbeit mit zwei Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, bürgerschaftlich Engagierten, dem Theater der Stadt Aalen, der Stadt Aalen selbst und Schulen durchgeführt werden. Ziel des Projektes ist, durch die aktive Teilnahme am sozialen/ kulturellen Leben in Aalen das Selbstbewusstsein aller Akteure zu steigern und die Integration zu befördern. Beratung erhält der Verein zu Planungs- und Projektfragen sowie zur pädagogischen Arbeit mit Flüchtlingskindern.
Das Projekt "miteinander. füreinander. aber wie?" wurde im Rahmen von "Nachbarschaftsgespräche" gefördert. Per Zufall ausgewählte unterschiedliche Personengruppen haben sich mit den Fragen des Zusammenlebens in der Zukunft befasst. Aus diesen Gesprächen gewonnene Ergebnisse sollen nun in eine tragfähige bürgerschaftliche Struktur übertragen werden. Dafür werden Arbeitsgruppen zu den Themen "Hilfe und Unterstützung", "Mobilität", "Kommunikation & (Standort)Marketing" und "Engagement und Ehrenamt" gebildet. Beratung zur Initiierung von Arbeitsgruppen, zu Strukturierung von Projektideen, zur Bildung von festen Strukturen.
Im Projekt "miteinander. füreinander. aber wie?" befassen sich per Zufall ausgewählte Personengruppen mit Fragen des künftigen Zusammenlebens. Aus diesen Gesprächen gewonnene Ergebnisse werden nun in eine tragfähige bürgerschaftlichen Struktur übertragen. Dafür wurden Arbeitsgruppen zu den Themen "Hilfe und Unterstützung", "Mobilität", "Kommunikation & (Standort)Marketing" und "Engagement und Ehrenamt" gebildet. Die Beratung bekam die Initiative zur Initiierung von Arbeitsgruppen, zu Strukturierung von Projektideen, zur Bildung von festen Strukturen.
Die Bürgerinitiative Füreinander-Miteinander aus Graben-Neudorf setzt sich für die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse ein. Durch die Einrichtung von Mitfahrbänken soll die Mobilität und Anbindung an urbane Gebiete verbessert werden. Beratung erhält die Initiative zu Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und Rechtsfragen.
In Dußlingen sollen Mitfahrbänke entstehen, die vor allem auch die Mobilität von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger verbessern sollen. Bevor das erste „Mitfahrbänkle“ markiert wird, ist jedoch eine öffentliche Veranstaltung geplant. Damit soll eine systematische Beteiligung der Zielgruppen bei der Projektverwirklichung gewährleistet werden. Beratung erhält der Verein zur Umsetzungsplanung des Projekts sowie zum Monitoring der angedachten Beteiligungsschritte.
Die Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für soziale Teilhabe am öffentlichen Leben. Die Mitfahrbänke, als Ergänzung des ÖPNV, tragen zur Verbesserung der Mobilität von älteren Mitbürger bei. HINSETZEN - EINSTEIGEN - MITFAHREN. Insgesamt 20 Standorte sind geplant, 8 Bänke sind bereits in Betrieb. Der Beratungsgutschein wurde zur weiteren Umsetzungsplanung sowie zur Etablierung und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Der Verein startete ein Video-Wettbewerb für Schüller*innen mit positiver Botschaft über die Mitfahrbänke.
Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für soziale Teilhabe am öffentlichen Leben. Die Mitfahrbänke, als Ergänzung des ÖPNV, tragen zur Verbesserung der Mobilität von älteren Mitbürgern bei. HINSETZEN --> EINSTEIGEN --> MITFAHREN. Insgesamt sind 20 Standorte geplant, 8 Bänke sind bereits in Betrieb. Die Beratung zur weiteren Umsetzungsplanung sowie zur Etablierung, ÖA. Aktuell: Video-Wettbewerb für Schüler mit positiver Botschaft über die Mitfahrbänke.
Die Gruppe Woman's Peace Table besteht aus geflüchteten und bereits länger vor Ort wohnhaften Frauen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kleines Wiesental im Südschwarzwald werden Mitfahrbänke aufgestellt. Die Bänke tragen zu einer Verbesserung der Mobilität vor Ort bei. Ziel der Gruppe ist es, den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen sowie Gelegenheiten zur Kommunikation bei den Mitfahrten zu ermöglichen. Die Bänke werden gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort aufgestellt. Mit dem Beteiligungstaler werden Mitfahrbänke für das Projekt finanziert.
Die AG Energie und Umwelt ist eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe, die aus dem Prozess für ein Dorfentwicklungskonzept in Bodnegg hervorgegangen ist. Die Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und organisiert verschiedene Veranstaltungen zum Thema zusammen mit der Gemeinde. Mit einem Mitfahrbank-Projekt arbeitet die Gruppe an der besseren Erreichbarkeit des Bodnegger Ortsteils Rotheiden, der fast 700 Meter höher als der Hauptort liegt. Weder zu Fuß oder per Nahverkehr ist Rotheiden einfach zu erreichen. Mit den Mitfahrbänkle schafft die Gruppe Abhilfe. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für den Kauf der Bänke anfallen.
Das Projekt realisiert eine Mitfahr-Lösung für verschiedene Teilorte, die aus einer Reihe von ausgewählten Mitfahrpunkten und Mitfahrbänken besteht. Insbesondere durch eine breite Bürgerbeteiligung wird somit eine soziale und generationenverbindende Mobilität erreicht. Beratung erfährt die Initiative u.a. zu den Themen Standortsuche, Digitalisierung und Ausbau.
Der Stadtteil Ulm-Lehr unterstützt neue Wohn- und Unterstützungsformen für Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf, angesichts einer wachsenden Zahl von hilfe- und pflegebedürftigen Bürgerschaft, schrumpfenden personellen Ressourcen und neuer gesellschaftlichen Herausforderungen. In der Ortsmitte entsteht ein innovatives Angebot mit Wohn-, Unterstützung- und Begegnungsformen, das professionelle Hilfe sowie bürgerschaftliches Engagement gleichermaßen einbindet. Der Verein NachbarLe e.V. entwickelt gemeinsam mit der Bürgerschaft und der Kommune das Projekt "Mittendrin - Gemeinsam Älterwerden in Lehr". Beratung erhält der Verein zu Umsetzung der Grundidee auf Basis der Bürgerbeteiligung, zur Entwicklung integrativen Wohn-, Unterstützungs-, Begegnungsformen.
Das Bürgerbusteam organisiert ehrenamtliche Fahrten mit dem Bürgerbus für sozial schwache Bürgerschaft in Murrhardt, damit alle innerhalb der Gemeinde mobil sein können. Auf dem Gebiet der Stadt liegen 76 separat gelegen Wohnorte. Dort gibt es ausreichend Personen, die den öffentlichen Nahverkehr und bestehende Personenbeförderungsangebote nur eingeschränkt nutzen können , über kein eigens Auto verfügen oder dieses nicht mehr selber fahren. Für das Bürgerbusangebot besteht theoretisch genügend Bedarf. Zurzeit wird an einem Tag in der Woche ein Bürgermobil angeboten, um die tatsächliche Nachfrage in den Praxis zu ermitteln. Das Fahrzeug gehört der evangelischen Kirche und kann nur montags dafür genutzt werden. Die Bevölkerung wird regelmäßig über das Vorhaben der Initiative informiert, um das Projekt dauerhaft vor Ort zu etablieren.
Die Initiative Tauschregal besteht aus Bürger, die vom Konzept Tauschen anstatt Wegwerfen überzeugt sind und weitere Menschen davon begeistern möchten.
Bücher, Kleidung und Alltagsgegenstände werden durch Bürger in den Austausch gebracht. Durch das mobile Tauschregal kann ein coronakonformer Austausch im Freien gewährleistet werden und Begegnung stattfinden. Im doppelten Sinne wird das Tauschregal zum Ort des Austauschs, zum einen für Gegenstände und zum anderen für den Austausch zwischen Bürger*innen über Interessen, Hobbies und Gemeinsamkeiten.
Die Bürgergemeinschaft Grünkraut organisiert vor Ort Hilfen und Unterstützungsangebote auf ehrenamtlicher Basis für Senioren. Die Gruppe verbessert mit dem Projekt „Mobilität im ländlichen Raum“ die Lebensqualität von Senioren mit einem Mitfahrbankmodell. Das Modell ermöglicht den Senioren zum Beispiel, mit den Einkäufen vom örtlichen Nahversorger, der nicht direkt im Dorfzentrum liegt, wieder sicher bis vor die eigene Haustüre zu kommen. Den Fahrdienst übernehmen engagierte Bürger. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Anschaffung der Mitfahrbänke anfallen.
Das Seniorenzentrum St. Lukas stößt zusammen mit den Bürgern einen Beteiligungsprozess an. Diskutiert wird, wie die Mobilität der Bewohner in Wernau verbessert werden kann. Hierbei liegt der Fokus nicht nur auf Senioren. Ansichten verschiedener Gruppen erhalten im Beteiligungsprozess Raum. Für die Zusammensetzung der Workshops wird auf die Methode der Zufallsbürger zurückgegriffen, damit möglichst unterschiedliche Menschen im Prozess teilnehmen. Mit dem Beteiligungstaler werden Cateringkosten sowie Sachkosten, die bei der Vorplanung der Workshops anfallen, finanziert.
Das Seniorenzzentrum St. Lukas als Einrichtung der Keppler-Stiftung ist Mitinitiator des Kooperationsverbundes von „VERA-vernetzt und aktiv im Alter“. Ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen haben in Wernau oft Schwierigkeiten an ÖPNV teilzunehmen. Das Projekt „s’BUSLE“ hilft bereits bei den Mobilitätseinschränkungen. Das Fahrangebot soll durch eine stärkere Individualisierung sinnvoll ausgebaut und generationsübergreifend genutzt werden. Die ganze Bürgerschaft wird sich an diesem Prozess beteiligen. Unterstützung erhält die Initiative bei der Konzeption und Durchführung des Bürgerbeteiligungsprozesses.
Schon über mehrere Jahre betreibt der Verein "Jung & Alt - Attraktives Dorfleben" organisierte Nachbarschaftshilfe für ältere und hilfebedürftige Menschen in der Region um Stühlingen. In einem Beteiligungsprozess, der auch Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung in der ländlichen Region umfasste, haben sich zwei Arbeitsgruppen zu den Themen Mobilität und Nahversorgung gebildet. Diese sollen im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche nun professionell moderiert weitergeführt werden und erste Ergebnisse für beide Themenbereiche entwickeln. Eine Infoveranstaltung soll weitere Interessierte auf die Gespräche aufmerksam machen. So werden möglichst viele Menschen angeregt, ihre Themen und Maßnahmen-Vorschläge mit in den Prozess zu bringen, um auf Langsicht die Gemeinde zu stärken und deren Attraktivität in einer ländlich geprägten Region zu erhalten.
Das "Generationenhaus Möhringen" ist ein Netzwerk aus gemeinnützigen Organisationen, engagierter Bürgerschaft und dem Bezirksamt Stuttgart-Möhringen. Im Rahmen des Projektes „Möhringen für alle“ werden Integration und Inklusion gestärkt, Begegnung und Beteiligung gefördert. Die Vielfalt im Stadtbezirk soll als etwas Positives erlebt werden. Dies wird mit verschiedenen Beteiligungsaktionen angestrebt (z.B. Kunstaktion „Stadt gestalten“). Beratung erhält die Initiative zu Beteiligungs- und Quartiersentwicklungsprozessen.
Die Bürgerinitiative "VDK Ortsgruppe Mönsheim e.V." bildet gemeinsam mit der Bürgergruppe "Soziales Netzwerk Mönsheim" eine Projektgruppe mit Betroffenen und interessierten Bürger*innen für die Umsetzung der Barrierefreiheit in Mönsheim. Das Konzept wird mittels einer Analyse des Ist-Zustandes, der Auswertung und Information über bereits bestehende Barrierefreiheit und der späteren Umsetzung diskutiert und gestaltet, damit Menschen in allen Lebenslagen solange wie möglich in ihrem gewohnten Umgebung leben können, wofür auch die Beratung in Anspruch genommen wird.
Wir machen uns stark für echte Inklusion
Die Initiative erarbeitet gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner und dem Mietshäuser-Syndikat ein Wohnprojekt zum langfristig bezahlbaren Wohnraum für Personen jeden Alters. In diesem Kontext entsteht zudem eine Wohngruppe für Menschen mit dementiellen Erkrankungen. Die Beratung erstreckt sich von der konkreten Umsetzung des Wohnprojekts, der Bewerbung auf Direktkredite, die Kooperation mit der Sozialstation Markgräferland, über das Wohnkonzept und das Zusammenwachsen innerhalb der Gruppe.
Die Wohnprojektgruppe für Mehrgenerationenwohnen hat sich zum Ziel gesetzt durch das Modell des Mietshäusersyndikats dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es entsteht dabei kein privater Wohnraum, sondern gemeinschaftlich selbstverwalteter Wohnraum, der bezahlbar gemietet werden kann. Damit verfolgt die Gruppe soziale und ökologische Ziele: Sie schaffen dauerhaften Wohnraum für sozial Benachteiligte und bauen energieeffizienten Wohnraum, nicht zuletzt auch durch das Teilen von Gemeinschaftsflächen und Fahrzeugen. Gemeinschaftsräume stehen auch dem Quartier offen, z.B. für Feste, kulturelle Veranstaltungen oder einem Repair-Cafe.
Murg im Wandel ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, die Projekte im Bereich der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit initiieren und unterstützen.
Ihr aktuelles Projekt beschäftigt sich mit dem Thema Mobilität, da die Mobilität in der Gemeinde Murg nicht zufriedenstellend und nachhaltig gelöst ist. Die Anbindung der Gemeinde an den ÖPNV ist unzureichend und lückenhaft, sodass die Initiative bereits einen Bürgerbus gegründet hat. Um die Mobilität darüber hinaus noch nachhaltiger und effizienter zu gestalten, ist das Projekt "Murger nehmen Murger mit" als Aufruf zur Mitfahrgelegenheit geplant. Andere Menschen im eigenen Auto mitnehmen oder bei fremden Menschen mitzufahren setzt Vertrauen voraus. Daher können sich Interessierte in der Gemeindeverwaltung registrieren lassen und erhalten eine Plakette für das Auto, bzw. eine Mitfahrkarte für Mitfahrer.
Der Helferkreis Integration Bad Krozingen möchte ein transnationales Orchester bestehend aus Laien und Profis unterschiedlicher Herkunft und Generationen gründen. In diesem Orchester sollen Sozialisationen, die normalerweise keinerlei Berührungspunkte miteinander haben, gemeinsam musizieren. Musikstile und Rhythmen der verschiedenen Kulturen sollen die klassischen Musikstücke beeinflussen. Zahlreiche Auftritte bei Festlichkeiten in der Umgebung sind geplant.
Der Elternbeirat der Paul-Lechler-Schule setzt sich für soziales Miteinander und die Unterstützung der Schülernein. Mit dem Projekt "Mut-mach-Märchen" wird den Kindern der Prozess vom Home-Schooling zurück in eine lebendige Klassengemeinschaft erleichtert. In Erzählstunden tauchen die Kinder in eine Märchenwelt ein und erleben wie Heldenn schwierige Situationen gemeistert haben. In Rollenspielsequenzen werden die Kinder zu Helden und lernen wie sie kreative Lösungen in schwierigen Situationen entwickeln können. Das gemeinsam Erlebte und die gemeinsam gestaltete Geschichte stärkt den Teamgeist in der Klasse.
Der Elternbeirat engagiert sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl der Schüler, fördert das Miteinander und die soziale Entwicklung der Kinder. Durch Spenden der Eltern werden Aktivitäten und Projekte ermöglicht, die von der Schule selbst nicht gestemmt werden können. Dem Elternbeirat ist es möglich, Kindern mit Defiziten Unterstützung anzubieten und als Bindeglied zwischen Schule und Eltern zu fungieren.
Mit dem Projekt "Mit Mutmachgeschichten motivieren und stärken" reagiert der Elternbeirat auf die Corona-Pandemie. Jüngere Grundschüler haben das Gemeinschaftsgefühl in einer Klasse nur sehr kurz kennengelernt und haben die Kommunikationsfähigkeit, sich anderen mitteilen zu können, in der Homeschooling Zeit verlernt. Das Projekt, das von einer Theaterpädagogin angeleitet wird, schafft Raum, der den Kindern in diesen unsicheren Zeiten Orientierung gibt. Sie können hier Teamfähigkeit erleben und Vertrauen in ihre eigene Stärken wieder gewinnen.
Entwicklung und Umsetzung der Neuen Wohnformen im Bereich der gemeinschaftlichen generationsübergreifenden Wohnformen auf der Basis von bürgerschaftlichem Engagement.
Die n*gruppe Marbach ist ein Verbund engagierter Bürger, die sich ehrenamtlich für Umweltschutz im Alltag einsetzen. Die Gruppe schafft nicht nur ein Bewusstsein für die Folgen des hohen Lebensstandards in Deutschland, sondern erarbeitet auch praktische Lösungen zum Umweltschutz vor Ort. Diese werden auch auf der lokalpolitischen Ebene bekannt gemacht. Für das Beteiligungsprojekt "Papierpilze" wird altes Papier künstlerisch wiederverwertet und an Interessierte verteilt. An der Sammlung und Erstellung des Produkts kann jeder Bürger teilnehmen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zur Erstellung der „Papierpilze“ notwendig sind.
In der Ökumenischen Familienbildungsstätte haben sich Eltern und Kurs-Teilnehmer*innen, sowie Kinder und Jugendliche zu einer Klimagruppe zusammen gefunden, um konkrete Handlungsmöglichkeiten für mehr Klimaschutz im Alltag aufzuzeigen und umzusetzen.
Mit den Kursen zu nachhaltigen Themen werden erfahrungsgemäß nur besonders Interessierte erreicht.
Mit einer ganztägigen Veranstaltung mitten in der Stadt soll die Freude an Nachhaltigkeit und Klimaschutz möglichst vielen Menschen niederschwellig vermittelt werden. Mit unterschiedlichen Mitmach- und Infoständen können Interessierte und Passanten sich zu den Themen nachhaltige Mobilität, Ernährung, Konsum, Energie und Abfall ganz praktisch informieren und werden zum mitmachen angeregt. Beispiele für Angebote auf dem Markt sind z.B. Probefahrten mit dem Lastenrad, Informationen zu Balkonkraftwerken, Radwegen, Pflanzen, etc.
Der Seniorenbeirat als Gremium besteht aus 12 Vertretern von Vereinen und Institutionen und vertritt die Interessen der älteren Menschen und informiert über verschiedene Angebote. Außerdem unterstützt er die Arbeit vom Seniorenbüro. Ziel des Projektes ist der Aufbau eines örtlichen Sozialnetzwerks zur Nachbarschaftshilfe unter der Überschrift „Nachbarn helfen Nachbarn“, bestehende Angebote in allen Bereichen des Gemeindelebens sollen dabei vernetzt und ausgebaut werden. Beratung zur Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes.
Engagierte Bürger arbeiten im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen an einem Netzwerk, um Themen wie Pflege und Demenz vor Ort zu bearbeiten. Die Gruppe beteiligt sich damit aktiv an der Quartiersentwicklung im Stadtbezirk und versucht, alle relevanten Interessengruppen einzubeziehen. In der Begegnungsstätte in Wangen greift die Gruppe regelmäßig aktuelle Fragestellungen zu den Themen auf und bietet ein Forum für Diskussion und Auseinandersetzung. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung anfallen. Diese ist einerseits dafür gedacht, den vielen Engagierten für ihre Mitarbeit zu danken; die Gruppe erhofft sich aber auch, dass sich im Anschluss viele Bürger auch weiterhin für eine Mitarbeit begeistern können.
"Kinder-, Jugend- und Familienarbeit Weingarten e.V.
In Weingarten sollte das Thema "Nachbarschaft" auf die Agenda genommen werden. Mit den vor Ort durchgeführten Gesprächen wurde ein Austausch mit den Bürgern sowie mit der Stadtverwaltung in Gang gesetzt. Ein zentrales Gesprächsthema war dabei die "Quartiersarbeit". Mit einem Organisationsteam, das ähnlich einer Begleitgruppe zusammengesetzt war, wurden die Dialoge gemeinsam durchgeführt. Insgesamt ist das Projekt im Rahmen eines einwöchigen Programms eingebettet gewesen. Für die Umsetzung wurden unterschiedliche Aktionen durchgeführt sowie verschiedene Zugangswege genutzt und die Beteiligung auch hybrid und digital durchgeführt.
Das Ziel der Initiative ist die Entwicklung eines Konzepts für ein nachbarschaftliches Wohnprojekt für Jung, Alt, Einheimische und Geflüchtete, das sich auf Engagement, Selbsthilfe und das Prinzip des Teilens statt Besitzen (Autos, Werkzeuge, Garten-, Spiel- und Begegnungsflächen) stützt. Der Verein erhält hierfür eine qualifizierte Prozessberatung.
Die Initiative gründet einen Dorfladen, der der Nahversorgung im Ort dient und bei dem der Schwerpunkt aus regionalen und saisonalen Produkten liegt. Für die Kommunikation vor Ort wird ein Tagescafé eröffnet und die rechtliche Basis wird eine Genossenschaft. Beratung erhält die Initiative für die Gründung einer Genossenschaft, sowie für die Standortbeurteilung, die Marktanalyse und dem Geschäftsplan.
Projektgruppe Stadtbelebung e.V.




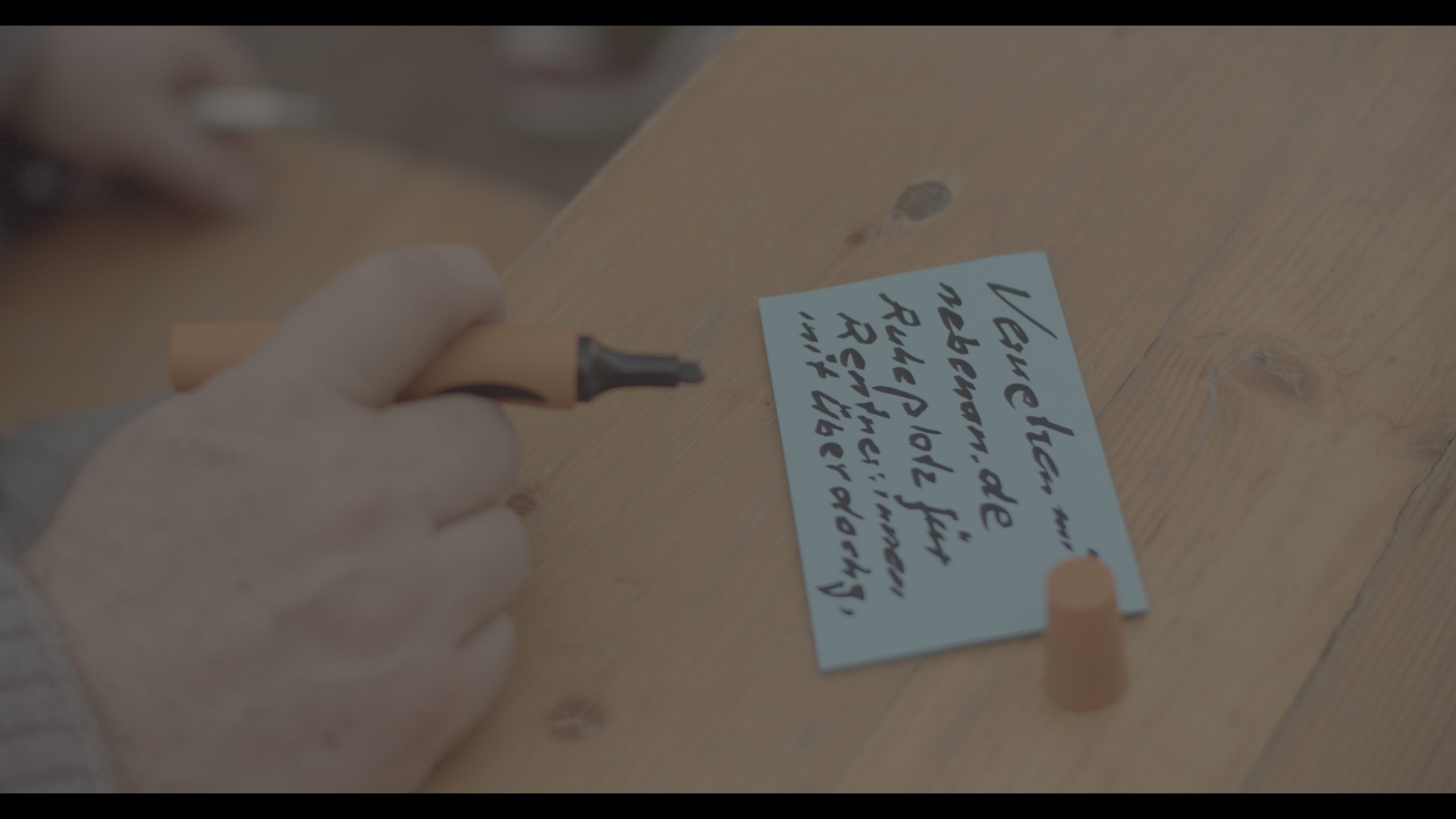
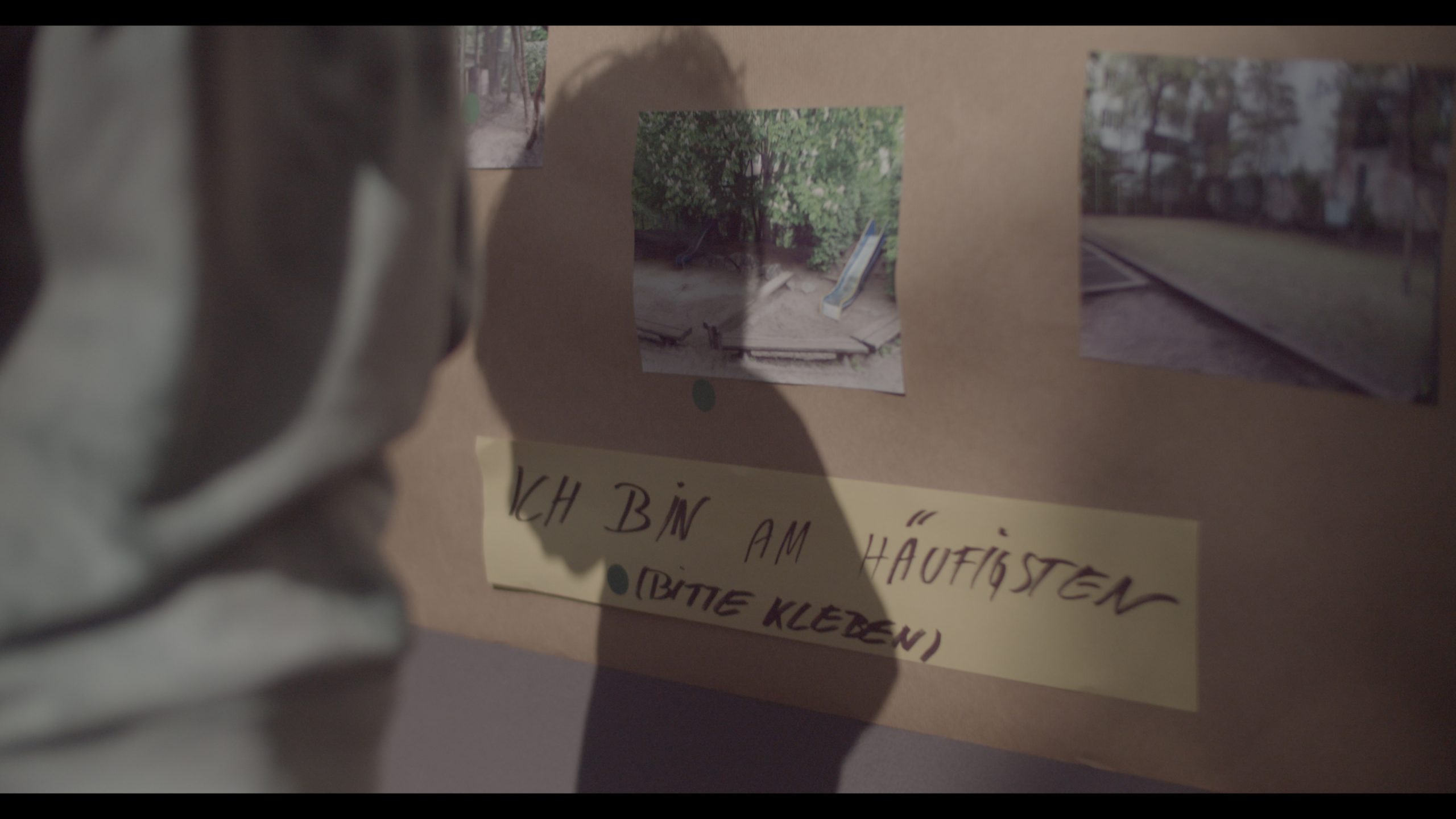

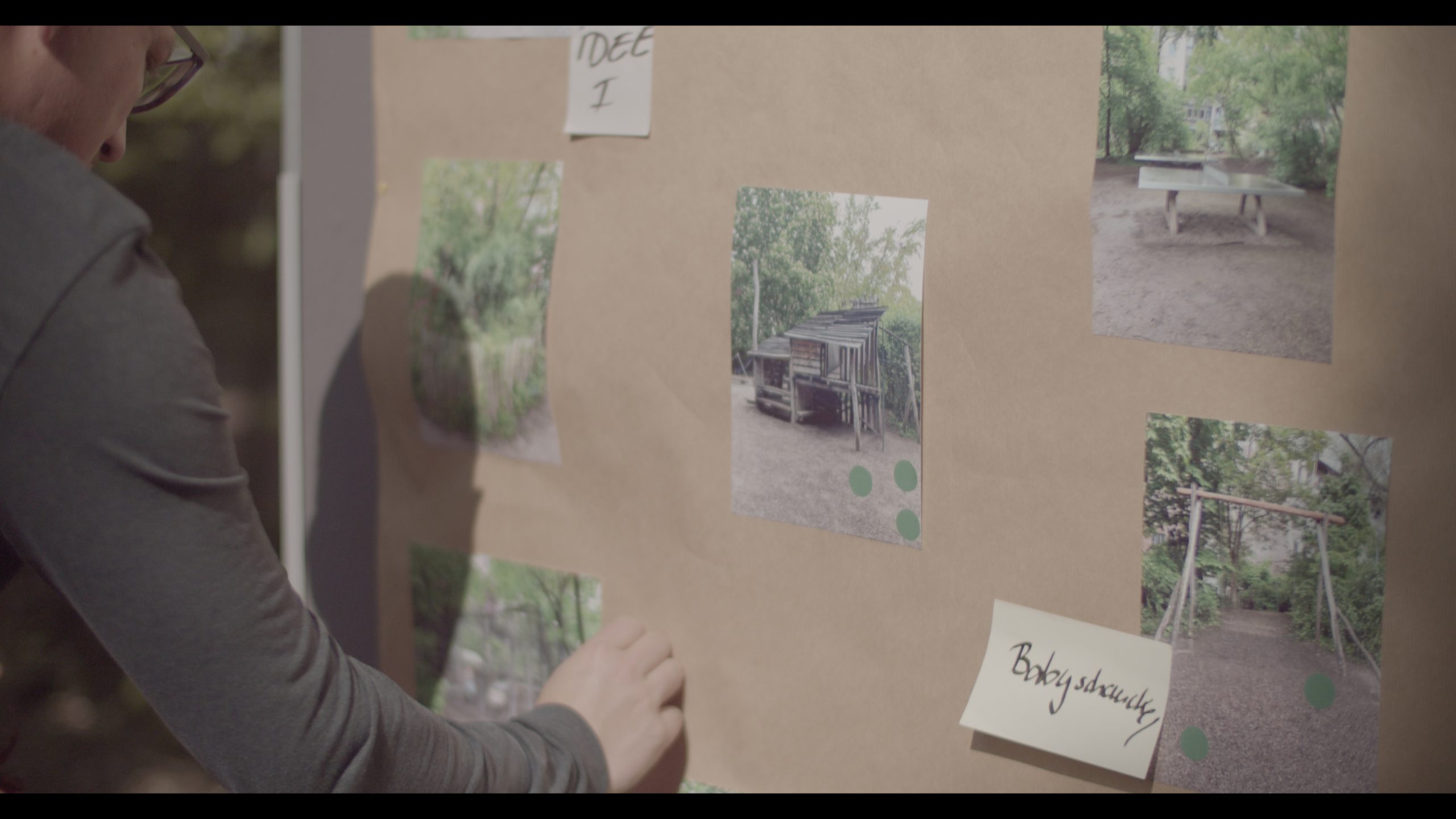

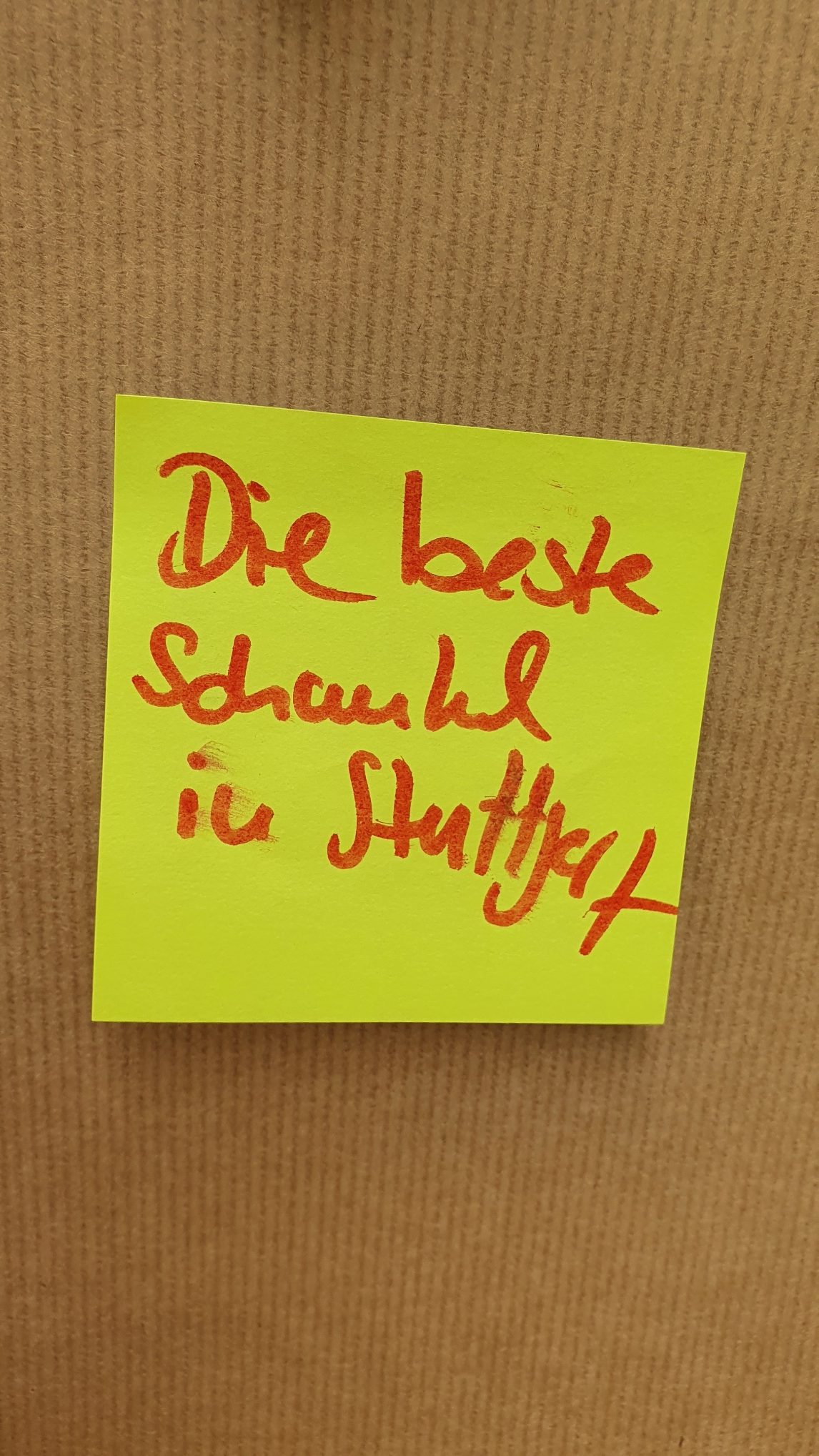

Der Hinterhof und damit der Hasenspielplatz soll seinen Charakter als verbindendes Element weiter ausbauen und noch mehr Menschen zusammenbringen. Zur Erholung, zum interkulturellen Austausch, zum Spielen, Feiern, Diskutieren und zur Entwicklung neuer Ideen für das Quartier. Die Anwohner sind eingeladen, sich aktiv in die Gestaltung und Belebung des Hinterhofs als Ort der Begegnung, des "Dorfplatzes", einzubringen. Dabei soll über Möglichkeiten der Beteiligung aufgeklärt und Bedürfnisse abgefragt werden.
Forum Hospitalviertel e.V.
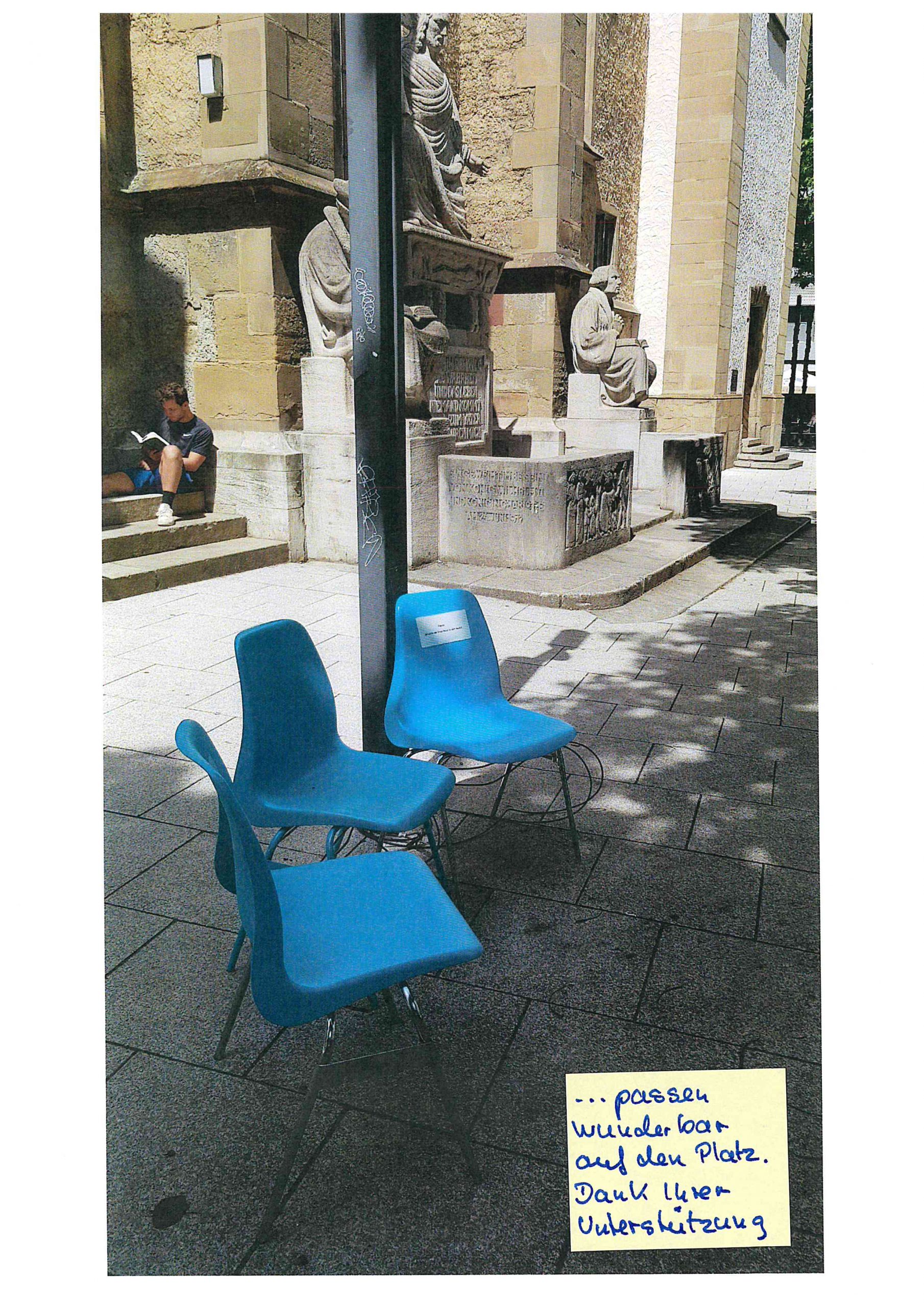



An einem Nachmittag im Monat wurde ein Nachbarschaftscafé auf einem Platz im Hospitalviertel in Stuttgart-Mitte ausgerichtet. Die eingeplanten weiteren Aktionen sollten dazu beitragen, dass sich die Bewohner des Hospitalviertels über ihr Quartier austauschen und sich ggf. besser damit identifizieren können. Ein Beispiel war zum Beispiel ein geführter Quartiersrundgang, der schöne und weniger schöne Ecken des Viertels umfasste. Im Rahmen des Spaziergangs entwickelte sich auch die Projektidee einen Straßenzug vor einer Schule des Viertels temporär durch Farbmarkierungen umzugestalten und damit zu einem achtsameren und langsameren Straßenverkehr an dieser Stelle beizutragen.
Eine Besonderheit des Stuttgarter Südens ist die hohe Dichte an engagierten Gruppen, Vereinen und sozialen Einrichtungen vor Ort. Gemeinsam wollen alle ihren Stadtteil gerne aktiv mitgestalten. Die Initiative „Solidarische Nachbarschaft Schoettle Areal“ hat auch aus diesem Grund ein Nachbarschaftsgespräch im Stuttgarter Süden ins Leben gerufen. In einem ersten Schritt steht im Rahmen einer öffentlichen Auftaktveranstaltung die gegenseitige Vernetzung im Vordergrund. Die große Bandbreite an Engagement im Stadtteil soll hier auch für bisher nicht involvierte Menschen sichtbar werden. Ebenso steht eine Sammlung von Bedarfen der Stadtteil-Bewohnenden im Fokus. In einem zweiten Schritt wird ein Netzwerk an Stadtforschern aufgebaut, die bewusst in ihre Communities und Einrichtungen gehen sollen, um sich gemeinschaftlich über bestimmte Fragestellungen des Stadtteils auszutauschen und die aufkommenden Anliegen aufzunehmen. Des Weiteren werden währenddessen weitere Nachbarschaftsgespräche durchgeführt, um weitere Bewohnende zu erreichen. Anvisiert werden Gespräche im öffentlichen Raum, an stark frequentierten Orten oder bei bestimmten Events im Stuttgarter Süden.

In Boxtal, einem Ortsteil von Freudenberg am Main mit aktuell rund 570 Einwohnenden, ist die Möglichkeit der Lebensmittelversorgung weggebrochen. Um die Versorgung neu zu organisieren, kommen die Einwohnenden in den Dialog zum Thema Zukunft der Nahversorgung vor Ort. Die Nachbarschaftsgespräche, die zum Beispiel einen "Nahversorgungstag" umfassen, dienen der Information zum Thema lokale Nahversorgung und der Diskussion über Konzepte zur konkreten Umsetzung in Boxtal. Im Rahmen der Gespräche sollen weitere Bürger zur Mitarbeit im Themenfeld gewonnen werden und das Vorhaben fortan gemeinsam weitergedacht und ausgearbeitet werden. Auch eine Bürgerumfrage zur Interessen- und Bedarfssammlung ist Teil des Prozesses. Beteiligt werden Vertreter aller Generationen, damit möglichst viele Sichtweisen im Prozess vertreten sind. Als Örtlichkeit für die Nachbarschaftsgespräche dient meist das zentrale und barrierefrei für alle zu erreichende Boxtaler Gemeindezentrum.
Die Initiative „Gemeinsam statt einsam“ aus Murg möchte gemeinsam mit der Kommune und den Jugendlichen vor Ort den demografischen Wandel gestalten. Durch einen Runden Tisch sollen Lösungsvorschläge für eine breit aufgestellte Nachbarschaftshilfe erarbeitet werden. Beratung erhält die Initiative zu vorbereitenden Schritten des Runden Tisches sowie zu Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Ziel des Projekts ist der Aufbau und die Etablierung einer professionell organisierten Nachbarschaftshilfe in der Genossenschaftsform. Die Angebote richten sich an hilfebedürftige Personen und umfassen die Schwerpunkte Alltagsbegleitung und Betreuung. Bedarfe und Wünsche werden im Vorfeld in einer Zukunftswerkstatt ausgearbeitet. Prozessberatung sowie rechtliche Unterstützung zur Gründung einer Genossenschaft sind dabei notwendig.
Eine engagierte Bürgergruppe möchte eine generationsübergreifende, dauerhafte Nachbarschaftshilfe vor Ort initiieren. Dieser Wunsch hat sich im Rahmen der ersten Mögginger Dorfwerkstatt im November 2017 herauskristallisiert. Bürgerinnen und Bürger erhoffen sich mehr ehrenamtliche Unterstützung für ältere Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine Durchmischung der Generationen und Öffnung für junge Familien. Beratung wird für eine dauerhafte Organisationsform sowie zu Haftungsfragen und arbeitsrechtliche Belange benötigt.
Das Ziel der Initiative ist es, mit der Neuformatierung der Nachbarschaftshilfe durch Vernetzung bestehender und neuer Angebote sowie der Weiterentwicklung zeitgemäßer Beteiligungsformen einen Beitrag zur Vitalität und Attraktivität des Gemeinwesens zu leisten. Das Nachbarschaftshilfe-Netzwerk verfolgt die Vision einer lebenswerten Stadtgesellschaft, in der Menschen aller Generationen und unabhängig von ihrer Herkunft selbstbestimmt am Leben der Stadtgesellschaft teilhaben und sich gemeinsam mit anderen einbringen können. Dafür werden Menschen in Mössingen gewonnen, qualifiziert und unterstützende Strukturen geschaffen. Beratung zur Organisationsstruktur und Rechtform für das Nachbarschaftshilfe-Netzwerk als Netzwerk aus unterschiedlichen Akteuren.
Ausgehend von einem Workshoptag zu sozialräumlichen Fragestellungen im Januar 2019 hat sich in Mössingen eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen in einem Initiativkreis zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Nachbarschaftshilfekonzepts für Mössingen und Umgebung zusammen gefunden. Die Ehrenamtsbeauftragte der Stadtverwaltung war seit Beginn der Gruppengründung dabei. Der Kreis erweiterte sich mit der Zeit um Personen zum Beispiel aus dem Hospizverein, der Bürgerstiftung oder dem örtlichen Mütterzentrum. Das angestrebte Nachbarschaftshilfe-Netzwerk verfolgt die Vision einer lebenswerten Stadt-(Gesellschaft), in der Menschen aller Generationen und unabhängig von ihrer Herkunft selbstbestimmt am Stadtleben teilnehmen und sich einbringen können. Dazu werden durch das Netzwerk Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und Situationen für ihre Anliegen und Bedarfe eine zentrale Anlaufstelle erhalten, über die sie zeitnahe Unterstützung und weitergehende Beratung und Begleitung vermittelt bekommen.
Der Arbeitskreis Klimaschutz Wittnau ist ein Zusammenschluss von interessierten Bürger*innen und Mitgliedern des Gemeinderats, die sich zum Ziel gesetzt haben, Maßnahmen zu Klimaschutz zu entwickeln und umzusetzen. Grundlage dafür ist ein vom Gemeinderat beschlossenes Klimaschutzkonzept.
Mit Bürgerbeteiligungsprozessen soll eine umweltverträgliche Mobilität für Wittnau erreicht werden. Darüber hinaus ist das Ziel die Gemeinde Wittnau energieautark zu machen.
Zu den konkreten Maßnahmen gehören die Errichtung einer E-Bike-Ladestation, die Bewerbung des E-Carsharing Angebots und des Ausbaus von PV-Anlagen auf Privathäusern, die Errichtung einer Mitfahrbank sowie die artenfreundliche Bepflanzung der Grünflächen der Gemeinde.
Die Initiative hat sich gegründet, um Carsharing in Küssaberg einzuführen und hat sich mittlerweile zu einer Gruppe entwickelt, die sich allgemein mit dem Thema der nachhaltigen Mobilität beschäftigt. Sie setzt sich für den Aufbau und Etablierung eines Car- sowie Lastenradsharing-Angebots ein, veranstaltet Stadtradeln und macht Elternveranstaltungen zum Thema Schulweg zu Fuß.
Die Initiative „Nachhaltige Mobilität“ arbeitet in der kleinen Gemeinde Küssaberg an der deutsch-schweizer Grenze an einer umweltverträglichen und autoreduzierten Mobilität. Dafür verfolgt die Gruppe verschiedene Ziele wie zum Beispiel die Schaffung von einem E-Car-Sharing-Modell in den verschiedenen Ortsteilen, Lastenrädern für Besorgungen sowie Mitfahrportalen und Mitfahrbänken vor Ort. In einem Bürgerbeteiligungsprozess wird mit einer Bürgerumfrage und öffentlichen Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität die Bevölkerung vor Ort eingebunden. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die mit den Informationsveranstaltungen anfallen.
Das Ziel des Projekts ist die Förderung der multimodalen Mobilität in Schallstadt-Mengen. Die Bevölkerung wird für die Nutzung von Kleinbus, CarSharing Station, E-Lastenfahrräder, Hol- und Bringdiensten in öffentlichen Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität sensibilisiert. Professionelle Beratung und Begleitung erhält die Initiative für die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung sowie zur Etablierung der Projektidee.
Das Ziel des Projekts ist es, mittels Bürgerbeteiligung eine umweltverträgliche und zukunftsfähige Mobilität einzurichten. In einem gemeinsamen Prozess mit der Bürgerschaft und der Verwaltung werden die Bedarfe festgestellt sowie die Finanzierungsfragen geklärt. Dies betrifft das Einrichten einer Mobilitätsstation für E-CarSharing und E-Lastenräder, die Gründung von Fahrgemeinschaften. Die Initiative erhält eine qualifizierte Beratung für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
Die Initiative „Murg im Wandel“ engagiert sich für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Murg. In diesem Rahmen wurden konkrete Maßnahmen angeregt und Projekte umgesetzt, die weiterer Unterstützung bedürfen. Die Initiative setzt sich für die Weiterentwicklung der umweltverträglichen, autoreduzierten und zukunftsfähigen Mobilität ein. In einem Bürgerbeteiligungsprozess in Kooperation mit der Kommune werden verschiede Möglichkeiten mit Blick auf die CO2 Reduktion erarbeitet. Die Initiative erhält eine qualifizierte Beratung für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
Mittels Bürgerbeteiligungsprozessen in Stegen wird der Weg zu einer umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Mobilität beschritten. Die engagierte Bürgerschaft startet in Kooperation mit der Verwaltung mit einem E-CarSharing Auto als Pilotprojekt. Der Standort wird nach Möglichkeit mit einem E-Lastenfahrrad und einer Mobilitätsstation für Pedelecs erweitert. Die besonderen Herausforderungen in einer Gemeinde im ländlichen Raum machen das Projekt anspruchsvoll und besonders interessant. Der Arbeitskreis erhält qualifizierte Beratung für das Ausrichten und die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung.
Nachbarschaft der Fischerhäuser-Vorstadt
Die Fischerhäuser Vorstadt im Westen von Überlingen ist ein Stadtquartier mit langer Geschichte. Der Ursprung geht zurück bis in das 17. Jahrhundert, als sich Nachbarschaften zu Zeiten des dreißigjährigen Kriegs zu Schutzgemeinschaften gegen Eindringlinge zusammenschlossen. Über die Jahrhunderte ist das Quartier gewachsen, widerspiegelt aber heute noch die mittelalterliche Siedlungsstruktur des Bodenseestädtchens.
Eine aktive Nachbarschaft ist über die Jahre vor Ort entstanden, die nun auch einen weiteren Wandlungsprozess dieses Stadtraums interessiert mitbegleitet. Dazu gehört auch das Vorhaben der Überlinger Stadtverwaltung, für das Gebiet der Fischerhäuser Vorstadt einen Bebauungsplan zu entwickeln. Aus Sicht der Stadt wird damit eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Quartier erreicht. Ebenso könne man so die gewachsene Siedlungsstruktur des Quartiers dauerhaft schützen.
In diesen Erstellungsprozess des Bebauungsplans möchte sich die Nachbarschaftsinitiative der Fischerhäuser-Vorstadt aktiv mit einbringen, weshalb sie sich im Sommer letzten Jahres auch für eine Antragstellung im Förderprogramm „Nachbarschaftsgespräche“ entschieden hat. Mit eigenen Veranstaltungen möchte die Gruppe Ideen der Quartiersbewohner in den Prozess einbringen und das große Ziel der Bewohner vor Ort weiterverfolgen, den historisch gewachsenen Charakter des Viertels auch in Zukunft zu erhalten.
Im November konnte die Gruppe trotz anziehender Corona-Zahlen im Land einen ganztägigen Aktionstag zur Fischerhäuservorstadt ausrichten. Einer Vor-Ort-Besichtigung in deren Rahmen auch Einblicke in lokale Handwerksbetriebe möglich waren folgten verschiedene Impuls-Vorträge in der Überlinger Auferstehungskirche. Die Vorträge beschäftigten sich mit verschiedenen wichtigen Themen im Planungsprozess wie den historischen Qualitäten des Stadtraums, dem Denkmalschutz oder ökologischen Entwicklungspotenzialen vor Ort, die Professor Walter Stamm-Teske den Veranstaltungsbesuchern näherbrachte.
Auch der Überlinger Baubürgermeister Matthias Längin hatte die Gelegenheit, den Stand des Verfahrens aus städtischer Sicht zu erläutern. Zum Ende der Vorträge stellten sich alle Vortragenden einer Fragerunde. Doch nicht nur den Gästen taten sich neue Ausblicke auf die Themen auf. Auch Baubürgermeister Längin befand den kreativen Vorschlag von Professor Stamm-Teske, fortan noch stärker mit dem Gelände zu bauen und auf Gebäude mit Flachdach und niedrigerer Gesamthöhe zu setzen, durchaus bedenkenswert. So berichtete es der Südkurier.
Eine Verwaltung, die auf Augenhöhe zu städtebaulichen Vorhaben mit Interessierten ins direkte Gespräch geht. Und Bürger, die einen Planungsprozess aktiv mitgestalten und eigene Beiträge und Veranstaltungen in die Debatte mit einbringen. Wir hoffen, dass die Fischerhäuser Vorstadt von diesen guten Bedingungen profitiert und der Beteiligungsprozess am Ende für alle Akteure zufriedenstellend abgeschlossen werden kann.
Die Initiative Vereinsgemeinschaft Wald möchte vor Ort in Wald-Riedetsweiler die Nahversorgung aufrechterhalten und mit vorgeschalteter Bürgerbeteiligung ein DORV-Zentrum entwickeln, das die Bausteine „Grundversorgung“, „Dienstleistungen“, „soziale Angebote“, „Kommunikation“ und „Kultur“ enthält. Dies soll die Entwicklung hin zu einer reinen „Schlafgemeinde“ stoppen. Beratung erhält die Initiative für eine Basisanalyse, um zu prüfen, ob überhaupt die Voraussetzungen für ein solches Projekt vor Ort bestehen und die Bürgerschaft dieses Projekt mittragen wird.
Die Bürger*innen Lauterbachs entwickeln eine neue Idee für die Umnutzung des Haus des Gastes am Rathausplatz. Durch das Konzept einer nachhaltigen Sicherung der Daseinsvorsorge entsteht ein multifunktionales Zentrum, das von allen Bürger*innen genutzt werden kann und somit das Dorf zusätzlich belebt. Beratung erhält die Initiative zum Aufbau eines NahDa-Zentrums, Einbindung der Bürger*innen und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
Die Initiative Aktive Bürger Herdwangen-Schönach möchte ein DORV-Konzept zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung vor Ort realisieren. Alle anderen Einwohner werden begleitend durch Bürgerversammlungen und Bürgerwerkstätten während der Entstehung einbezogen. Beratung bekommt die Initiative zum Aufbau eines DORV-Zentrums sowie zum Prozess der Bürgerbeteiligung.
Der Arbeitskreis Dorfentwicklung setzt sich für die Gestaltung einer attraktiven und lebendigen Ortsmitte in Zogenweiler sowie für die Entwicklung einer zukunftsfähigen Nahversorgung, um die Lebensqualität in der Gemeinde Horgenzell für die Zukunft zu erhöhen. Eine externe Basisanalyse soll klären, ob sich ein DORV-Konzept vor Ort rechnen und wirtschaftlich tragen würde.
Mit „Nachhaltiges Wohnen in der Wildwiese“ wird durch den Bau von drei Tiny Houses auf einer Wildwiese in Waldshut, ein Ort für junges und nachhaltiges Wohnen geschaffen. Im Rahmen moderierter Beteiligungsprozesse entstehen hier gemeinwohlfördernde Angebote für das Quartier, wie gemeinschaftlich genutzte Freizeitflächen oder Bike-Sharing-Stationen. Das Konzept dient als Modellprojekt für andere Flächen und leistet einen Beitrag für zukunftsorientiertes Leben und Fachkräftesicherung in einer Kleinstadt. Der Beratungsgutschein wird zur Konzeptentwicklung des Wohnprojekts und der strukturellen Neuaufstellung des Vereins eingesetzt.
Die Initiative GoodFood teilt ihr Wissen, ihre Erfahrung und Begeisterung rund um das Thema Nachhaltigkeit & Ernährung mit anderen Menschen. Ihr Ziel ist es, sowohl Kenntnisse und ein Bewusstsein für nachhaltige Ernährung zu schaffen, als auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, das eigene Verhalten zu reflektieren.
Sie entwickeln dafür Medien, um Menschen Information über Nachhaltigkeit & Ernährung bzgl. Themen wie Klimaauswirkung, Flächenverbrauch, Luftverunreinigung, Wasserverbrauch und Wasserverunreinigung leicht zugänglich zu machen.
Das Bündnis für Klimagerechtigkeit Esslingen setzt sich aus Mitglieder aus zahlreichen Initiativen zusammen, wie z.B. ADFC Esslingen, Fridays for Future, Foodsharing Esslingen, Bündnis Esslingen aufs Rad, Greenpeace. Das Bündnis bündelt die zivilgesellschaftliche Expertise im Bereich Klimagerechtigkeit und möchte damit die Herausforderung des Klimawandels auf kommunaler Ebene vorantreiben.
Für das Bündnis ist die Wahl des Esslinger Oberbürgermeister entscheidend für die nachhaltige Entwicklung Esslingens. Daher planen sie eine Veranstaltung, um mit den Oberbürgermeisterkandidaten über Nachhaltigkeit in Esslingen zu diskutieren. Coronabedingt soll die Veranstaltung in hybrider Form stattfinden.
Ein Konzept für die Nutzung des ehemaligen Schulhauses, Aufbau einer Infrastruktur, Stärkung der Dorfgemeinschaft im Rahmen eines Beteiligungsprozesses. Hierfür möchte sich die Initiative professionell beraten lassen.
Die Gruppe „Unteralpfen bewegt sich“ engagiert sich mit diesem Projekt für einen Nachnutzungskonzept für das leerstehende Schulhaus in einem Ortsteil von Albbruck. Die Idee dazu entstand im Rahmen einer digitalen Werkstatt zur Entwicklung von Impulsen für ein lebendiges Dorf. Die Nachnutzung des Schulgebäudes verhindert den Leerstand und nutzt außerdem nachhaltig und generationsübergreifend das Gelände. Der Beratungsgutschein wird zur Gestaltung eines Bürgerbeteiligungsworkshops zur weiteren Information und Projektentwicklung vergeben.
Bürgerbewegung zur Unterstützung von Fridays For Future Calw/Nagold
Sehr aktiv, eine Antwort auf die Rufe von Fridays For Future: Ihr klaut uns unsere Zukunft ! Homepage www.nagoldforfuture.de
Im Heiligkreuzsteinach wurde der einzige Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte geschlossen. Die Nahversorgung endete abrupt und hat zur Folge eine Sogwirkung auf die noch vorhandenen Geschäfte, wie Getränkemarkt, Bäcker, Metzger und Apotheke. Zudem war der Lebensmittelmarkt bisher ein wichtiger und beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Das Ziel der Initiative Nah- und Rundumversorgung ist es, eine intakte Infrastruktur im Ort zu halten, um weiter eine attraktive und lebendige Gemeinde zu sein. Der Beratungsgutschein wird für die Befragung der Bürgerschaft rund um die Schaffung einen Nahversorgungszentrums verwendet.
Mit der Nachhaltigen Daseinsvorsorge, kurz NahDa, entsteht in Biberach mit Hilfe eines Beteiligungsprozesses ein Zentrum, das die medizinische Versorgung und die Nahversorgung sichert, sowie einen sozialen Treffpunkt implementiert. Hierzu erhält die Initiative unterstützende Beratung zum prozesshaften Vorgehen, die Einbindung der Bürger*innen und zu wirtschaftlichen Aspekten, sowie zur Durchführbarkeit.
Das Ziel der Initiative ist es, die Nahversorgung in Kiebingen zu verbessern. Dabei soll sich die Versorgung nicht nur auf den Erwerb von Lebensmitteln beschränken, sondern darüber hinaus den persönlichen Kontakt zwischen den Kiebingern verstärken. Dieser Wunsch wurde vielfach in den Befragungen zum Stadtentwicklungskonzept der Stadt Rottenburg geäußert. In Zusammenarbeit mit der Bäckerei, der Metzgerei, dem Gemüse-Anbieter und dem örtlichen Landwirt könnten deren Waren, aber auch weitere Produkte für den täglichen Bedarf, im neuen Dorfladen im Ortskern in fußläufiger Entfernung angeboten werden. Beratung in Form einer Basisanalyse.
Die Initiative setzt zur Quartiersentwicklung die Themen „Alt werden in gewohnter Umgebung“ (Betreutes Wohnen, Pflegewohngruppen und andere innovative Wohnformen im Alter) und die Einrichtung eines Dorfzentrums (DORV) mit Café für Kommunikation und Begegnung sowie einem ergänzenden sozialen Leistungsangebot und Lebensmitteln in Form eines Kleinladenkonzeptes um. Beratung erhält die Initiative zu verschiedenen Modellen der Nachbarschaftshilfe, zur innovativen Wohnformen im Alter und zum Konzept der Nahversorgung.
Die Initiative errichtet ein DORV-Zentrums mit Ladengeschäft für den Verkauf von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs mit regionalem Bezug sowie Dienstleistungen und soziales Leistungsangebot, ein Zentrum für Kommunikation mit Café und einer Quartiersentwicklung "Alt werden in gewohnter Umgebung" (Betreutes Wohnen, Pflegewohngruppen und andere innovative Wohnformen im Alter. Um Voraussetzungen für die Einrichtung eines multifunktionalen DORV-Zentrums und eine Quartiersentwicklung mit konkreten Zahlen zu prüfen, wird im ersten Schritt eine Basisanalyse zur Untersuchung der Nahversorgung in Völkersbach durchgeführt werden. Dies beinhaltet die Beschreibung einer (Nah-)Versorgung unter Annahme vorhandener, notwendiger und wünschenswerter Einrichtungen sowie eine erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit sowie die weitere Vorgehensweise zur Entwicklung eines multifunktionalen DORV-Zentrums unter Einbindung der Bürgerschaft in den Prozess.
Das Netzwerk 70599.Lebenswert versteht sich als Plattform für lokale Gruppen, Initiativen und Bürger, die an der Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitszielen arbeiten. Alle Projekte werden grundsätzlich mit Netzwerk- und Kooperationspartnern durchgeführt. Die Gruppen, insbesondere in den Bereichen Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung, werden durch das Projekt noch bekannter gemacht. Mit einer Auf- und Abschluss-Veranstaltung sowie täglicher Vorstellung ausgewählter Initiativen (insgesamt 15) auf Social Media, in Flyern und auf der Webseite, werden die Gruppierungen, die im Klimaschutz aktiv sind, gestärkt und Bürger ermutigt, mit zumachen.
Im Rahmen des Klimagesprächs hat sich die Projektgruppe Naturgarten gegründet, bestehend aus engagierten Bürger*innen. Ziel ihres Projekts ist der Aufbau eines Naturlehrgartens auf einem Gartenstück, dass die Gemeinde Ditzingen der Gruppe im Sinne von Natur- und Umweltschutz zur Verfügung gestellt hat. Bürger*innen haben die Gelegenheit in diesem Garten zu lernen, wie ein naturnaher Garten gestaltet werden kann. Bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen und Projekten wie z.B. Nistkästen- und Insektenhotelbau, angeleitet durch Expert*innen nehmen Bürger*innen Ideen mit nach hause und lernen ökologische Zusammenhänge verstehen.
Zusammenführung von Generationen zu einem gemeinsamen Dialog. Generationsübergreifende Themen interessant gestalten.
Aus der Bürgerwerkstatt "Raum für Ideen in Osterburken" ist die Idee eines römischen Wasser-Erlebnis-Spielplatzes entstanden. Die Stadt hat dafür ein städtisches Grundstück zugesichert und übernimmt die Trägerschaft für den Bau des Spielplatzes. Eine Projektgruppe hat sich gebildet, die sich für Ideen, Umsetzung und Betrieb verantwortlich zeigt. Projektziel ist die Schaffung eines Spielplatzes für jegliche Altersgruppe mit Berücksichtigung der historischen Stadtgeschichte und der Faszination Wasser.
Beteiligung von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Angehörigen an der Weiterentwicklung des Netzwerks Behindertenhilfe im Sinne der Inklusion
Netzwerk für ein Nachhaltiges Freiburg
Das Ziel des Projektes ist die Einrichtung einer digitalen und analogen Plattform, die den nachhaltigen Wandel des gesellschaftlichen Umfelds mit Fokus auf gemeinwohlorientierte und kooperative Wirtschaft unterstützt und der Quartiersentwicklung dient. Dabei werden Nachbarschaftsaustausch, gegenseitige Vernetzung sowie lokale Strukturen in Konstanz gefördert und gestärkt. Beratung zu Vorbereitung und inhaltlichen Ausrichtung des Projektes, zu Einschätzung der Machbarkeit, zum Thema Nachhaltigkeit und Sharing-Community.
Gemeinnütziger Verein zur Förderung heimischer Streuobstflächen, Biodiversität, Nachhaltigkeit und kultureller Vielfalt. Gestaltet Engagementförderung und Bürgerbeteiligung mit. Fördert die Verbindung von Präsenzveranstaltungen in Verbindung mit Videokonferenzen. Beteiligt sich maßgeblich beim Aufbau und Betrieb einer digitalen Mitmach- und Beteiligungsplattform.
Der Arbeitskreis Asyl möchte seine Arbeit an die aktuelle Bedürfnisstruktur von Geflüchteten neu organisatorisch ausrichten und die Vernetzung zwischen dem Arbeitskreis, dem Integrationsmanagement sowie der Gemeinde ausbauen. Beratung erhält der Arbeitskreis zu Umstrukturierung und zu Weiterentwicklung von Projekten.
Die Projektgruppe setzt sich aus zwei Wohnprojekten und einem Verein für Nachhaltige Entwicklung zusammen. Sie möchten mit einer Veranstaltung aufzeigen, wie Initiativen auf unterschiedliche Weise neue Wege in Bezug auf Anders leben und Anders wirtschaften gehen können. Diese Beispiele inspirieren zum Austausch zu den Fragen: Wie wollen wir leben und was können wir tun, damit für die nächsten Generationen die Lebensgrundlagen erhalten bleiben? Mit der Veranstaltung wird das bürgerschaftliche Engagement und die Vernetzung gefördert, indem sich bestehende Initiativen vorstellen, interessierte Bürger und kommunale Vertreter zu Bedarfen und Möglichkeiten ins Gespräch kommen.
Ziel des Vereins ist es, den Austausch zwischen den Kulturen zu leisten. Das African Music Festival feiert dieses Jahr seine 20. Ausgabe. Beratung zu Integration durch Kultur mit den Mitteln von Social Media.
Das Ziel der Initiative ist das Voranbringen der nachhaltigen Mobilität in Küssaberg für mehr Klimafreundlichkeit, für weniger Parkplatzbedarf, für flexible Angebote sowie für mehr Nutzung von alternativen Angeboten wie E-CarSharing in den Ortsteilen, Lastenräder für Besorgungen, Mitfahrportale. Der Beratungsgutschein wird für die Umfrage zum Bedarf sowie zur Erweiterung der Initiative und die Sensibilisierung für das Thema in Form von öffentlichen Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität mit multimodalen Angeboten benötigt.
Durch das Projekt wird der Zusammenhalt und das Miteinander im Stadtteil gestärkt, indem durch einen Bürgerbeteiligungsprozess erörtert wird, inwiefern Neuzugezogene mit der langjährigen Bewohnerschaft in Kontakt gebracht werden können. Hierzu werden räumliche fußläufige Wegebeziehungen überprüft und Verbesserungen gemeinsam ausgearbeitet. Die Initiative erhält die Beratung zur Ausgestaltung eines konstruktiven Beteiligungsprozesses und zur Quartiersentwicklung.
Die Initiative erarbeitet ein Konzept für einen alten, leerstehenden Bauernhof und zwei weitere Objekte, um barrierefreie Wohnungen mit innen-und außenliegenden Gemeinschaftsräumen entstehen zu lassen. Der Umbau erfolgt nachhaltig und ökologisch und dient insbesondere der Bereitstellung alternativer Wohnmöglichkeiten für ältere Personen aus dem Ort und dem Umland. Die Beratung zielt auf die Kompetenzentwicklung des Wohnprojekts und der strukturellen Neuaufstellung des Vereins ab.
Das Dorf Harpolingen mit seinen 700 Einwohner hat mit massiver Landflucht zu kämpfen. Das hat zur Folge, dass unter anderem die Dorfgaststätte geschlossen wurde. Deshalb hat sich der Bürgerverein „Daheim in Harpolingen e.V.“ gegründet und möchte mit dem Projekt die Neugestaltung eines „generationengerechten Dorfzentrum“ angehen. Dieses Projekt hat zwei Dimensionen: Zum einen die Schaffung eines sozialen und kulturellen Treffpunkts, zum anderen die Umgestaltung des Dorfplatzes. Beratung erhält der Verein zur Prozessgestaltung und zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie.
Der Verein FC Blau-Weiß Bellamont verfolgt das Motto "Gemeinschaft bewegt" und ist besonders im Jugendbereich und im Mädchenfussball aktiv. In den letzten Jahren haben vor allem auch jüngere Vereinsmitarbeiter die Verantwortung übernommen.
Ein Spielplatz auf dem Vereinsgelände, der für alle Personen frei zugänglich und offen ist, entspricht nicht mehr der DIN-Norm eines öffentlichen Spielplatzes. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit Vereinsmitgliedern altersübergreifend eine Neugestaltung umzusetzen. Durch ein attraktives Spielangebot sollen Kinder und Eltern zum Spielen draußen animiert werden.
Gemeinsam statt Einsam e.V. initiierte 2015 als einer der ersten in BW eine selbstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz als individuelle, kleinräumige Betreuungs- und Pflegealternative im vertrauten Quartier in Form von WG-Zimmern. Die Organisation wurde bisher durch die „Gründer“-Angehörigen getragen. Der Verein setzt sich mit Modellen eines Organisationswechsels für die neue Generation auseinander und benötigt hierfür die Prozessberatung.
„Gemeinsam statt Einsam e.V.“ steht seit 2005 für eine selbstverantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz in Kirchheim unter Teck und gehört zu den Pionieren in BW. Der Verein setzt sich aktuell mit Modellen eines Organisationswechsels auf Vereinsebene auseinander, weil keine ehrenamtlich engagierte Nachfolge mehr zur Verfügung steht. Prozessberatung wird benötigt, um künftig eine tragfähige Steuerung für das Konzept der ambulant betreuten Wohngemeinschaft zu gewährleisten.
Neustart Tübingen ist eine genossenschaftlich orientierte und demokratisch strukturierte Initiative. In der Tübinger Südstadt entsteht eine neue Nachbarschaft mit Blick auf die Menschen mit kleineren Einkommen. Hier wird eine Kultur der Solidarität und gegenseitiger Unterstützung gepflegt. Im Fokus stehen das gemeinschaftliche Wohnen, soziale Infrastruktur und Gewerbe. Fachliche Beratung wird zur Entwicklung eines Quartierskonzeptes anhand einer aktivierenden Befragung genutzt.
Die Gruppe „Murg im Wandel“ setzt sich seit vielen Jahren für eine lebenswerte Kommune in den Bereichen Mobilität, Bürgerbeteiligung und Klimaschutz ein. Der langjährige Koordinator hat seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Die anderen Mitglieder benötigen einen moderierten Prozess, um die Struktur und die Aufgaben neu zu verteilen sowie den Fortbestand der Gruppe gewährleisten zu können. Fachberatung zu Neuorganisation der Initiative.
Das Forum Gesellschaft Inklusiv Ostfildern vertritt im Rahmen der Inklusion die Interessen von Menschen, die in ihrer Mobilität oder Orientierung eingeschränkt sind. Ihr Ziel ist die ungehinderte Teilhabe aller Bürger am gesellschaftlichen Leben in Ostfildern.
Die Aktivitäten und Themen des Forums sind vielfältig. Ein großes Projekt war die Ausarbeitung "Barrierefrei Unterwegs" in Ostfildern, das digital für alle zugänglich und fertiggestellt ist. Mit diesem Abschluss beenden mehrere Aktive ihr Engagement und neue Personen wurden für die Mitwirkung gewonnen. Der Wechsel der Engagierten und der Projektabschluss geben Anlass zur Neustrukturierung des Forums mit Hilfe eines moderierten Workshops.
Der ehrenamtlich organisierte Verein New Heart Project ermöglicht die Einbindung geflüchteter Menschen in das gesellschaftliche und kulturelle Leben, sowie die Zusammenkunft mit Menschen unterschiedlichen Alters, Schichten und Herkunft. In verschiedenen städtischen Parks gibt es hierzu die Veranstaltungen Silent Disco, Chai in the park und neu hinzukommend Soup in the park. Die Beratung erfolgt hierbei zu Soup in der Park in der Projektumsetzung und Finanzierung.
Das New heart Project setzt sich für ein solidarisches und friedliches Zusammenleben ein. Ziel ist es, Menschen jeden Alters aus den Quartieren zusammen zu bringen und vor allem auch geflüchtete Menschen in das gesellschaftliche und kulturelle Leben des Viertels einzubinden. Dazu organisiert der Verein ehrenamtlich Veranstaltungen in Freiburger Parks, um Brennpunkte, die durch Drogendealer-Szene und Kleinkriminalität entstehen, zu friedvollen Orten im Quartier zu machen. Bei den Veranstaltungen ohne Drogen und Alkohol wie Silent Disco und Chai in the Park kommen Menschen unterschiedlicher Schichten zusammen. Die Veranstaltungen sind so gewählt, dass sie für alle Menschen attraktiv und zugänglich sind und den abends oft düstere Plätze kreativ bespielen.
Die Gruppe 0 CO2mmunity hat sich zusammengefunden, um mit konkreten Aktionen dem Klimawandel entgegen zu wirken. Sie haben dazu eine Webseite aufgebaut, um über den Ausstoß von CO2 zu informieren und mit einem CO2-Rechner, der eine "Action-Card" erzeugt mit allen CO2-Angaben des Teilnehmers, den eigenen Verbrauch zu reflektieren. Die Teilnehmer können diese "Action-Card" an soziale Kontakte schicken und so den Wettbewerb anstoßen, den geringsten CO2-Ausstoß zu erreichen.
Diese Plattform soll weiter mit Flyern und einem mobilen Messestand beworben werden, der auf Veranstaltungen präsent sein soll, um damit weitere Menschen für das Projekt zu gewinnen. Ziel ist es, die Action-Card auch in anderen Stadtteilen bekannt zu machen und die Anzahl der Nutzer zu steigern und damit die Auseinandersetzung mit dem Thema CO2 Ausstoß zu erhöhen.
Die studentische Gruppe Nürtigram hat zum Ziel, Hintergründe zu Tourismus, Kultur und Mittelstädten partizipativ und interaktiv mit Akteuren und Bürger zu erarbeiten. Mit der Methode des Storytellings soll eine Zukunftsdarstellung des Tourismus- und Kulturangebots in Nürtingen erarbeitet und veranschaulicht werden. Dazu werden Umfragen durchgeführt sowie Informations- und Diskussionsveranstaltungen mit der Stadtverwaltung und weiteren Akteuren in der Kongresshalle abgehalten. Zudem finden Bürgerdialoge und Anrainertreffen statt. Über den Instagram-Account "Nürtigram" wird die Kommunikation auch digital ermöglicht.
Ziel des Nürtinger Dialograums ist es, auf einer rein emotionalen Ebene Spaltungstendenzen in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Viele Themen der letzten Jahre neigten dazu, Mitglieder einer Gesellschaft in eine Positionierung zu zwingen. Die damit einhergehende gesellschaftliche Spaltung und ein hoher Grad an scheinbar unüberwindbaren, emotionalen Hürden haben deutlich zugenommen, folgert die Nürtinger Initiativgruppe. Ausgehend von dieser Tatsache besteht die Projektidee darin, diese Spaltung zu überwinden und wieder in einen gesellschaftlich notwendigen Dialog einzutreten. In der ersten Projektrunde wird das Thema Corona behandelt. In einem klar umrissenen Setting mit bis zu 100 Teilnehmern kommt die emotionale Haltung zu einem Themenkomplex wie Corona anders zum Ausdruck und verdeutlicht die Schnittmengen und Gemeinsamkeiten innerhalb einer Stadtgesellschaft tragfähiger als Argumente oder Meinungen, so die Zielsetzung der Gruppe. Resultierende Effekte wie Abgrenzung, Spaltung und Denken in Schablonen sollen in den Hintergrund, die gemeinsame Verantwortung für das Miteinander und die gesellschaftliche Kraft des Verstehens wiederum in den Vordergrund treten.
Gründung einer Zeitbank in Oberkirch für bargeldlose Unterstützung in vielen Lebensbereichen, entsprechend der Kompetenzen und Bedürfnissen der teilnehmenden Personen. Beratung zu Organisation und Umsetzung des Projektes.
Eine Gruppe von Studierende des Studiengangs Stadtplanung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen hat sich zum Obertorium zusammen geschlossen und möchte den Platz und die Fußgängerzone "Am Obertor" gestalterisch und nutzungstechnisch aufwerten. Der Platz soll den Charakter eines Durchgangsraums ablegen und zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. Das Projekt untergliedert sich in drei Phasen, der Analyse-, Konzeptions- und Interventionsphase. Bei allen Maßnahmen wird die Stadtbevölkerung und insbesondere die Anwohner durch partizipative Prozesse einbezogen und dazu motiviert, auch nach der Projektphase weiterzumachen.
Zunächst wird der Platz untersucht und der Öffentlichkeit präsentiert, ein Konzept erarbeitet und abschließend umgesetzt.
Das Familienzentrum ist ein Ort der Begegnung für verschiedene Generationen und Kulturen. Der Austausch zwischen Familien, Generationen, Kulturen wird hier gefördert und ein soziales Netz für Familien gesponnen. Um auch in Zeiten der Pandemie mit den Familien im Austausch zu bleiben, werden Angebote online stattfinden, als Ergebnis einer Umfrage unter den Familien.
Die Angebote dienen der Familienbildung und schaffen einen Rahmen, in dem Gemeinschaft und Teilhabe gelebt werden kann. Das Familienzentrum gibt damit Impulse für den Familienalltag, bietet Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe an.
Der Bürgerverein Hörnle & Eichgraben fungiert als Ansprechpartner der Bürger*innen für die Gestaltung der beiden Stadtteile und bildet die Brücke zur Stadt und anderen Institutionen.
Mit einem öffentlichen Bücherschrank für die Bewohner des Stadtteils Hörnle entsteht ein neuer Ort für Kultur und Austausch. Hier können kostenfrei Bücher getauscht werden. Veranstaltungen wie z.B. Tag des Buches, Aktionen zu Buchmessen in Leipzig oder Frankfurt bringen die Menschen am Bücherschrank zusammen. Mit dem Literaturarchiv, beheimatet in Marbach, greift der Öffentliche Bücherschrank das Thema der Stadt auf.
Der Bürger-, Kultur- und Förderverein "OSTstadt e.V. - Vielfalt verbinden" hat das Ziel, die soziale und kulturelle Lebensqualität der in der Oststadt von Schwäbisch Gmünd lebenden Menschen ideell, sozial und finanziell zu unterstützen und zu fördern. Der Verein hilft bei der sozialen Integration im Quartier, fördert Kinder- , Jugend- und Nachbarschaftshilfe, unterstützt Kunst und Kultur, begleitet aktiv die Gestaltung des Stadtteils mit, koordiniert die Zusammenarbeit von Vereinen und Institutionen im Quartier sowie interkulturelle Begegnungen und Patenschaften vor Ort. Die Vielfalt steht dabei im Vordergrund. Mit dem Aufstellen des Bücherschranks im Zentrum der Oststadt und der gezielten Mischung der Bücher in verschiedenen Sprachen für unterschiedliche Alters- und Bevölkerungsgruppen schafft ein attraktives Angebot für zahlreiche Lesewünsche und Lesebedürfnisse. Gemeinsame Leseabende für Erwachsene wie Buchvorstellungen durch Autoren, Diskussionen über ein gemeinsam gelesenes Buch oder Vorlesestunden für Kinder finden als begleitende Veranstaltungen zur besseren Verständigung und für den Austausch der Kulturen in den Nähe des Bücherschrankes statt.
Der Arbeitskreis Klimaschutz hat sich aus der lokalen Agenda-Gruppe heraus gegründet und initiiert Projekte in der Stadt. Ziel ist es, die Bürgerschaft für den lokalen Klimaschutz zu aktivieren und beizutragen, dass das kommunale Klimaschutzkonzept der Stadt umgesetzt wird. Aus einer Ideensammlung der Bürger*innen haben sich drei Handlungssäulen und laufende Projekte dazu entwickelt: Mitmachen: Kenzingen blüht und summt, Selbermachen: Balkon-PV-Anlage, Umdenken: Car-und Bike-Sharing.
Um noch mehr Mitmacher*innen zu finden, ist eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit notwendig.
Engagierte Bürger haben sich zur Klimainitiative Schwäbisch-Gmünd zusammengefunden, um ihren Beitrag zur Klimaneutralität der Stadt zu leisten. Ziel der Gruppe ist es, Interesse zu wecken, aktive Mitstreiter zu gewinnen und gemeinsam den komplexen Weg zur Klimaneutralität zu gestalten. Mit Aktionen, Projekten und Veranstaltungen bringen sie klimapolitische Themen in die Öffentlichkeit. Um kontinuierlich weitere Mitstreiter zu gewinnen wird eine fundierte und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut.
LagEB e.V. ist ein landesweiter Verein, der als Bindeglied zwischen ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierten in den Gemeinden, der öffentlichen Verwaltung und der Politik agiert. Ziel des Vereins ist es, die Fachkräfte aus dem bürgerschaftlichen Engagement und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg als weitere Mitglieder für sich zu gewinnen und Interessierte zu informieren. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Demokratie, der Positionierung zu sozial- und fachpolitischen Entwicklungen. Der Verein stärkt, qualifiziert und vernetzt die hauptamtlichen Fachkräfte des Bürgerschaftlichen Engagements und der Bürgerbeteiligung vor Ort und sorgt für einen Wissensaustausch. Gute Öffentlichkeitsarbeit in Form einer Homepage, des Logos und diverser gedruckter Materialien ist dabei notwendig.
Labyrinth e.V. hat zum Ziel, adäquate Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz zu schaffen. Er verwaltet und gestaltet dazu zwei Demenz-WGs mit Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst. Angehörige und der Vereinsvorstand tragen die Selbstverwaltung ehrenamtlich. Angehörige der Bewohner und weitere ehrenamtliche Helfer gestalten ein abwechslungsreiches Zusammenleben in familiärer Atmosphäre, sodass die dort lebenden demenzerkrankten Menschen in möglichst selbst bestimmter Weise gesellschaftliche Teilhabe erfahren können, wie es in Pflegeheimen nicht möglich ist.
Der Stadtjugendring Herrenberg möchte ein neues Angebot für Jugendliche mit Fluchterfahrung erarbeiten, um dadurch weitere Begegnungsmöglichkeiten zu den vor Ort ansässigen Jugendlichen zu schaffen. Neue Projekte sollen auf den bestehenden Strukturen und Angeboten aufbauen und diese ergänzen. Beratung benötigt der Stadtjugendring zur Gestaltung eines passenden Prozesses.
Mit einer Unterschriftenaktion von 09-21 bis 03-22 hat unsere Gruppe die Grundlage geschaffen, dass Stadt und Gemeinderat von Öhringen die Vergabe zur Erstellung eines Klimaaktionsplans beschlossen haben. Er wird bis zum Frühjahr 2023 von einem Freiburger Planungsbüro erstellt mit dem Ziel einer lokalen Klimaneutralität bis 2035 alt. 2040.
Unsere Gruppe hat mit Klimagesprächen ( Stadtgespräch ) begonnen, um die Bevölkerung für die notwendigen Veränderungen im Alltag zu sensibilisieren.
friga ist eine Sozialberatungsstelle für Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Sie erhalten umfassende Informationen über Leistungen und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen und beim Umgang mit Ämtern. Ziel ist die Existenzsicherung der betroffenen Personen.
Da mittlerweile vorwiegend auf digitalem Wege die Antragstellung und Kommunikation mit Behörden abgewickelt wird, aber nicht jeder Haushalt über eine funktionsfähige IT-Infrastruktur verfügt, stellt die friga diese zur Verfügung. Im Rahmen dieses Projekts können Ratsuchende mit Unterstützung erfahrener Ehrenamtlicher ihren Antrag mit der Infrastruktur der friga bearbeiten.
Der Verein buefet e.V. möchte zum Erhalt der individuellen Lebensqualität vor Ort beitragen. Da die Aufgabenbereiche des Vereins seit der Gründung immer vielfältiger wurden sollen die Vereinsstrukturen überdacht werden. Beratung erhält der Verein zu Fragen der Organisationsentwicklung.
Durch das Projekt entsteht eine nachhaltige Konzeption für den Quartierstreff, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der Anwohnerschaft zugeschnitten ist. Der Verein organisiert unter anderem Fahrradtouren, ein monatlich stattfindendes Café für Alt und Jung und ein Sommerfest. Somit wird ein generationenübergreifendes Miteinander im Quartier unterstützt und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt. Die Beratung erhält die Gruppe für die Bilanz des bisherigen Wirkens und Ideenfindung für die Zukunft.
Die Organisation "BRH Rettungs- und Suchgruppe ReSuG Heidenheim e.V." schafft einen Ort für Begegnung, Mensch und Hund im Quartier. Zielgruppe sind primär alte, oft auch verwirrte und einsame Menschen, die sowohl in Heimen als auch zuhause leben. Weitere Zielgruppen sind Kinder in Schulen, selbstmordgefährdete Personen, für die Begegnung mit ausgebildeten Hunden nachweislich therapeutische Wirkung zeigt. Diese Verortung bietet auch Chancen, Netzwerkarbeit im Landkreis zu vertiefen durch die Einbindung kooperierender Organisationen. Die Beratung erfolgt zu den Themen Strategieentwicklung, Projektmanagement und Fundraising.
Die Rettungshundestaffel steht das ganze Jahr allen Menschen zur Verfügung und kommt beim Finden von vermissten oder verschütteten Personen zum Einsatz. Die Staffel bietet viele Engagementmöglichkeiten, die stetig erweitert werden. Nach 20 Jahren mobiler Arbeit hat die Stadt dem Verein in Erbpacht ein Grundstück und Räumlichkeiten überlassen. An diesem Standort ist es dem Verein möglich, im Quartier sichtbar zu sein und Projekte anzustoßen. Das Projekt "Ort für Begegnung Mensch und Tier im Quartier" richtet sich an alte und oft verwirrte, einsame Menschen, die in Heimen oder zu Hause leben. Sucheinsätze sind zunehmend ausgelöst durch diese Personengruppe, daher bietet das Projekt Prävention gegen Einsamkeit. Um Bürgern zu diesem Projekt zu informieren und Mitwirkungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wird Öffentlichkeitsarbeit benötigt.
MachEbbes wurde als eine Plattform der Bürgerbeteiligung in Ehningen auf Wunsch der Gemeinde zur Belebung des Ortskerns ins Leben gerufen. Seitdem engagieren sich ca. 100 Bürger/-innen in Beteiligungsgruppen zu verschiedenen Themen, um als „Fachleute vor Ort“ eigene Bedarfe zu thematisieren und die Lebensqualität in der Gemeinde zu steigern und zu sichern. Das ursprüngliche Thema der Ortskernbelebung geriet in Vergessenheit, soll aber aktuell in einem Workshop mit allen Beteiligungsgruppen aufgearbeitet werden, um Ideen der verschiedenen Akteure zusammenzubringen und daraus konzentrierte Planungsalternativen zur Ortskernbelebung zu entwickeln. Beratung erhält die Initiative zur Zusammenführung der bisherigen Ergebnisse und zur Umsetzung der Ergebnisse aus dem Workshop im Herbst.
Das Ziel des Projekts ist es, die unbenutzten Flächen in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd für Gemeindegärten zu nutzen. Das Projekt PALETTI-Gemeinde-Garten bietet eine einfache Gelegenheit für kulturelle Begegnung und Austausch für Gmünder und neu Angekommene beim gemeinsamen Gärtnern. Es ist ein niederschwelliger und integrativer Schritt in die Gemeinschaft. Die Menschen sollen über das Thema "Garten" zusammenkommen, das Miteinander in der Kommune wird dadurch gestärkt. Der Verein erhält professionelle Beratung für die Realisierung des Projekts, für die Beteiligung von Mitmachern sowie für Kooperationen und den passenden Umgang mit der Kommune.
Kommunikations- und Informationsnetzwerk rund um Palliativ- und Hospizarbeit in Stuttgart
Eine Erzieherinnengruppe treibt im Kindergarten in Heiligkreuzsteinach das Thema Partizipation in Krippe und Kindergarten voran. In der Einrichtung werden Stück für Stück partizipative Entscheidungsstrukturen etabliert. Ein Format ist die Kinderkonferenz, die gemeinsame Entscheidungen in Bereichen wie Planung der Mahlzeiten oder der Schlaf- und Ruhephasen zusammen mit den Kindern ermöglicht. Dazu gibt es Elternabende, die mit partizipativen Methoden gestaltet werden. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten für den Prozess finanziert, wie zum Beispiel ein Flipchart sowie ein Whiteboard.
Der Kreisjugendring Tübingen möchte ermöglichen, dass Jugendkulturveranstaltungen als Partizipationsprojekte stattfinden. Dazu möchten sie ein Festival initiieren, das zur gezielten Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen sowie jugendrelevanten Themen beitragen soll. Zudem sollen junge Menschen im ländlichen Raum erreicht werden, die ansonsten nicht angesprochen werden. Beratung erhält der Kreisjugendring zur Verknüpfung von Jugendbeteiligungsverfahren und Jugendkulturveranstaltungen.
Der „Trägerverein für offene Jugendarbeit e.V.“ aus Kirchzarten möchte ein Projekt initiieren, das allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Kirchzarten die Möglichkeit der politischen Teilhabe bietet. Mit dem JUPARTI (JUgendPARTIzipations-Forum) soll eine Beteiligungsform entstehen, die allen Kindern und Jugendlichen aus Kirchzarten zugänglich ist. Beratung erhält der Trägerverein zu Fragen des Projektmanagements.
Ziel des Teams ist ein ehrenamtlich organisiertes Nahversorgungszentrum. Eine Bedarfsanalyse wurde bereits Im Rahmen des DORV-Prozesses durchgeführt und ausgewertet. Die Gründung einer „Marktplatz 11“ Genossenschaft ist geplant. Ein Bürgerforum als Infoveranstaltung soll über diese Rechtsform informieren, Genossenschaftsanteile werden hier direkt angeboten. Das Team erhält qualifizierte Prozessberatung zur Einrichtung des Nahversorgungszentrums.
Das Esslinger Klimabündnis besteht aus unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Initiativen der Stadt und setzt sich mit der Zukunft der Stadt Esslingen auseinander. Damit zusammen hängt auch die Suche nach Lösungen auf die laut Antragsteller "epochaltypischen Probleme der Klimakrise auf der lokalen Ebene". Das Bündnis möchte zivilgesellschaftliche Expertise lokal bündeln, um eine Verbesserung der Lebensbedingungen für alle Esslinger zu erreichen. Mit dem neuen Projekt "Partyzipationssofa" können Esslingens Bürger an verschiedenen Orten in den Dialog zum Thema Klimagerechtigkeit kommen. Im Dialog sollen konkrete Ideen entstehen, die dazu beitragen können, Esslingen klimagerechter zu machen. Das Format ist niederschwellig angelegt und soll den Teilnehmenden Freude bereiten. Die Ergebnisse werden festgehalten und gemeinsam mit der Verwaltung und dem Gemeinderat auf ihre Umsetzbarkeit überprüft.
Die Initiative ermöglicht mit dem Projekt eine zukunftsorientierte Quartiersentwicklung auf sozialer, kultureller und ökologische Ebene und fördert die Vernetzung im Viertel Kleineschholz in Freiburg durch einen Beteiligungspavillon, um die gemeinwohlorientierten Wohnprojekte zu konzeptionieren und umzusetzen. Für die strukturierte Projektplanung,-organisation und -umsetzung, sowie für Finanzierungsfragen und Fördermöglichkeiten für die vielfältigen Angebote im Beteiligungspavillon erhält die Initiative die Beratung.
Im Rahmen der KlimaWerkstatt Dossenheim, hat sich der Arbeitskreis Klimapfade für Dossenheim gebildet. In einem Klimagespräch wurden Bürger*innen bereits zum Dialog eingeladen. Zentrale Frage des Arbeitskreises lautet: Welche konkreten Maßnahmen muss die Gemeinde (alle Bürger*innen, Gewerbetreibende, Vereine, Kirchen, etc.) ergreifen, um bis 2040 klimaneutral zu sein?
Der AK besteht aus 8-10 Bürger*innen und 1-2 Mitarbetier*innen der Gemeindeverwaltung und soll durch eine externe Moderation begleitet werden.
In der ersten Phase wird ein Prozessdesign erarbeitet, in der zweiten erarbeiten Teilarbeitskreise konkrete Handlungspfade, die mit Zielen und Maßnahmenplänen hinterlegt sind. Die Ergebnisse werden der Bürgerschaft vorgestellt und diskutiert, um sie dann dem Gemeinderat und der Bürgerschaft zur Umsetzung zu übergeben.
Der Aktionskreis PflegeKulturDemenz baut durch verschiedene Aktivitäten und Engagement von Menschen in Wangen ein Beziehungsnetz auf, um ein unterstützendes, offenes Klima für die Themen wie Pflege, Kultur, Demenz zu schaffen. Anknüpfend an bestehende Netzwerke im Quartier greift die Begegnungsstätte aktuelle Fragestellungen zu diesem Thema auf und bietet ein Forum für Diskussion und Auseinandersetzung. Beratung erhält die Initiative zu Bürgerengagement im Umfeld der Pflege, zu Inhalten und Methoden der Unterstützung.
Der Arbeitskreis Pflegewohngruppe aus Frittlingen möchte eine eigenverantwortliche Pflegewohngruppe gründen und eine Seniorenbegegnungsstätte sowie eine Tagespflegegruppe einrichten. Auch soll im Dorf das „ZeitbankPLUS - Modell“ eingerichtet werden. Ziel ist es, die bestehende Initiative später in einen gemeinnützigen Verein zu überführen, der auch Träger und Verwalter der Zeitbank sein soll. Beratung erhält der Arbeitskreis zur bevorstehenden Vereinsgründung sowie zur Initiierung der Zeitbank.
Die Initiativgruppe schloss sich im Anschluss an das Bürgerdialog zum Thema „Nahversorgung in Heiligenberg – Entwicklung und Perspektiven“ zusammen, um den Aufbau eines bürgerschaftlich initiierten und finanzierten Nahversorgers mit einem Café bzw. Bistro als Treffpunkt und einer Bäckerei im Hauptort Heiligenberg in den Räumlichkeiten der ehemaligen Sparkasse voranzutreiben. Durch die Einkaufsmöglichkeit von Ort wird die fußläufige Grundversorgung mit Lebensmitteln und Haushaltsartikeln des täglichen Bedarfs abgedeckt sowie die Fahren in die Nachbargemeinden reduziert. Fachmännische Beratung und Projektbegleitung erfolgt für den Gründungs- und Entstehungsprozess.
Die Arbeitsgruppe Umwelt, Energie & Verkehr beschäftigt sich auf lokaler Ebene mit den Herausforderungen des Klimawandels in Hinterzarten. Mit konstruktiven Beiträgen zu klimarelevanten Entscheidungen begleiten sie die Arbeit des Gemeinderates. In einem Klimagespräch wurde der Fokus in den nächsten Monaten auf Leuchtturmprojekte gelegt. Beim ersten Projekt geht es um die Nutzung von Photovoltaik auf öffentlichen Parkplätzen, um damit den Ausbau von Photovoltaik zu beschleunigen, der im Vergleich zu Nachbargemeinden in Hinterzarten niedrig ist. Im Vorfeld sind Recherchen für die Realisierung von Photovoltaik auf Parkplätzen notwendig. Die eigenen Recherchen der Gruppen werden durch externe Beratung ergänzt. Nach Abschluss der Planungen werden diese Grundlagen für die Realisierung an den verantwortlichen Entscheidungsträger in der Gemeinde überreicht.
Der türkische Arbeitnehmerverein aus Lorch beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Missständen im alltäglichen Leben türkisch-stämmiger Menschen. Diese Missstände macht der Verein sichtbar, um Verständnis dafür zu schaffen. Dabei ist es dem Verein wichtig, alle Menschen bei diesen Themen mitzunehmen. Mit den Nachbarschaftsgesprächen lädt der Verein zu einem Workshop ein, wie man verschiedene Konflikte im Alltag zielführend lösen kann. Hierzu setzt der Verein das Format "Forumtheater" im Workshop ein. In diesem Format wird schauspielerisch aufgezeigt, welche Konflikte alltagsnah entstehen. Zusammen mit dem Publikum wird spielerisch nach praktischen Lösungen gesucht. So entstehen (neue) Handlungsempfehlungen, die der Verein in einem Folgeschritt auch in einer zweisprachigen Broschüre (Türkisch und Deutsch) festhalten möchte. Der Lorcher Gemeinderat wird zu einer Teilnahme am Workshop eingeladen, um die Lokalpolitik vor Ort mitzunehmen.
Klimaentscheid Schorndorf ist eine Initiative von Bürger, die sich für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels einsetzen. Sie möchten den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt hinterlassen und möchte dafür direkt in der eigenen Stadt beginnen. Dazu haben sie einen Einwohnerantrag für ein klimaneutrales Schorndorf 2035 gestellt, der vom Gemeinderat mit großer Mehrheit angenommen wurde.
Die Initiative möchten diesen komplexen Prozess begleiten und ein Bewusstsein in der Bevölkerung dafür schaffen. Auf vielen Ebenen ist ein Umdenken notwendig, innovative Ideen, Verzicht und Veränderungsbereitschaft braucht es. Daher ist eine große Transparenz und die Einbindung breiter Bevölkerungsschichten wichtig. Die Initiative macht sich stark dafür, einen Bürgerrat einzusetzen, der Empfehlungen für die Politik erarbeitet. Um diese Idee erfahrbar zu machen, wird ein Pilotbürgerrat mit 25 zufällig ausgelosten Einwohner durchgeführt. Sie treffen sich einen Tag lang und diskutieren das Thema "Worin liegt die Chance von Solarstrom und wie kann es gelingen, mehr Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet zu realisieren?". Die TN bekommen Input von Experten und erarbeiten dann in Kleingruppen Vorschläge, die im Plenum diskutiert werden. Mit einer Punktvergabe wird abschließend eine Rankingliste erstellt, die der Stadtverwaltung und dem Stadtrat als Empfehlung vorgelegt wird. Die Veranstaltung wird von Medien begleitet und transparent nach außen kommuniziert.
Die „SAGES eG" ist eine Genossenschaft für Haushaltshilfen und Alltagsassistenz für Senioren und Familien in Freiburg. Seit 2019 ist sie gemeinnützig. Die SAGES betreibt ein digitales Helferportal, das den bürgerschaftlichen Nachbarschaftshilfen Synergieeffekte durch schnellere Vermittlung von Helfern für Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende oder ältere Menschen ermöglicht. Mit dem „Pixi-Heft" im barrierearmen Comicstil visiert der Antragsteller zwei verschiedene Zielgruppen an: Zum einen hilfsbedürftige Menschen, denen es eine Anleitung an die Hand gibt, wie das digitale Helferportal genutzt werden kann. Zum anderen richtet sich das Heft an potentielle Helfer, denen es Einblicke in Abläufe, Rollen und Strukturen der SAGES-Arbeit ermöglicht. Dazu ist das Heft ein niederschwelliges Kommunikationsmedium für Anlässe wie Messen oder Infoveranstaltungen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für den Druck der Hefte anfallen.
Die Initiative „Miteinander – füreinander in Mettenberg“ engagiert sich für die Idee einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Ziel des Projektes ist die Durchführung einer Bürgerversammlung unter dem Titel „Lebensqualität in Mettenberg – Zukunft gemeinsam gestalten“. Interessierte Bürgerschaft wurde eingeladen aktiv an einer nachhaltigen und generationengerechten Weiterentwicklung des Dorfes mitzuwirken. Das Netzwerk der informellen Nachbarschaftshilfe sollte dabei ausgebaut werden. Professionelle Beratung und Begleitung der Initiative bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Bewohnerversammlung war hier notwendig.
Die Initiative „Miteinander – füreinander in Mettenberg“ engagiert sich für die Idee einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Die Durchführung einer Bürgerversammlung unter dem Titel „Lebensqualität in Mettenberg – Zukunft gemeinsam gestalten“ ist geplant. Interessierte Bürger werden eingeladen, aktiv an einer nachhaltigen und generationengerechten Weiterentwicklung des Dorfes mitzuwirken. Das Netzwerk der informellen Nachbarschaftshilfe soll dabei ausgebaut werden. Beratung und Begleitung der Initiative bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Bewohnerversammlung.
Auf Grundlage der Ergebnisse eines Jugendhearings gestalten Jugendliche zwei Grillplätze in Radolfzell zu attraktiven Versammlungsorten um. Das Hearing hat der Radolfzeller Jugendgemeinderat selbst durchgeführt. Die Stadt unterstützt die Gruppe durch Mitarbeiter der Abteilung „Landschaft und Gewässer“. Zusätzlich werden Anwohner, die bereits in einem Runden Tisch zur Vereinbarung einer Nutzungsordnung der Grillplätze einbezogen wurden, zu einer Baustellenbesichtigung eingeladen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Verpflegung beim Aufbau sowie der Baustellenbesichtigung anfallen.
Der Radentscheid Heidelberg setzt sich für die Verkehrswende, Klimaschutz und die Vision Zero (keine Verkehrstote oder Verletzte) ein. Angestoßen durch einen Radentscheid hat sich der Gemeinderat hinter die Forderungen für mehr Sicherheit und Platz für Radfahrende gestellt. Bei der Erarbeitung der Rad-Strategie 2030 ist der Radentscheid involviert und bringt sich inhaltlich mit ein.
Zur Oberbürgermeisterwahl plant der Radentscheid eine Podiumsdiskussion mit den drei chancenreichsten Kandidierenden zum Thema Verkehr. Die Veranstaltung bietet den Bürgern ein Forum, in dem sie die Kandidierenden mit ihren Fragen konfrontieren und Feedback mitgeben können.
Der Kreisjugendring ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Vereinen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Die Qualifizierung und Unterstützung der Ehrenamtlichen ist dabei eine wichtige Aufgabe. Hierzu haben sie eine Arbeitsgruppe zur Akquise von Ehrenamtlichen im Landkreis Sigmaringen gegründet, da durch die Corona Krise auch das Ehrenamt in die Krise gekommen ist. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, Ehrenamtlich zu unterstützen, weitere zu gewinnen und bereits Engagierte im Ehrenamt zu halten. Vereine berichten, dass viele Ehrenamtliche nicht mehr in ihre frühere Tätigkeit zurückgekehrt sind und es schwer ist, neue zu werben. Eine Online-Umfrage soll verlässliche Daten dazu liefern, die in einer Diskussionsveranstaltung mit der Politik ins Gespräch gebracht werden.
Eine engagierte Bürgergruppe plant eine Begegnungsstätte mit drei Bausteinen: Dorfladen, Dorfcafé und Veranstaltungsort. Damit sollen fehlende Einkaufsmöglichkeiten ersetzt werden und ein Treffpunkt zur Stärkung und Belebung von sozialen Kontakten vor Ort eingerichtet werden. Ein altes Bauernhaus in der Mitte vor Hausen wird dafür umgebaut (Hofladen, Stall). Beratung erhält die Initiative zu möglichen Rechtsformen und zur Einrichtung von einem Dorfladen inklusive eines Dorfcafés.
Kollegialer Verbund für prozedurale Praxis in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
Die Projektgruppe Sonnenseite besteht aus Personen, die alternative Wohnformen für pflegebedürftige Menschen schaffen möchten, Gemeinschaft fördern und den alten Ortskern von Bönnigheim-Hofen wieder beleben wollen.
Ziel der geplanten ambulant betreuten WG ist es, die Selbstbestimmung sowie Lebensqualität der Bewohner in einer Wohngemeinschaft zu erhalten und zu fördern. Die Versorgung von Tieren und die Bewirtschaftung eines Gartens ermöglichen den Bewohnenden Verantwortung zu übernehmen und eingebunden zu sein. Die Bewohner haben unterschiedliche Pflegestufen und sind unterschiedlich alt. Generationsübergreifende Angebote mit den Bürger des Ortes sind zusätzlich geplant.
Die ambulant betreute WG sorgt für die Selbstbestimmung sowie die Lebensqualität der Bewohner*innen und steht darüber hinaus bei alltäglichen Dingen unterstützend zur Seite. Die Bewohner*innen nehmen wahr, dass sie die Verantwortung und Versorgung der Tiere im Rahmen ihrer Möglichkeit mittragen, wodurch sie sich gebraucht und wertvoll fühlen. Bewohner*innen werden Menschen mit verschiedenen Pflegestufen sein, unter anderem Senior*innen sowie auch jüngere Menschen. Auch soziale, generationenübergreifende Angebote sind für den laufenden Betrieb geplant. Die Beratung erfolgt zur Gründung der Rechtsform, steuerlicher Aspekte für das Beteiligungsprojekt und innerhalb der Wohngemeinschaft, den Anforderungen einer verbindlichen Auskunft des Finanzamtes bzgl. Gemeinnützigkeit und Spendenanerkennung für das Beteiligungsprojekt "Sonnenseite" und der Nutzung/Einbindung gemeinnütziger Aspekte sowie Bauthemen für das gemeinnützige Projekt.
Die Initiative „Zukunft in Hinterzarten“ arbeitet an einer bürgerzentrierten, infrastrukturellen Ortsentwicklung. Innerhalb der Initiative sind acht Projektgruppen aktiv. Die Projektgruppe „Lebensqualität“ will in der Gemeinde Hinterzarten seniorengerechten Wohnraum für ältere Mitbürger schaffen. Hierzu will die Projektgruppe zunächst eine Befragung innerhalb der Bevölkerung durchführen, um die Bedarfe in Bezug auf Größe, Menge, Art, Örtlichkeit zu ermitteln. Die Befragung soll professionell begleitet werden. Unterstützung und Beratung erhält die Projektgruppe von der Fachhochschule Freiburg.
Die Projektgruppe Stadtbelebung wurde 1982 gegründet und hat den Hinterhof der Seyfferstraße/Gutenbergstraße/Ludwigstraße/Rötestraße als Kommunikations- und Spielplatz ins Leben gerufen und gemeinsam mit den Anwohnern gestaltet und angelegt. Die Initiative hat bewirkt, dass statt eines Parkplatzes eine
Tiefgarage umgesetzt wurde und die Dachfläche ist nun seit bald vierzig
Jahren eine grüne Oase im Stuttgarter Westen und damit wohl einer der
ältesten bürgelich initiierten urbanen Gärten der Stadt.
Der Verein bemüht sich um eine unabhängige Kulturarbeit und die Schaffung einer geeigneten öffentlich zugänglichen Begegnungsstätte, sowie der Durchführung von Veranstaltungen die der Bildung und dem kulturellem Leben dienen.
Das Bürgerbündnis für Demokratie engagiert sich für eine lebendige Demokratie, aktive Bürgerschaft und die Hervorhebung der vorhandenen Vielfalt in Radolfzell. Die Initiative plant eine große Projektschmiede „Demokratiearbeit“ im Rahmen einer Demokratiekonferenz vor Ort durchzuführen, um vorhandene Beteiligungsideen in konkrete Projekte zu schmieden. Verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten werden in Workshops aufgezeigt und gefördert. Hilfestellung rund um die Entwicklung und die Durchführung der Projektschmiede „Demokratiearbeit“ wird als Beratung benötigt.
Cyber Valley, Europas größtes Forschungskonsortium zu künstlicher Intelligenz (KI), möchte eine ethisch und sozial reflektierte Forschung. Wir laden Bürger:innen deshalb ein zu unseren regelmäßig stattfindenden Dialogformaten. Unser Ziel: mehr Austausch zwischen Gesellschaft und KI-Forschenden und idealerweise eine echte Beteiligung der Gesellschaft. Haben Sie Interesse, diesen Wissenschaftsdialog mitzugestalten und gemeinsam mit unseren Public Engagement Managern Formate zu entwickeln oder an ihnen teilzunehmen? Melden Sie sich gerne!
Ziel des Projektes ist der Erhalt des Dorfladens und einer lebendigen Ortsmitte in Bad Boll. Die Initiative Dorfladen Lindenblüte verhindert dadurch das Wegbrechen der direkten Grundversorgung. Der Erhalt einer qualitativen Nahversorgung stärkt den ländlichen Raum und trägt zur nachhaltigen Mobilitätsstruktur bei, in der Einkäufe zu Fuß ermöglicht werden. Der Beratungsgutschein wurde zur Erstellung eines Geschäftskonzeptes und zur Genossenschaftsgründung benötigt.
Das Projekt zum Erhalt des Dorfladens und einer lebendigen Ortsmitte in Bad Boll. Die Initiative Dorfladen Lindenblüte möchte das Wegbrechen der direkten Grundversorgung verhindern. Der Erhalt einer qualitativen Nahversorgung stärkt den ländlichen Raum und trägt zur nachhaltigen Mobilitätsstruktur bei, in der Einkäufe zu Fuß ermöglicht werden. Die Beratung zur Erstellung eines Geschäftskonzeptes und zur Genossenschaftsgründung.
Das MGH Mosbach engagiert sich seit 2008 als Kooperationspartner für und mit allen Generationen in zahlreichen Projekten vor Ort. Das seit Jahren leerstehende Gebäude des ehemaligen Modehauses C&A soll wiederbelebt werden und zur Entstehung eines neuen Quartiers beitragen. Geplant sind das MGH im EG, eine Kindertagespflege und Wohnungen für Senioren im OG. Das MGH wird als offener Treff für gesellschaftliche und soziale Teilhabe, Bewegungsmöglichkeiten für Bürger, Vereine und Initiativen in Form eines nicht gewerblichen Bistros betrieben. Ziel des Projektes ist es, die Anliegen und Wünsche der Bürger in wöchentlichen Stammtischen und in größeren Ideenwerkstätten aufzunehmen und daraus neue bedarfsgerechte Projekte im MGH zu entwickeln. Die Initiative erhält Beratung zu praktischen Methoden der Bürgerbeteiligung sowie zur Projektinitiierung.
Der Verein „Hirschbachclub“ engagiert sich seit über 100 Jahren für die nachbarschaftlichen Beziehungen und sozialen Projekte vor Ort im kleinsten Stadtteil Hirschbach. Insgesamt gibt es 17 verschiedene Quartiere/Stadtteile in Aalen, derzeit entsteht ein neues. Über das Projekt „Quartier Q03 - Bürger entwickeln ihr Quartier“ soll die interessierte Bürgerschaft an einer Quartiersentwicklung beteiligt werden, die ein Zusammenwachsen aller bisherigen Stadtteile im neuen Q03 fördert und sicherstellt. Ziel des Projektes ist es, die Lebensqualität im Quartier nachhaltig zu verbessern, ansässige Akteure zu vernetzen sowie ein Zentrum für Begegnung und Beratung bedarfsgerecht aufzubauen. Die Bürgerschaft soll ein eigenes Profil entwickeln und die Identität im Q03 fördern. Der Verein erhält hierfür eine qualifizierte Prozessberatung.
Wir, der Treffpunkt Rötenberg und das Ökumenische Gemeindezentrum Peter und Paul haben uns im Sommer 2022 auf den Weg gemacht um hier in unseren Stadtteilen mit vielen Kooperationspartnern ein lebendiges Quartier zu entwickeln. Mit im Boot sind die beiden Kindergärten, die Aalener Wohnungsbau, die beiden Kirchengemeinden und die Stadt Aalen. Gemeinsam entwickeln wir viele neue Angebote mit den Bewohnern für die Bewohner!
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Heimbewohner in ihrem Alltag helfend zu begleiten, die Arbeit des Pflegedienstes und der Heimleitung ehrenamtlich zu unterstützen. Die Mitglieder des Freundeskreises helfen bei der Eingewöhnung, begleiten bei Arztbesuchen, Behördengängen oder Veranstaltungen außerhalb und engagieren sich bei Festen und Veranstaltungen im Jahresablauf. Neue Ideen sind die Kochkurse für Senioren und Kinder, Arabischer Abend im Café Rosa, Runde Tische, um die Wünsche der Bevölkerung zu ermitteln. Der Beratungsgutschein wird zur Professionalisierung von Beteiligungsprojekten sowie zur nachhaltigen Steigerung des ehrenamtlichen Engagements eingesetzt.
Die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren steht als Ansprechpartner für Ehrenamtliche, Vereine und Initiativen vor Ort. Der Verein vernetzt, koordiniert und fördert über die Fortbildungsangebote. Mehrere Bürgerbefragungen haben großen Bedarf an strukturellen Verbesserungen sowie an neuen Hilfeangeboten zu Seniorenhilfe, Betreuung von Asylsuchenden, Unterstützung von jungen Familien festgestellt. Professionelle Prozessberatung zur Konzeptenzwicklung und zur Durchführung von geeigneten Angeboten wird benötigt.
Die Gruppe plant ein generationsübergreifendes, alters- und pflegegerechtes Wohnprojekt zu bezahlbarer Miete. Sie ist aus dem Runden Tisch zum Thema „Alternative Wohnformen“ in Metzingen hervorgegangen. Weitere Ergebnisse des Runden Tisches werden ebenfalls aufgearbeitet: Durchmischung im Quartier, Inklusion, keine isolierten Zielgruppen, „Dorf im Dörfle“ mit gemeinsam genutztem Sozialraum. Ein Café oder kleinere Gewerbe sind denkbar. Beratung erfolgt zur Projektentwicklung und zur Projektplanung sowie zur Wahl der Rechtsform.
Das Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit dem Kloster und der Bürgergesellschaft ein Konzept zur Quartiersentwicklung auf dem Klosterberg zu erarbeiten. Der Klosterberg soll zu einem barrierefreien Quartier werden, und eine neue, offene Mitte erhalten. Wohnen, Nachbarschaft und Zusammenleben aller Altersgruppen stehen dabei im Zentrum, besonders Menschen mit Unterstützungsbedarf im Alter. Dabei wird Historisches bewahrt und Neues gewagt. Die Pflege- und Wohnflächen sind von großer Bedeutung für die Gemeinde. Beratung zur Konzept- und Strukturentwicklung des Beteiligung Prozesses, sowie zur Durchführung und der Kommunikation.
Der Trägerverein Mehrgenerationenhaus Veringenstadt e.V. setzt sich mit dem demografischen Wandel auseinander und begleitet generationsübergreifende Begegnungen in drei Ortsteilen der Stadt. Beratung erhält der Bürgerverein zum Prozess der Neuaufstellung bzw. der Umstrukturierung, zur Profilbildung in der Öffentlichkeit, zur künftigen Ausrichtung sowie zur Gewinnung von weiteren Mitgliedern.
Im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen des Klosters in Gengenbach entsteht ein neues Quartier. Das Areal wird lebenswert und sozialverträglich umgestaltet. Die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude werden einer neuen Nutzung mit finanzierbarem Wohnraum für jüngere Frauen/Mütter mit Kindern sowie älteren alleinstehenden Frauen zugeführt. In diesem Sozialraum werden die unterschiedlichsten Beratungsangebote von verschiedenen Trägern angeboten. Die Beratung findet unter anderem zu den Themen Prozessbegleitung (u.a. Moderation der Treffen mit den beteiligten Akteuren), Wohnprojekt, Aufstellung der Trägerschaft, Zusammensetzung der Mieter*innen statt sowie zur Verträglichkeit mit der Ordensgemeinschaft..
Die Initiative engagiert sich für ein selbstbestimmtes Leben im vertrauten Umfeld bis ins hohe Alter in den Bereichen Pflege, Betreuung und soziales Engagement. Aufbau eines Unterstützernetzwerks zur Verbesserung der Mobilität, zur Unterstützung beim Schriftverkehr, Bewältigung des Alltags, Begleitung von Pflegenden ist geplant. Der Beratungsgutschein wird bei der Konzeptentwicklung für den Aufbau eines Seniorennetzwerks eingesetzt.
Der Verein bietet seit den 70er Jahren klassische Altenhilfe an und ist fest im öffentlichen Leben und in der Bürgerschaft verankert. Aktuell ist die Eröffnung eines Quartierhauses geplant, mit den Angeboten wie betreutes Wohnen, ambulante Pflege, Tagespflege usw. für ein langes selbstbestimmtes Leben in Quartier. Im Mai 2019 findet ein Quartiersfest zur Vernetzung der im Quartier ansässigen Institutionen und der im Quartier lebenden Bürgerinnen und Bürgern statt. Beratung wird zur Konzeptentwicklung für das Fest, für die Aktivierung der Bürgerschaft im Quartier sowie für die Auslotung der Kooperationsmöglichkeiten eingesetzt.
Das Quartiersmanagement stößt positive Entwicklungen an und fördert Ideen sowie Projekte, die zur Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse beitragen und den sozialen Zusammenhalt im Hasenleiser stärken. Bürger*innen werden in ihrem Quartier unterstützt, ihre Bedarfe zu äußern und sie unter professioneller Leitung des Quartiersmanagements in dauerhafte und sich selbst tragende Angebote umzusetzen. Hierfür werden die Akteure aus den verschiedenen Bereichen (Verwaltung, Kommunalpolitik, lokale Vereine, Institutionen und Anwohnende) zusammengeführt und vernetzt. Eine besondere Rolle an dem Entwicklungsprozess nimmt die aktive Teilhabe und Motivation der Bewohner*innen ein. Die Übernahme von Verantwortung für das eigene Quartier wird somit langfristig gestärkt.
Die Stiftung Großheppacher Schwesternschaft fördert und begleitet gelingendes Leben durch Erziehung, Bildung, Gemeinschaft und Pflege. Auf dem Gelände des Stammhauses entsteht ein Familien- und Bildungszentrum mit einer Naturwerkstatt. Zum neuen Zentrum gehören auch eine naturnahe KiTa, ambulante Tagespflege für Senioren, Beratungs- und Seminarräume sowie Wohneinheiten für generationsübergreifendes Wohnen in Gemeinschaft. Beratung Entwicklung eines Quartierskonzeptes und Erarbeiten der Beteiligungsformen, zu Projektorganisation.
Auf dem Areal „Wiedenhöferstift“ entstehen ein neues Pflegeheim, betreutes Wohnen und Wohnraum für Generationen. Das Ziel des Projekts ist es, ein nachhaltiges, integratives, alters- und generationsgerechtes Quartierskonzept zu entwickeln, welches auch die Anwohner des angrenzenden gewachsenen Stadtteils involviert. Der Verein erhält Unterstützung bei der Planung des Beteiligungsprozesses.
Initiative Quartierswerte Vauban
Im Freiburger Stadtteil Vauban wurde basierend auf einem Impuls-Quartiersfilm ein Dialog mit den Einwohnern vor Ort angestoßen. Dabei sollte eine bereits durchgeführte Bestandsanalyse als Basis dienen. In den anschließenden Nachbarschaftsgesprächen wurden die Werte im Quartier diskutiert. Aspekte wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und die allgemeine Bereitschaft zum Teilen wurden bei den Gesprächen besonders in den Mittelpunkt gerückt.
Das Queere Zentrum Tübingen setzt vor Ort das Projekt "Queer, nah & hier" im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche um. Das Projekt öffnet einen offenen Raum für die öffentliche Auseinandersetzung zu Themen rund um queere Identitäten, Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in Tübingen. Dabei wird bei der Projekteinladung auch auf bestehende Netzwerk- und Kooperationspartner gesetzt. Das Projekt soll queeres Leben in Tübingen sichtbarer machen und queere sowie nicht-queere Personen zum Dialog einladen. Zu den regelmäßigen Öffnungszeiten des Zentrums werden Passant*innen angeregt, sich niederschwellig mit queeren Themen auseinanderzusetzen. In einem Raum für alle Altersgruppen werden so Vorurteile abgebaut und gezeigt, dass queere Personen nicht neben, sondern innerhalb der Gesellschaft ihren Platz haben. Ein weiteres Projektziel ist es, mit dem gewählten Thema Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Milieus zu adressieren, um eine breite Sensibilisierung innerhalb der Stadt und im ländlichen Umkreis von Tübingen zu erreichen.
Die "RadKnoten-AG" gestaltet im Erlebnisraum Nackarschleuse umweltfreundliche Mobilität attraktiver, indem sie eine Radservice-Station an der Feudenheimer Schleuse installiert, die zu einem Ort der Begegnung mit Café, Reparatur-und Sitzgelegenheiten wird und zudem Kultur und Mitmach-Aktionen anbietet. Beratung erhält die Initiative für die Architektur und Gestaltung, zur Vereinsgründung, sowie zur digitalen Vernetzung.
Die Initiative engagiert sich für die Schaffung der Möglichkeit zur Beteiligung und Einbringung in der Stadtgesellschaft für die gesamte Bürgerschaft. Die Integration aller, der betroffenen Menschen mit Migrationshintergrund, der Menschen mit Behinderung und der älteren Generation, bedeutet auch, dass Beteiligungsformate, die es bereits gibt, für möglichst alle Beteiligten zugänglich sind. Was es dafür braucht und wie so etwas ermöglicht werden kann, wurde bisher nicht hinterfragt. Dies wird gemeinsam erforscht, was geht und was vielleicht gar nicht von Interesse ist. Die Arbeit des bestehenden Behindertenrates wird langfristig neu aufgestellt, die bisherigen Abläufe werden dabei optimiert. Beratung zur Organisation des Beteiligungstages.
DNA - Die Neuen Alten setzen sich für gelingendes Älterwerden und Altsein in Freiburg ein. Sie bietet eine Plattform für Menschen, die nachbarschaftliches Miteinander, neue Wohnformen und selbstbestimmtes Altern mitgestalten möchten. Die Gruppe verbindet der Wunsch einer neuen Sichtweise auf das Älterwerden.
Um DNA sammeln sich unterschiedliche Formate der Bürgerbeteiligung. Die einzelnen Formate organisieren sich eigenständig und haben sich in Corona-Zeiten auch digital getroffen.
Damit sich die Projekte eigenständig darstellen können, wird ein Rahmenflyer mit unterschiedlichen Informationsblätter entwickelt, um zielgruppenspezifisch Menschen einzuladen.
Gemeinsam für Morgen setzt sich für Klimaschutz ein, denkt dabei global und handelt lokal. MORGEN steht dabei für Mobilität, Offenheit, Regionalität, Generationengerechtigkeit, Energie und Nachhaltigkeit.
Der Aktionstag "Rauf auf's Rad" motiviert alle Menschen der Gemeinde aufs Rad umzusteigen. Der Vorteil des Radfahrens wird anhand von unterschiedlichen Aktionen und Stationen aufgezeigt, um langfristig eine möglichst große Beteiligung zu erzielen. Geplant sind Informationsstände, Bastelaktionen, Workshops zum Fahrrad flicken und ein Fahrradkino mit Kurzfilmen zum Radfahren, das durch gemeinsam erzeugten Strom durch Radfahren betrieben wird.
Vereine, Kindergärten, Schulen, Ärzte und Betriebe sind daran beteiligt und werden durch einen Wettbewerb eingeladen, ihre Fahrradstellplätze auszubauen.
Aus dem Prozess eine Sorgende Gemeinde zu werden ist ein Beteiligungsprozess entstanden, um ältere Menschen mit der Hilfe von jüngeren Menschen im Alltag zu unterstützen. Drei Handlungsempfehlungen sind dabei entstanden. Das Projektteam legt im ersten Schritt den Fokus auf die Einrichtung einer Anlaufstelle im Quartier mit der Unterstützung der Kommune. Ein Verein als rechtliches Dach für das Vorhaben ist in Gründung. Ziel ist es, ein Quartierhaus in Graben-Neudorf zu schaffen, das Menschen aller Altersgruppen niederschwellig Begegnung ermöglicht. Das Haus bietet die Teilhabe von älteren Menschen am Gemeindeleben, unterstützt sie mit Hilfestellungen, hier werden bestehende Aktivitäten vernetzt und Strukturen aufgebaut, damit weitere Stadtteile, Organisationen und Zielgruppen eingebunden werden können.
Durch die Initiative entsteht ein Raum für Begegnung, der Menschen, insbesondere im höheren Alter, Unterstützung in Form von Teilhabe am Gemeindeleben, Hilfestellungen anbietet und koordiniert, sowie mit Menschen aller Altersgruppen in Kontakt bringt. Die Beratung bezieht sich auf die Themen: Prozessbegleitung, um den Beteiligungsprozess zu professionalisieren und die Ehrenamtlichen des Projektthemas zu entlasten; durch einen systemischen Ansatz Akzeptanz des Vorhabens in der Gemeinde bezwecken; Fachkompetenz im Bereich "Quartier" und "Fürsorgende Gemeinschaft" für das Projekt erhalten.
Beim Projekt „Raum für Ideen“ geht es um das Mehrgenerationenhaus mit einem integrierten offenen Bürgertreff. Neues bürgerschaftlichen Engagement wird mit dem Projekt initiiert und koordiniert. Das Mehrgenerationenhaus schafft einen Rahmen für aktive Bürgerschaft, in dem sie ihre Ideen zu Gestaltung ihres Lebensraums einbringen, gemeinsam weiterentwickeln und dafür Unterstützung erfahren. Beratung zur Vorbereitung und Durchführung einer Zukunftswerkstatt, zur Öffentlichkeitsarbeit.
Beim Projekt „Raum für Ideen“ geht es um das Mehrgenerationenhaus, in dem ein offener Bürgertreff seinen Platz haben könnte. Neues bürgerschaftliches Engagement soll mit dem Projekt initiiert und koordiniert werden. Mit dem Mehrgenerationenhaus soll ein Rahmen für aktive Bürgerschaft geschaffen werden, in dem sie ihre Ideen zu Gestaltung ihres Lebensraums einbringen, gemeinsam weiterentwickeln und dafür Unterstützung erfahren können. Beratung zur Vorbereitung und Durchführung einer Zukunftswerkstatt, o.Ä.
Das ehemalige Traditionsgasthaus „Zur Flasche“ soll durch die Initiative „Freunde der Flasche“ wiederbelebt werden. Im Stadtteil fehlt ein lebendiger Treffpunk. Ziel der Initiative ist es, das Gebäude zu erwerben, zu sanieren und zu betreiben. Das Haus wird durch Ehrenamtliche getragen, Strafgefangene sowie Geflüchtete werden miteinbezogen. Eine Genossenschaft als Rechtsform wird geprüft. Dafür benötigt die Initiative professionelle Begleitung.
Die Bürgergemeinschaft ist ein Zusammenschluss von vier Senioren-Organisationen. Im Projekt soll in Kooperation mit der Gemeinde und der Bürgergemeinschaft die Realisierung des Wohnkomplexes durchgeführt werden. Die Gemeinde betreut das Bauprojekt und die Bürgergemeinschaft möchte sich um den anschließenden Betrieb kümmern. Dafür wird Beratung für die gemeinsame Erarbeitung eines organisatorischen Konzeptes der Wohngemeinschaft benötigt.
Die Initiative vernetzt Alten-und Behindertenarbeit, Familienhilfe und sonstige generationenübergreifende Tätigkeiten. Seit bereits 19 Jahren setzt sich die Initiative dafür ein Anlaufstelle und Beratungsstelle für ältere Menschen und pflegende Angehörige zu sein. Durch einen Wechsel in der Geschäftsführung wird durch das Projekt die Zukunftsausrichtung mit Hilfe von ehrenamtlichen Bürger*innen ausgearbeitet, um somit das Angebot nachhaltig zu sichern. Die Beratung erhält die Initiative zur Entwicklung von Visionen, Sensibilisierung für Veränderungsprozesse, Gewinnung Ehrenamtlicher und Etablierung neuer Angebote.
Die Natur- und Vogelfreunde Efringen-Kirchen haben sich dem Schutz und der Pflege der heimischen Pflanzen- und Tierwelt sowie ihrer natürlichen Lebensräume auf dem Gemeindegebiet gewidmet. Im Rahmen des Projektes wird eine Fläche entlang der Bahntrasse klimafreundlich entwickelt. Vorgesehen ist unter anderem das Anlegen einer Streuobstwiese sowie einer Magerwiese. Bürger*innen der Gemeinde sind zur Mitarbeit an der Sträucher- und Baumpflanzung eingeladen. Zudem wird im Anschluss ein virtueller Wanderführer implementiert.
Die Initiative "KlikKS - Ehrenamt trifft Klimaschutz" hat das Ziel, möglichst viele Mitbürger*innen zu begeistern, ökologisch wertvolle Gärten anzulegen. Klima- und Artenschutz soll Spaß machen und möglichst viele Menschen sollen Selbstwirksamkeit erfahren. Konkret soll durch unterschiedliche Formate aufgezeigt werden, wie ein pflegeleichter und ökologisch wertvoller Garten gestaltet werden kann. Als Aktionen angedacht sind neben der Bereitstellung von Informationen in Flyern auch Workshops und ein "Tag des offenen Gartens".
Das Ziel der Initiative ist die Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema Nachhaltigkeit sowie bewusste Gestaltung der Gemeinschaft und Begegnung mit den anderen. Das ehrenamtliche Team bringt verschiedene Fähigkeiten beim reparieren der unterschiedlichen Dinge im Holz- oder Elektrobereich mit, in der Organisation von Veranstaltungen, der EDV oder beim Catering mit ausgebackenen Kuchen und fair gehandelten Kaffee. Das Reparatur Café hat folgende Ziele: der Wegwerfgesellschaft etwas entgegenbringen, Müll vermeiden, Ressourcen schonen und sparen, aktiven Umweltschutz praktizieren, Hilfe zur Selbsthilfe initiieren, damit die Menschen lernen ihre defekten Sachen selbst zu reparieren.
Die Bürgerinitiative "Rettet das Arbachtal" setzt sich gegen weiteren Flächenverbrauch im Arbachtal im Außenbereich von Pfullingen ein. Das Ziel der Initiative ist es, die Stadt Pfullingen zu überzeugen, dass auch ohne weiteren Flächenverbrauch ausreichend Bauflächen für Wohnen und Gewerbe vorhanden sind. Die Stadt Pfullingen arbeitet ihrerseits gemeinsam mit dem Nachbarschaftsverband Reutlingen-Tübingen an einer Überarbeitung des Flächennutzungsplans (FNP), um auf einem Teilstück im Arbachtal eine Bebauung für Gewerbe und Wohnbau in Zukunft zu ermöglichen. Die Initiative will den weiteren Planungsprozess mit eigenen Informationsveranstaltungen begleiten, um zum geänderten Flächennutzungsplanentwurf eigene Stellungnahmen sowie Alternativvorschläge zur Bebauung im Außenbereich bekannt zu machen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Initiative im Rahmen der Informationsveranstaltungen anfallen.
Bäume und Hecken am Acker sind wichtig für Boden und Wasser und als Windschutz und wertvoller Schatten bei Hitze. Da der Schwund in der Nähe Breisachs und anderswo zunimmt, stellt das Projekt im Programm Kickstart Klima Gelegenheiten für direkte Mithilfen von Bürgern. Bewirtschafter stellen den Platz zur Verfügung und Bürger helfen bei der Pflanzung, Bewässerung oder Öffentlichkeitsarbeit oder sie stiften ein Hinweisschild. Das Angebot des einen bewirkt den positiven Schritt des anderen. Es ist wie gemeinsamer Appell, der auch die Politik erreichen soll, denn Gehölze sind gerade im Hinblick auf den Klimawandel eine wichtige Stütze im Landschaftshaushalt. Das Projekt steht auch dafür, dass Menschen der Landwirtschaft mehr von Bürgern direkt unterstützt werden sollten.
Die Runden Tische sind ein Instrument der Zivilgesellschaft. Sie sollen Beteiligung ermöglichen und im Konsens neue Perspektiven schaffen.
Der Runde Tisch „Ehrenamt Naturraum Wutach“ umfasst eine Gruppe bestehend aus unterschiedlichen Vereinen aus drei verschiedenen Landkreisen rund um die Wutachschlucht. Diese haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam an den Themen Mitgliederschwund, Nachwuchsarbeit und Optimierung der Vernetzungsstruktur zwischen den einzelnen Vereinen zu arbeiten.
Das Projekt "Wir für Freiberg" wird vom Internationalen Bund durchgeführt und von der Stiftung DHW und der FLÜWO-Stiftung gefördert. Ziel ist es, das Miteinander und den Zusammenhalt im Stadtteil zu stärken. Bürger werden bei der Mitgestaltung des Quartiers unterstützt und Gelegenheiten für Begegnungen geschaffen. Bei einer Bedarfserhebung konnten Bewohnende Wünsche für das Quartier nennen. Diese Impulse werden nun in einem umfassenden Beteiligungsprozess fortgetragen und in konkrete Aktionen und Ideen für das Quartier umgesetzt. Dazu wird ein Runder Tisch gegründet, um lokale Einrichtungen und Bürger zu beteiligen. Ziel ist es, eine stärkere Vernetzung lokaler Akteure sowie die Motivation der Bürger zu stärken, sich für ihr Quartier aktiv einzusetzen.
Der PRO|RIWO e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität der Gemeinde Rielasingen-Worblingen zu steigern. Im Rahmen des Projekts „RW 2030“ soll ein Bürgerbeteiligungsprozess initiiert werden, der der Weiterentwicklung der Gemeinde dienen soll. Anhand von Workshops sollen Ideen erarbeitet sowie Alleinstellungsmerkmale der Gemeinde herausgearbeitet werden, um gemeinsam die Fragen anzugehen: Wie wollen wir in Zukunft in Rielasingen-Worblingen leben? Wie können wir gemeinsam die Zukunft gestalten? Beratung erhält der Verein zu Prozessmanagement und Prozessdurchführung des geplanten Bürgerbeteiligungsprozesses.
SAIG - Soziale Anliegen inspiriert Gelöst: Ausgehend von der Initiative des Arbeitskreises für SAIG startet die Initiative einen breiten Beteiligungsprozess in Saig, bei dem im alten Rathaus ein "Dorftreff" errichtet wird und das Gebäude multifunktional umgenutzt wird. Unter Berücksichtigung von Pfarrhaus und alter Bäckerei besteht zudem die Aussicht, neuen Wohnraum in der Ortsmitte zu schaffen. Dies geht man gemeinsam in einem "NahDa-Prozess" (Nachhaltige Daseinsvorsorge) unter Einbeziehung und mit Beteiligung der Bürger*innen, örtlicher Akteur*innen und Vereine an. Die Beratung erfolgt zu folgenden Themen: Gestaltung des Beteiligungsprozesses und Motivation der Akteure in Saig; Erstellung der Erstkonzeption/Basisanalyse: Good-Practice-Beispiele.
Die Initiative "Säntis: Miteinander - Füreinander" setzt im Hochhaus Säntis in Biberach (71 Wohnungen) eine Quartiersentwicklung als "Sorgende Gemeinschaft" um, bei der es insbesondere darum geht, ein "Miteinander-Füreinander" und somit ein Hilfenetzwerk zu schaffen. Die Beratung erfolgt für die Themen: Methodenwissen (Wie kann die Beteiligung der Bewohner*innen erfoglen?), Begleitung der Initiative bei der Entwicklung und Umsetzung des Planungsprozesses (Zeitplan, Auswertung, Dokumentation, Reflexion, weitere Schritte), Moderation von Treffen der Hausbewohner*innen, Hilfe beim Fragebogen und bei der Beteiligung der Hausbewohner*innen.
Die Einrichtung eines Bürgerzentrums im Stadtteil Plattenwald von Bad Friedrichshall, in dem 59 Nationen zuhause sind. Dadurch soll noch bessere Integration gelingen, weil die Anliegen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und in lockerer Atmosphäre in Erfahrung gebracht werden können. Außerdem werden neue Netzwerke und das „WIR Gefühl“ generiert. Der Verein erhält hierfür qualifizierte Projektberatung.
Der Vereinszweck des Heimatverein Backhäusle e.V. ist die Förderung, Pflege und Erhaltung von Kultur und Landschaft im mittleren Enztal. Um die Wertschätzung für die Steillagen und ihre Produkte zu erhöhen sowie die lokalen „Wengerter“ in der Bewirtschaftung der Flächen zu unterstützen soll jährlich ein „Schräglagen-Tag“ veranstaltet werden. Im Vordergrund stehen dabei zum einen die Weiterbildung der „Wengerter“ und der fachliche Austausch und zum anderen sollen die Steillagen und ihre Produkte für die Öffentlichkeit erfahrbar werden. Beratung erhält der Verein zur Projekt- und Konzeptentwicklung.
"Die Bildung eines Kindes ist Ergebnis und Verantwortung aller, in deren Mitte es lebt." (Eine von 7 Maximen der Offenen Bürgerschulen)
Mehr Partizipation aller: Schüler und Eltern und viele interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger
Die Gruppe Klimaentscheid Schorndorf setzt sich für ein klimaneutrales Schorndorf ein. Sie hat dazu einen Einwohnerantrag zu Schorndorf Klimaneutral 2035 erfolgreich gestellt. Der Gemeinderat hat den Antrag angenommen und erarbeitet aktuell einen Klima-Aktionsplan. Die Gruppe arbeitet eng mit der Stadt zusammen und veranstaltet Informationsveranstaltungen und Aktionen, um die Stadtgesellschaft stärker für den Klimaschutz zu beteiligen. Die Gruppe hat zudem einen Bürger*innenrat zum Thema Photovoltaik organisiert mit dem Ergebnis, dass sich die Bürger*innen niedrigschwellige und neutrale Beratung zum Ausbau von Photovoltaik wünschen. Daher möchte die Gruppe Klimaentscheid Schorndorf eine Bürger-Solar-Beratung aufbauen, bei der Bürger*innen sich von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen zum Thema Photovoltaik beraten lassen können. Damit wird ein bürgerschaftlicher Beitrag zur Energiewende erreicht.
Der Förderverein JuFuN ist für die Quartiersarbeit (Kinder- und Jugendarbeit, Familienarbeit und Gemeinwesenarbeit) in zwei Stadtteilen Schwäbisch Gmünds zuständig. Gemeinsam mit sechs weiteren Stadtteilen soll das Thema Bürgerbeteiligung in der Quartiersarbeit vor Ort verankert werden. Hierzu sollen bürgerschaftliche Akteure und die Stadtteilkoordinatoren gemeinsam geschult und beraten werden.
Im Rahmen des Projektes führen die Bewohner des Schützenplatzes in Workshops Analysen und Installationen für ihre Nachbarschaft rund um das Thema Recycling-Lösungen durch. Der öffentliche Raum dient dabei gleichzeitig als gemeinsamer Bildungsraum, als Beteiligungs- und Kommunikationsplattform. Im Fokus der Beratung liegen die Kommunikationsinfrastrukturen, die im Rahmen von „Schützenplatz – selbst gemacht“ mit Anwohnern entwickelt, realisiert und darüber hinaus genutzt werden können. Fachliche Beratung wird für die Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Konzepterstellung genutzt.
Der Landesverband Gemeindepsychiatrie (LVGP) erprobt mit der Mitgliedseinrichtung Freiburger Hilfsgemeinschaft e.V. neue Wege und Materialien zur Akquise von Ehrenamtlichen. Der LVGP hat sich zum Ziel gesetzt, neben den Psychiatrieerfahrenen, den Angehörigen und professionellen Diensten die Bürgerhilfe als gleichwertige vierte Säule weiterzuentwickeln. Mit dem Projekt SeelenBürger wird die Verbindung zwischen Bürgerschaftlichem Engagement und Seelischer Gesundheit gestärkt und die Ergebnisse in einen Leitfaden zur Gewinnung von ehrenamtlicher Bürgerhelfern zusammengefasst. Die Erfahrungen aus Freiburg zum Thema Bürgerhilfe und Psychiatrie werden allen Mitgliedern des Verbands in Form eines Leitfadens zur Verfügung gestellt.
In Freiburg wird gemeinsam mit aktiven Bürgerhelfern ein Leitfaden erarbeitet, wie ehrenamtliche Bürgerhelfern für Engagement im Bereich Sozialpsychiatrie gewonnen werden können und wie die Neuausrichtung der Bürgerhilfe angestoßen werden könnte. Weitere Akteure und Kooperationspartner werden durch Workshops eingebunden.
Ziel des Projektes war die Entstehung des nachhaltigen, bezahlbaren Wohnraum mit Pflege- und Versorgungsmöglichkeiten in Form einer Wohnungsbaugenossenschaft als gemeinschaftliches Wohnprojekt für Menschen ab 50 Jahren im Freiburger Stadtteil Wiehre. Die Beratung wurde zur Gründung einer Genossenschaft mit Entwicklung der Organisationsstrukturen sowie zur Projektplanung einer altersgerechten Wohnform für ein gutes nachbarschaftliches Leben im Quartier benötigt.
Die Entstehung der Wohnungsbaugenossenschaft als gemeinschaftliches Wohnprojekt für Menschen ab 50 Jahren im Freiburger Stadtteil Wiehre. Dort soll ein nachhaltiger, bezahlbarer Wohnraum mit Pflege- und Versorgungsmöglichkeiten entstehen. Die Beratung zur Gründung einer Genossenschaft mit Entwicklung der Organisationsstrukturen sowie zur Projektplanung einer altersgerechten Wohnform für ein gutes nachbarschaftliches Leben im Quartier.
Zur Gestaltung der vielfältigen Arbeit des Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart e.V. bedarf es einer klaren Vision und eines Leitbilds für die Arbeit des Gesamtvereins wie auch für die Ausgestaltung seiner verschiedenen Handlungsfelder. Dabei wird die hauptamtliche Arbeit sowie auch das Engagement von Ehrenamtlichen auf ein starkes Fundament gestellt. Diesen Prozess wird nun, gemeinsam mit Berater*innen vorangebracht, die bei der Entwicklung und Umsetzung eines geeigneten Prozesses, einer gemeinsamen Vision, Leitlinien und Wirkungslogiken helfen.
Die Gruppe Ideenwerktstatt Senioren setzt sich für die Weiterentwicklung ihres Stadtteils ein, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Belange der älteren Generationen. Begleitet wird die Gruppe durch das Stadtteil- und Familienzentrum.
Die Projektgruppe hat das Ziel Senioren Unterstützung im täglichen Leben zu bieten. Gerade alleinstehende ältere Menschen oder Zugezogene benötigen oft Hilfe bei kleinen Dingen. Mit einem Helfer-Team sollen Kompetenzen gebündelt werden, die dann von Senioren bei Bedarf angefragt werden können, beispielsweise bei handwerklichen Tätigkeiten oder der Orientierung im Stadtteil.
Die Arbeitsgruppe Seniorenarbeit Jettingen bindet Senior*innen mittels eines Forums ein, innerhalb eines Bürgerbeteiligungsprozesses die Bedarfe der Bevölkerung 60+ zu ermitteln und anschließend auszuwerten. Durch die Corona Pandemie sind Veranstaltungen für Senior*innen in den Hintergrund gerückt und laufen nur langsam wieder an, den Bedarfen und Wünschen wird mit dem Projekt nachgegangen. Die Beratung hierzu erfolgt für die Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Moderation und Nachbereitung des Senioren-Forums.
Das Ziel des Projekts ist seniorengerechtes, barrierefreies Einkaufen. Die Bürgerschaft im Ort soll so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Dafür werden die Heimsheimer Unternehmen für die Barrierefreiheit sensibilisiert. Für alle zugängliche Nahversorgung ist wichtig für die Sicherung des Lebensstandards und den kommunikativen Austausch der Bürger in unterschiedlichen Lebensphasen. Der Beratungsgutschein wird zur Erfassung des Ist-Zustands und zur Ausarbeitung möglicher Lösungen eingesetzt. Die erarbeiteten Vorschläge werden zur Umsetzung an die einzelnen Unternehmen weitergeleitet.
Konzeption und Durchführung von Angeboten zur gesellschaftlichen Teilhabe für Senioren/innen im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeit.
Der Verein Daheim in Kilchberg e.V. gründete sich mitten in der Corona Sommerpause mit dem Ziel, ambulante Wohnformen für den Tübinger Teilort Kilchberg in Kooperation mit der Senior*innenplanung Tübingen, der Beratungsstelle für den Aufbau ambulanter Pflege-Wohngemeinschaften und dem Ortschaftsrat Tübingen aufzubauen. Die Projekte sichern die Lebensqualität in Kilchberg nachhaltig und werden von der Bürgerschaft getragen. Nun sind die vereinsinternen Prozesse durch die Pandemieauflagen stagniert und es fehlen neue Impulse, um Teamfähigkeit wiederherzustellen sowie Methoden der hybriden digitalen Kommunikation zu erlernen. Der Verein lässt sich daher zu den Themen Teamentwicklung, Vereinsorganisation sowie digitale/hybride Kommunikationsstrategien beraten.
Das Seniorenmobil ist ein bürgerschaftlich getragenes Projekt des Trägervereins "Seniorenmobil Weinstadt e.V." für Weinstädter Bürgerschaft ab 60 Jahren. Aufgrund von Mobilitätseinschränkungen oder fehlender Infrastruktur erfahren ältere Menschen einen Verlust der gesellschaftlichen Teilhabe, da sie Dienstleistungen oder soziale Kontakte nicht mehr hinreichend aufsuchen und pflegen können. Dazu zählen ein Arzttermin, ein Wocheneinkauf, eine kulturelle Veranstaltung oder ein Friedhofbesuch. Das Seniorenmobil ermöglicht der älteren Bürgerschaft aktiv am Stadtgeschehen teilzuhaben. Die Fahrten erfolgen im Stadtgebiet Weinstadts und sind kostenlos. Übergreifendes Ziel ist es, die Mobilität von älteren Menschen im Ort zu verbessern und zu fördern. Die Themen Altersarmut und Einsamkeit stehen ebenfalls im Vordergrund, bürgerschaftliches Engagement und Nachbarschaftshilfe werden bei dem Projekt gestärkt. Regelmäßige Pressearbeit und die Sicherheitsschulungen sind notwendig für das Etablieren und gutes Funktionieren des Seniorenmobils.
Durch das Projekt entsteht mit Hilfe eines Beteiligungsprozesses ein Netzwerk für Senior*innen, das Treffpunkte gegen Einsamkeit schafft, Daseinsvorsorge vor Ort stärkt, Entdeckung neuer Hobbys fördert, Begleitung zu Besichtigungen und Vernetzung untereinander organisiert. Dabei wird besonders darauf geachtet bereits bestehende Angebote zu erweitern, terminliche Überlagerungen zu entzerren, Angebote an zentraler Stelle zu kommunizieren und einen dritten Ort zu etablieren, der barrierefrei und niederschwellig ist. Beratung erhält die Initiative zur Bildung eines Lenkungskreises, der Vorbereitung zur Bürgerbeteiligung, die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie und die Beauftragung durch Beschlüsse der Gemeinderäte.
Ziel des Antrags ist die Konzeption einer Pflegeeinrichtung im Pforzheimer Stadtteil Hohenwart, der einzige Stadtteil ohne Pflegeeinrichtung. Dabei soll die Konzeption unter Beteiligung der Betroffenen und unter Einbezug spezifischen Bedarfe entsprechend entwickelt werden. Beratung wird zu Fragen aktivierender Beteiligung, zur Bedarfsanalyse sowie zur fachspezifischen Konzeptentwicklung gefordert.
Die Bürgergemeinschaft erstellt ehrenamtlich einen Seniorenratgeber, in dem alle ehrenamtlichen Angebote sowie weitere Angebote aus der örtlichen Infrastruktur für Senioren dargestellt sind. Professionelle Anbieter von Unterstützungsangeboten werden von der Gruppe auch miteinbezogen. Für Neubürger soll der Ratgeber als schnelle Orientierungshilfe dienen. Die Gruppe schafft mit dem Ratgeber dazu einen niederschwelligen Überblick über die Versorgungsinfrastruktur für alle Senioren vor Ort. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Erstellung des Layouts des Ratgebers anfallen.
Wir sind eine Servicestelle, in der die Expertise dreier Landesverbände der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Landesjugendring, Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit und Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung) zum Tragen kommt. Unser Ziel ist, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg zu fördern.Wir verstehen Partizipation als aktive Mitgestaltung der Gesellschaft durch politische Beteiligung und Engagement. Ein besonderes Anliegen ist, dass sich alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Vielfalt an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen können – unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder Bildungsstatus.
Das Kulturparkett Rhein-Neckar setzt sich für kulturelle und soziale Teilhabe ein. Ihr Kernprojekt ist "Kultur für alle", dabei werben sie Kartenspenden für Kulturveranstaltungen ein und stellen diese Kartenkontingente Menschen mit geringem Einkommen kostenfrei zur Verfügung. Neben der Kartenvermittlung gestaltet der Verein niedrigschwellige Räume für Austausch und Begegnung zwischen Menschen, die sonst nicht zusammen kommen würden - so auch mit dem Projekt Shared Reading. Hier kommen Menschen in ungezwungener Atmosphäre freitags für 90 Minuten zusammen und lesen gemeinsam qualitativ hochwertige Literatur. Über das Gelesene kommt die Gruppe ins Gespräch, angeleitet von einer ausgebildeten Leseleiter. Ziel ist es, dass Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus über das gemeinsame Lesen Zusammenkommen. Jeder kann mitmachen, es wird kein Vorwissen benötigt. Während der Corona-Pandemie finden die Veranstaltungen digital statt.
Shared Reading ist ein partizipatives Leseformat, das Teilhabe und gesellschaftlichen Austausch fördert. Vermittelt durch die Literatur entstehen neue Begegnungsräume, in denen die vielfältigen Gruppen der Stadtgesellschaft niedrigschwellig ins Gespräch kommen können, unabhängig von Alter, Bildung, sozialem Hintergrund und Herkunft. Auf das gemeinsame Lesen muss sich niemand vorbereiten, es gibt in der Regel keine Anmeldepflicht und die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Shared Reading Gruppen werden von ehrenamtlich tätigen, ausgebildeten Facilitators (Leseleiter*innen) geleitet. In Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen gibt es inzwischen rund 40 ausgebildete Facilitators.
Die Vernetzung und das Treffen der Facilitator ist wichtig für den Erfahrungsaustausch. Daher ist ein Netzwerktreffen geplant.
OEKOGENO eG hat das Wohnprojekt Tischardter Straße als Leuchturmprojekt für gemeinschaftliches, ökologisches und inklusives Wohnen in Nürtingen gegründet. Das Wohnprojekt besteht aus 33 Wohnungen, darunter 2 Wohngemeinschaften für Menschen mit geistigem oder körperlichem Handicap. Teil des Wohnprojekts ist ein Gemeinschaftsraum, der von allen Bewohner*innen genutzt werden kann. Die AG Gemeinschaftsraum hat die Aufgabe, Infrastruktur und Regeln für die Nutzung zu entwickeln und der Hausgemeinschaft zur Abstimmung vorzulegen. Sie hat in einem breiten Beteiligungsprozess die Nutzung und Möblierung abgefragt. Ergebnis daraus ist, dass Flexibilität in der Ausstattung große Bedeutung hat, um den unterschiedlichen Nutzungen gerecht zu werden.
Seit ca. 2 Jahren besteht die Smart-City-Gruppe Bad Schönborn aus ehrenamtlichen Bürger*innen der Gemeinde und Mitarbeiter*innen der Verwaltung. Smart City bedeutet nicht nur DIGITAL, viel mehr werden in dieser Initiative Nachhaltigkeit und Digitalisierung in einem synergetischen Ansatz miteinander verbunden, um die Gemeinde Bad Schönborn weiterhin in einen modernen, zukunftssicheren und lebenswerten Ort zu begleiten.
„Smart Club“ – ein Projekt für das kreative Gestalten und Selbermachen eines (oder mehreren) mit digitalen Technologien bedienten Produkts. Die Idee entstand aus der großen Nachfrage seitens der Jungs, die den Verlauf von „Zahramagazin.com“ mitverfolgt haben. Das Projekt wurde im Rahmen von „Gut Beraten!“ gefördert und erfolgreich durchgeführt. Es ging dabei um den interkulturellen Austausch für Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund in einem Medienblog. Beratung erhält der Verein zur erfolgreichen Projektdurchführung.
Durch das Projekt erhalten Menschen mit geringerem Einkommen die Möglichkeit an klimafreundlicher Energieerzeugung zu partizipieren. Hierfür unterstützt die Initiative Bürgergeldempfänger*innen mit dem nötigen Equipment, bei der Montage und Anmeldung, sowie weiteren Informationen zur nachhaltigen Stromerzeugung. Hierdurch werden Stromkosten und CO2-Emissionen signifikant reduziert und die Sensibilisierung für Energieverbrauch und Energieeinsparung bei jeder und jedem gesteigert.
Die Initiative gründet eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Ettenheim zur Verbesserung der lokalen Lebensmittelversorgung. In einer Solawi finanzieren die Beteiligten den Anbau von Lebensmitteln und erhalten im Gegenzug die komplette Ernte, die sie unter sich aufteilen: frisch, regional und von hoher Qualität. Durch das solidarische Prinzip entsteht eine enge Bildung und Identifikation zwischen Produzent*innen und Konsument*innen und man verbessert die gegenseitige Wertschätzung. Die Beratung erfolgt zur Konzeptverfeinerung und Mitgliederwerbung sowie zu Wahl der Rechtsform und Kooperationsmöglichkeiten.
Das Klimaforum Schallstadt arbeitet in vier AG zu den Themen Energie, Konsum, Mobilität, Landschaftspflege und Öffentlichkeitsarbeit an konkreten Vorhaben und Projekten.
Ziel der Kampagne "Sonnenstrom vom eigenen Dach" ist die Bürger*innen für das Thema Photovoltaik zu sensibilieren und Hemmschwellen abzubauen, um den Anteil des vor Ort produzierten Sonnenstrom zu erhöhen. Bürger*innen sollen überzeugt werden, dass sie mit einer PV-Anlage einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz vor Ort leisten. Dazu werden zwei Veranstaltungen durchgeführt, bei der Experten von der Planung bis zur Umsetzung einer PV-Anlage berichten sowie Beratungsmöglichkeiten angeboten werden.
Eine Gruppe von Ehrenamtlichen hat in Leutkirch den Sonnentreff aufgebaut, ein offenes Café mit einer Foodsharing Fairteiler-Station. Der Sonnentreff hat sich zu einem Ort entwickelt, an dem Begegnung, Teilhabe und Nachhaltigkeit gelebt wird. Unabhängig von Alter, Konfession, Nationalität und Familiensituation finden hier Menschen unterschiedliche Nachbarschaftsangebote wie beispielsweise Eltern-Kind-Treffs, Näh- und Ideentreff, Foodsharing Station, Gesprächskreise und ein offenes Café mit Foodsharing-Produkten. Um die Corona-Auflagen umsetzen zu können werden Hygieneartikel benötigt, zudem Ausstattung für die Foodsharing Fairteiler Station und das Café.
Das „Soziale Netzwerk Ortenberg e.V.“ möchte ganz nach dem Motto „Ein Dorf hilft sich selbst!“ die Versorgungskette im Dorf schließen, durch die Einrichtung einer ambulanten Wohngruppe. Ein Grundstück sowie ein Bauträger wurden bereits gefunden. Das Projekt wird begleitet durch Workshops und Bürgerforen, in den umfassend über den aktuellen und weiteren Planungsstand informiert wird. Das Projekt erhält juristische Beratung für die Stabilität und Sicherheit des Projekts.
Die Gemeinde Untermünkheim hat sich im Jahr 2019 auf den Weg zur Sorgenden Gemeinde gemacht. Im Rahmen des im Förderprogramms „Nachbarschaftsgespräche“ durchgeführten intensiven Bürgerbeteiligungsprozess wurden die Vorstellungen der Bürgerschaft zu einem guten Zusammenleben in der Nachbarschaft erhoben und dokumentiert. Die Vorschläge und Ideen, die dabei erarbeitet wurden, sollen nun umgesetzt werden. Eine Initiativgruppe koordiniert die Aktivitäten und sucht nach Realisierungsmöglichkeiten. Beratung erfolgt zur Koordinierung der Initiativgruppe und zur Organisation des Umsetzungsmodells. Fachliche Begleitung zur Prozessberatung bei der Umsetzung von Ideen ist dabei notwendig.
Der Verein für Diakonie und Seelsorge ist 2005 entstanden, um die Arbeit der Krankenschwestern der örtlichen Diakoniestation zu unterstützen sowie durch ein Netzwerk von Ehrenamtlichen selbst Hilfe anzubieten. Im Rahmen des Programms "Nachbarschaftsgespräche" fand 2019 ein Beteiligungsprozess im Ort statt. Dabei wurden Ideen der Untermünkheimer Bürgerschaft für ein gutes Zusammenleben in der Nachbarschaft gesammelt. In dem aktuellen Projekt "Sorgende Gemeinde Untermünkheim" geht es darum, die im Rahmen des Beteiligungsprozesses erarbeiteten Ideen umzusetzen und nachhaltig zu organisieren. Konkret soll eine Anlaufstelle geschaffen werden, die nachbarschaftliche Unterstützung vor Ort initiiert und koordiniert. Das aktive Miteinander wird dabei gefördert. Eine Infomappe über die vorhandenen Angebote hilft, die unterschiedlichen Möglichkeiten im sozialen und kommunikativen Bereich gezielt der Öffentlichkeit zu transportieren.
Ziel des Arbeitskreises ist es, in Graben-Neudorf eine „Sorgende Gemeinde“ aufzubauen. Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses werden einzelne Initiativen zusammengeführt, neue Impulse und Angebote für das Quartier entwickelt. Beratung zu Professionalisierung des Beteiligungsprozesses.
Der Arbeitskreis arbeitet in Graben-Neudorf am Aufbau einer sorgenden Gemeinde. Mit diesem Projekt möchte die Gruppe auch das umgebaute Gemeindehaus gemeinsam mit den Bürgern als Anlaufstelle für das Quartier öffnen. Damit wird eine „neue Mitte" in der Stadt rund um das Gemeindehaus entstehen. Der Arbeitskreis hat ein Bürgerbeteiligungskonzept entwickelt, das auf agile Methoden setzt und so viele interessierte Beteiligte wie möglich einbeziehen soll. Die vier Beteiligungsschritte umfassen folgende Formate: Ein Auftaktworkshop mit verschiedenen Stakeholdern, ein World-Cafe-Format „Goldener Herbst", ein Zukunftsworkshop sowie ein Mitmachtag zur weiteren Aktivierung von Ehrenamtlichem Engagement. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für das Catering an den Beteiligungsveranstaltungen anfallen.
Selbsthilfevereinigung von Erwerbslosen und Sozialhilfebezieher
Die Initiative Moobiles Küssaberg engagiert sich für klimafreundliche und ressourcensparende Mobilitätsangebote ein. Sie leisten so einen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele 2030, hierbei spielt das Teilen eine große Rolle. Sie betreuen Carsharing- und Lastenräder-Standorte, vernetzen sich mit anderen Kommunen und beteiligen sich am Stadtradeln. Um Bürger*innen für das Thema zu sensibilisieren finden Gespräche statt, aus denen Aktionen umgesetzt werden, wie zum Beispiel ein Pede-Bus für Schulkinder oder der europäische Tag des Radelns.
Die Interessengemeinschaft Bürgerhaus Löwen möchte ein altes Gebäude im Ort ankaufen, mit dem Ziel es für die Bürgerschaft zu nutzen und gleichzeitig ein altes Gebäude im Ortskern zu erhalten. Es sollen Einkaufsmöglichkeiten für den Grundbedarf angeboten werden sowie ein Ort der Begegnung sein. Beratung erhält die Initiative zur Gründung einer Genossenschaft.
Der Linzgau Shuttle e.V. ist ein interkommunaler, als gemeinnützig anerkannter sozialer Fahrdienst, der in mobilitätseingeschränkte Personen, insbesondere Menschen mit Behinderung und ältere Menschen bedarfsgerecht von Tür-zu-Tür befördert. Der Linzgau Shuttle e.V. bietet an, den Fahrdienst auf den Gemeindeverwaltungsverband Meersburg auszuweiten und damit weiteren mobilitätseingeschränkten Personen barrierearme Mobilität bereitzustellen und die Bürgerbedürfnisse in einem größeren Sozialraum zu befriedigen. Die Beratung wird genutzt, um die nötigen Voraussetzungen für die Erweiterung des Einsatzgebietes unter Beteiligung der Fahrgäste sowie der Fahrer*innen zu schaffen.
Zukunftsmodelle für Menschen und Lebensräume
Die Ortsverwaltung Önsbach und der Bürgerverein Önsbach legen Wert darauf Ideen, Wünsche und Vorschläge der Bürger*innen in die Planung des neuen Dorfzentrums einfließen zu lassen und die Bürgerschaft an der Entscheidung über die Gestaltung des neuen Dorfzentrums zu beteiligen. So ist das Projekt „Bürgerbeteiligung Gestaltung Dorfzentrum Önsbach“ entstanden. Ziel des neuen Dorfzentrums ist es, den Bürger*innen jeden Alters – vor allem aber den älteren Generation – in Önsbach ein gutes Leben mit Teilhabe an einer lebendigen Dorfgemeinschaft zu ermöglichen. Durch die Bürgerbeteiligung wird zum einen der Erfolg des Gesamtprojektes Dorfzentrum Önsbach gesichert. Gelichzeitig wird mit dem Projekt „Bürgerbeteiligung Gestaltung Dorfzentrum Önsbach“ auch eine beispielhafte Erfahrung gelingender Bürgerbeteiligung bei kommunal bedeutsamen Bauprojekten ermöglicht.
An einem belebten Ort wie dem „Haus des Gastes“ diskutierten in Alpirsbach im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche Geflüchtete und die Stadtbevölkerung Perspektiven für ein künftiges Zusammenleben. Bei der entsprechenden Auftaktveranstaltung für alle Interessierte aus Alpirsbach wurden zunächst die örtlichen Herausforderungen bezüglich der Fragen „Wo stehen wir in Alpirsbach?“, „Was klappt gut?“ sowie „Wo besteht Handlungsbedarf“ ausfindig gemacht. In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden an verschiedenen Thementischen. Dabei wurden Themen wie „Kindergarten/Schule/Ausbildung/Arbeit“, „Akzeptanz in der Bevölkerung“, „Wohnen“ und „Freizeit“ als Schwerpunkte für die weiteren Diskussionen festgehalten.
In weiteren zwei, geschlechterspezifisch aufgeteilten Abenden hatten zum einen weibliche, zum anderen männliche Geflüchtete die Gelegenheit, in einem kleinen, vertrauten Rahmen ihre Sicht auf ihren Integrationsprozess in Alpirsbach zu reflektieren und vorzustellen. Aufgrund der teils stark voneinander abweichenden Lebenswelten der geflüchteten Frauen und Männer sollten durch die getrennten Abende geschützte Räume für ein offenes Gespräch geschaffen werden.
Nach einem weiteren Workshop für ehrenamtlich Engagierte zur Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation bezüglich des Engagements vor Ort, wurden alle Teilnehmenden zu einer Abschlussveranstaltung eingeladen. An dieser Veranstaltung präsentierten die Teilnehmenden die Ergebnisse der vier Nachbarschaftsgespräche. Es konnten alle Personengruppen über die größeren und kleineren, konkret umsetzbaren Maßnahmen ins Gespräch kommen. Auch der Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder waren bei den Veranstaltungen anwesend.

Im Sanierungsgebiet des historischen Ortskerns im Stadtteil Kochendorf, der sich
geographisch gesehen in der Mitte aller Stadtteile Bad Friedrichshalls befindet, soll die
Begegnungsstätte in einem Bestandsgebäude Einzug finden. Mit der Teilnahme im
Förderprogramm "Quartiersimpulse" soll der Beteiligungsprozess als Grundlage für
das Haus INKLUSIV gestaltet.
Das Haus INKLUSIV soll der Ort der Begegnung sein und vor allem bei älteren
Menschen der Einsamkeit entgegenwirken, in dem das Miteinander aktiv gelebt wird,
durch den Austausch und das Engagement der verschiedenen Besucher. Als Zentrum
der gesellschaftlichen Teilhabe steht das Haus allen Menschen offen- unabhängig von
Alter, Lebenssituation, sexueller Orientierung und Herkunft.
Das Miteinander und der Austausch der Generationen wird durch das ergänzende
Betreuungsangebot der Kernzeit ergänzt und unterstützt.
Das Pilotprojekt soll Gelingensfaktoren und Herausforderungen identifizieren, um
weitere Prozesse im Stadtgebiet zu fördern.
Unter dem Titel „Neues Wohnen für Jung und Alt im sozialen Umfeld der Stadt Bad Saulgau“ soll im Rahmen eines aktiven und transparenten und ergebnisoffenen Bürgerbeteiligungsprozesses (Stadt Bad Saulgau, Verein „Bürger helfen Bürger e.V.“ und interessierten Bürger*innen) ein Konzept für ein neues, zukunftsweisendes Wohnen in Gemeinschaftsformen über alle Generationen hinweg entwickelt werden und auf diese Weise die Lebensqualität vor Ort gestärkt werden.
Die Stadt Bad Waldsee unterstützt die Solidarische Gemeinde Gaisbeuren-Reute (SG) als zivilgesellschaftliche Organisation beim (weiteren) Aufbau von verlässlichen, bürgerschaftlichen Engagementstrukturen für ein seniorenfreundliches Älterwerden im Teilort Reute-Gaisbeuren. Die Solidarische Gemeinde ist seit 7 Jahren in Form einer bürgerschaftlichen Vereinsstruktur organisiert. Sie hat in dieser Zeitspanne unter dem Motto: „Selbsthilfe, Selbstorganisation und Solidarität“ unterschiedlichste Bedarfe im Sozialraum ermittelt, vielfältige Ehrenamtsstrukturen aufgebaut und für initiierte Projekte Verantwortung übernommen. Gelingende Nachbarschaften sind Leitlinie für gute Lebensqualität, auch um selbstbestimmt zu altern. Die Antragstellung im Förderprogramm „Quartiersimpulse“ soll die Themen und Ressourcen hierfür erweitern und ausbauen. Die Stadt Bad Waldsee erhofft sich von diesem „Pilot“ einen möglichen Transfergewinn für weitere Stadtteile/ Teilorte, mit Erfahrungen zu Bürgerbeteiligung, Engagementförderung und zu „Pflege-Mix-Konzepten“.
Im Stadtzentrum von Blaustein, Ortsteil Ehrenstein, wurde auf einer Industrie-Brache, an einem angrenzenden stillgelegten Steinbruch, das Wohnquartier Höhwiesen für ca. 200 Menschen geschaffen. Das Quartier ist von einer lebendigen Vielfalt geprägt. So leben dort junge Familien, Senior*innen, Lebensgemeinschaften mit unterschiedlichen nationalen und sozialen Wurzeln und Menschen mit Behinderungen. Die Stadt Blaustein hat in ihrem Bebauungsplan für diesen Bereich eine Grünfläche ausgewiesen, welche nun mit dem Projekt - Quartiersplatz Höhwiesen, Gemeinschaft gemeinsam schaffen - als Bürgerbeteiligungsprojekt zu einem generationenübergreifenden Quartiersplatz gestaltet werden soll. Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Blaustein und engagierten Anwohner*innen soll die Umsetzung des Quartiersplatzes erfolgen. Der Quartiersplatz soll barrierefrei und im Einklang mit der besonderen Natursituation (Steinbruch) gestaltet werden. Es soll ein lebendiger, generationen- und kulturübergreifender Ort geschaffen und mit Leben gefüllt werden, der als "Aufschnauf-Plätzle" seniorengerechte Sitzmöglichkeiten haben wird, und z.B. mit einem Bouleplatz zum gemeinsamen Spiel einladen wird.
Der „Grund“ ist ein Böblinger Stadtteil mit einem hohen Anteil älterer Bürger*innen. Viele davon haben einen Migrationshintergrund. Im Rahmen eines Stadtteilentwicklungsprozesses „Wir sind der Grund: Gut älter werden im Stadtteil“ fanden von Januar bis August viele Beteiligungsveranstaltungen statt. Folgende Anregungen daraus sollen im Projekt „Gut älter werden im Grund: Aufbruch 2020“ umgesetzt werden:
1. Veranstaltungen zum Thema Mobilität & Barrierefreiheit
2. Planungstreffen für Interessierte und Aktive (Bürger-Idee trifft Raum-Angebot & Unterstützung von Kooperationspartnern und Stadt)
3. „Auf dem Weg zum Treff im Grund“: Aktivierung von Bürger*innen zur Beteiligung an der Ausgestaltung des neuen Stadtteiltreffs, zum Thema Kommunikation im Stadtteil (Schwarzes Brett, Amtsblatt) und zum Thema „Alltagshilfe von Tür zu Tür“
4. Erstellung einer Konzeption „Seniorenbüro vor Ort“ mit Beteiligung, erste Umsetzungsschritte vernetzt mit bürgerschaftlichen Aktivitäten.
Bei den Nachbarschaftsgesprächen auf der Diezenhalde wurden alle Bürger dazu eingeladen, über das Zusammenleben im Stadtteil zu diskutieren.
Zunächst wurde eine Umfrage zur Zufriedenheit der Einwohner im Stadtteil mit zufällig ausgewählten Personen durchgeführt. Für die Ansprache wurden öffentliche Orte genutzt wie der lokale Markt, die Stadtteilbibliothek, ein Grünstreifen mit Erholungsmöglichkeit und die vor Ort vorzufindenden Spielplätze.
In einem nächsten Schritt wurden die Umfrageergebnisse gesammelt, vorgestellt und diskutiert. In diesem Kontext ergaben sich Arbeitsgruppen, die einzelne Themenbereiche vertieft bearbeiteten und Vorschläge zur Umsetzung formulierten. Aufgrund der Corona-bedingten Situation wurden die Gespräche hauptsächlich digital in Form von Videokonferenzen durchgeführt.
Im Zuge der Gespräche wurde deutlich, dass verschiedene Gruppen im Stadtteil aktiv sind ohne voneinander zu wissen oder miteinander zu kooperieren. Im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche vor Ort ist es gelungen, diese Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen. In der Folge sind nun gemeinsame Aktionen angedacht.
Schauen Sie sich gerne auch den Film der Nachbarschaftsgespräche auf der Diezenhalde an.
Wir möchten im Rahmen der Quartiersimpulse mit dem Projekt "Generationenstadt Ehingen" unsere Erfahrungen in der Kommunikation mit älteren Menschen und in der Unterstützung von älteren Menschen aus der Corona-Zeit überprüfen und weiterentwickeln, um das Miteinader der Generationen zu fördern und zu einem Netz der gegenseitigen Unterstützung beizutragen. Das Netzwerk und die Aktivitäten sollen in stark partizipativen Formaten entwickelt werden, um Tragfähigkeit und nachhaltiges Engagement zu gewährleisten. Die Steuerungsgruppe besteht aus relevanten zivilgesellschaftlichen und kommunalen Akteuren und ist ein offener Kreis. Vorerfahrungen aus den Nachbarschaftsgesprächen "Reden wir miteinander" werden in der Generationenstadt Ehingen aufgegriffen und weiter bearbeitet.
Unter dem Motto „Reden wir miteinander!“ konnte die Bewohnerschaft des Quartiers „Wenzelstein“ ihre Anliegen und Ideen für ihr Wohngebiet einbringen. Das Ziel dabei war es, ein „Wenzelstein“ für alle zu gestalten.
Um eine breite Beteiligung der Quartiersbewohner und eine situative Themen-Landkarte zu erhalten, wurden zunächst nach dem Zufallsprinzip Bewohner zur Befragung per Fragebogen eingeladen. Alle Themendimensionen wurden in einer ersten Projektphase mit den Dialogteilnehmern in einem moderierten Prozess zusammengetragen und soweit möglich vorpräferiert. Themen waren unter anderem "Begegnungsräume und Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen", "Jugend" und "Verkehr".
Weitere Gespräche fanden in der Folge am Wenzelstein statt: Podiumsdiskussionen im öffentlichen Raum, ein internationales Muttertagsfest, ein Speakers-Corner beim Frühlingsfest des örtlichen Handels, Interviews auf der Straße und das Aufsuchen der Bürger zu Hause.
Die zusammengetragenen Themenfelder wurden schließlich mit der Verwaltung rückgekoppelt und veröffentlicht.
Das Projekt in der Stadt Elzach mit all seinen Ortsteilen stellt die Entwicklung eines alters- und generationengerechtes Lebensumfeld in den Mittelpunkt. Ein gesamtstädtisches Verfahren mit Bürger*innen aus allen Ortsteilen, behandelt allgemeine Entwicklungsthemen rund um Alters- und Generationengerechtigkeit so, dass es eine positive Wirkung sowohl auf die Gesamtstadt als auch auf die Ortsteile haben wird. in einem thematisch offen angelegten Prozess werden mit unterschiedlichen Verfahren der Bürgerbeteiligung möglichst viele Menschen aktiv mit einbezogen. "Lokal", bezogen auf die Ortsteile und "global" mit Blick auf die Gesamtstadt will Elzach sich den Themen konkret annehmen, die insbesondere mit Blick auf die älter werdende Gesellschaft das Leben in der Stadt attraktiv hält. Im Blick sind jedoch auch alle Altersgruppen, daher wird auch zu einem Generationendialog eingeladen.
Mit dem Projekt „Bürgerkonzept Älter werden in Mundingen“ soll durch Beteiligungsveranstaltungen in Form von Bürgertischen intensiv durch die Einwohnerinnen und Einwohner Ideen und mögliche Lösungen erarbeitet werden, wie ein gutes Älter werden in Mundingen aussehen kann. Methodisch werden die Veranstaltungen so aufgebaut, dass zum Ende tatsächlich greifbare Ergebnisse stehen, die die nächsten Schritte ermöglichen.
Ziel des Projekts ist, eine Anlaufstelle und Plattform für den aktiven Austausch und eine dauerhafte Bürgerbeteiligung zu schaffen. Neue Aktivitäten und bestehende Angebote sollen hier gebündelt werden. Die Projektidee ist im Rahmen des Landesprogramms "Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft" in breiter Beteiligung entstanden. Nun gilt es, diese in einer zweiten Phase umzusetzen. Die Stätte richtet sich an Menschen aller sozialen Schichten, Kulturen, Generationen. Im Fokus stehen u.a. Maßnahmen einer alters- und generationengerechten Gestaltung des Lebensumfeldes sowie die aktive Einbeziehung von Gruppierungen, die sich bisher weniger in unsere Gesellschaft einbringen, insbesondere Migrantinnen und Migranten.
Wohnen bedeutet mehr, als in der durchaus glücklichen Lage zu sein, eine Wohnung zu haben. Das Wort „Quartier“ ist heute in aller Munde. In Fellbach entstehen durch die Wohnbauoffensive diverse neue Quartiere, andere Quartiere verändern sich beispielsweise durch den demografischen Wandel. Nun möchte sich Fellbach auf den Weg machen, um Quartiersarbeit in der Stadt zu verankern. Auf einem Weg führt jeder Schritt Richtung Ziel. Deshalb soll im Rahmen des Pilotprojektes vorrangig ein Gebiet „Wohnen für alle“, entwickelt werden. Die Ziele sind zunächst das Quartier, die Themengebiete und bestehende Angebote zu identifizieren. Außerdem die Zielgruppen zu benennen und zu aktivieren und die Kooperationspartner*innen zu vernetzen. Geplant ist geeignete Beteiligungsverfahren, mit dem Ziel konkrete Projekte und Maßnahmen für das Quartier zu erarbeiten, durchzuführen und eventuell bereits Projekte umzusetzen.
Haslach ist ein vielseitiger und sehr traditioneller Stadtteil Freiburgs.
Aufgrund von COVID konnten die Nachbarschaftsgespräche nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden. Deshalb wurde das Projekt vornehmlich digital durchgeführt. Die Aktivierung der Bürger erfolgte über klassische Medien wie ein Informationsblatt "Haslacher Bote" sowie über Flyer. Hierauf wurden die weiteren nutzbaren digitalen Kanäle kommuniziert. Auf der Kommunikationsplattform www.freiburghältzusammen.de wurde eine Gruppe eingerichtet, in der sich Mitglieder der Begleitgruppe sowie andere Teilnehmer der Nachbarschaftsgespräche austauschen und organisieren konnten.
Ein Online-Fragebogen wurde in sechs Sprachen ausgefertigt. Dieser wurde gemeinsam mit dem, ebenfalls in sechs Sprachen übersetzten, Flyer dafür genutzt, um auf die Online-Beteiligungsmöglichkeiten hinzuweisen. Außerdem wurde ein ganzseitiger Artikel und eine Werbeanzeige im Haslacher Boten gebucht, um die gesamte Bevölkerung mit dem Informationsangebot zu erreichen.
In der Folge hatten die Bürger von Haslach die Möglichkeit diese Fragebögen auf einer Webseite zu beantworten. Alternativ war es auch möglich, den Fragebogen per Post zu erhalten. Der Fragebogen diente dazu, gewünschte Schwerpunktthemen für die weiteren Gespräche sowie die insgesamte Zufriedenheit mit der Lebenssituation im Stadtteil bei den Bürgern abzufragen.
Im Zuge der Auswertung der Befragungsergebnisse wurden Schwerpunkte wie beispielsweise "bessere Verkehrssituation" sowie "Aufenthaltsmöglichkeiten/Treffpunkte" identifiziert. Da COVID nach wie vor die Gesamtsituation beherrschte, wurden diese Schwerpunkte in digitalen Austauschrunden - Dialog-Cafés - weiter diskutiert.
In den moderierten Dialog-Cafés wurden "Break-out"-Gruppen eingerichtet, um es kleineren Gruppen zu ermöglichen, ihre Projektideen zu konkretisieren. Im Plenum, dem Gesamtraum der Videokonferenz, wurde dann ein Feedback der anderen Teilnehmer eingeholt. Ziel war dabei die Verstetigung und Vernetzung der jeweiligen Projektidee und die kritische Prüfung der Möglichkeiten und Resonanzfähigkeit im Stadtteil. Außerdem war es den Teilnehmern so möglich, gegenseitig die jeweilige Projektidee im Austausch zu reflektieren.
Unter dem Titel „Stadt Fridingen: Miteinander – aktiv umsorgt“ streben die Stadt Fridingen und ihr zivilgesellschaftlicher Partner, der Nachbarschaftshilfeverein St. Elisabeth, einen umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess an, mit dem Ziel die Lebensqualität aller – besonders den älteren Generationen – vor Ort zu verbessern. Auf der Grundlage einer Bestandsanalyse der Lebens- und Wohnsituation der Bürger*innen sollen unter anderem die Begegnungs- und Selbsthilfeangebote gestärkt, die häusliche Situation des Wohnens bzw. die Weiterentwicklung von Wohnformen unterstützt und der Aufbau von Mobilitätsangeboten und die Einrichtungen einer Tagespflege gefördert werden.
Das Quartiersprojekt wird durch die Beteiligung der Bürger*innen, d.h. durch die Einbindung der älteren aber auch der jüngeren Mitbürger*innen, generationsübergreifend zu einem neuen und aktiven Miteinander und zu einem veränderten Verständnis eines umsorgten Gemeinwesen der Stadt Fridingen führen.
Anliegen- und Ideenportal des Landratsamtes Bodenseekreis und der Stadt Friedrichshafen
Entwicklung einer umfassenden Gesamtkonzeption für das Leben und Wohnen im Alter in unserer Stadt gemeinsam mit der Bürgerschaft und weiteren Sozialpartnern. Die Entwicklung besonderer Sozialformen zur niederschwelligen ehrenamtlichen wie professionellen Unterstützung älterer Mitbürger*innen mit zukunftsfähigen Betreuungs-, Pflege- und Wohnformen steht dabei im Fokus eines Bürgerbeteiligungsprozesses „Älter werden in Gammertingen“. Quartiersraum für diesen Beteiligungsprozess ist dabei das gesamte Stadtgebiet, Kernstadt und alle weiteren 5 Stadtteile.
Im Quartier Seebach/Katzenloch finden große strukturelle Veränderungen statt: Das
Kirchengebäude der evangelischen Kirche wird vermutlich aufgegeben, die
Helfensteinklinik wird geschlossen, über 60 neue Reihenhäuser entstehen, Investoren
wollen betreute Wohnungen für Ältere bauen, ein Hospiz wird entstehen und eine
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen soll verwirklicht werden. Seit Februar
2022 gibt es eine Notunterkunft für ca. 180 (v.a. ukrainische) Geflüchtete im Quartier.
Durch diese großen und zahlreichen Veränderungen entsteht bei den
Bewohner*innen des Quartiers große Verunsicherung. Das Projekt "'Gemeinsam
Leben im Quartier" soll die Akteur*innen im Quartier konstruktiv vernetzten, die
Ängste und Sorgen der Bewohner*innen aufgreifen und die Entwicklung einer neuen,
identitätsstiftenden Vision fürs Quartier mit Aktivierung des Engagements der
Bewohner*innen anstoßen. So können sich ein besseres Miteinander,
quartiersübergreifende Angebote, generationsübergreifende Treffmöglichkeiten,
barrierefreie Begegnungsräume, sowie gegenseitige Unterstützungsangebote und
niederschwellige Hilfeleistungen entwickeln.
Entwicklung einer Konzeption für Maßnahmen zur Implementierung eines Quartiersentwicklungsprozesses als Basis zur Umsetzung weiterer Projektideen in Geislingen an der Steige. Im Rahmen des MACH5-Prozesses hat sich Gesilingen auf den Weg gemacht, um ein nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept im Trialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zu erarbeiten. Der MACH5-Prozess soll im Rahmen dieses Projektes auf Quartiersebene heruntergebrochen werden. Beginnend mit der Oberen Stadt sollen die Bewohne*innen (v.a. auch beteiligungsferne Zielgruppen) frühzeitig in die Ideenfindung, Planung und Umsetzung von quartiersbezogenen Projekten im Rahmen von MACH5 eingebunden werden. Das hilft nicht nur dabei, die Projekte passgenauer zuzuschneiden, es erhöht auch die Akzeptanz der Projekte deutlich. Das Vorgehen und die Struktur der Quartiersentwicklung Obere Stadt können dann mit den entsprechenden Erfahrungen auf die anderen (noch zu definierenden) Quartiere in Geislingen übertragen werden.
Das Wohnen und Leben in dem Göppinger Stadtbezirk Ursenwang, Manzen und St. Gotthardt zeichnet sich dadurch aus, dass eine große Anzahl der Menschen bereits mit der Gründung des Stadtbezirks in den 1950er Jahren ein Zuhause gefunden haben. Entsprechend ist der Altersdurchschnitt - knapp 1/3 (31 %) der Bewohner des Stadtbezirks sind älter als 61 Jahre - der Anteil der Frauen liegt dabei höher als der der Männer. Zu der Überalterung kommt die hohe Zahl von Menschen mit Migrationsgeschichte. Das Quartier ist durch soziale wie infrastrukturelle Benachteiligung gekennzeichnet. Unter dem Fokus ein selbstbestimmtes Leben im Alter in der vertrauten Umgebung zu führen, ist angedacht neben den verschiedenen Akteuren vor Ort auch externen Anbietern die Möglichkeit zu eröffnen ihre Angebote zu implementieren, damit eine Verbesserung der Lebensqualität und die Teilhabe von älteren Menschen mit und ohne Pflegebedarf im Quartier möglich wird. Wir verfolgen dabei ein generationenübergreifendes Konzept.
Mit dem Quartiersprojekt "Gut Leben und Wohnen in der Göppinger Innenstadt"
beabsichtigt die Stadt Göppingen eine alters- und generationengerechte
Quartiersentwicklung anzustoßen, die Maßnahmen zur alters- und
generationengerechten Gestaltung des Lebensumfelds bzw. für Pflege und
Unterstützung im Alter beinhalten.
Im Mittelpunkt steht die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, gefördert
durch Beteiligung, Mitbestimmung und Gestaltung des Prozesses.
Die Beteiligungsformate haben unterschiedlich breite Ausrichtungen bspw.
Quartiersgespräche, Generationenworkshops, Zukunftswerkstätten o.ä. und
orientieren sich an einem ganzheitlichen Ansatz. Aspekte der Vielfalt im Quartier
finden im Projekt ebenfalls berücksichtig. Ebenso die Vernetzung von
bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten mit vorhandenen Stakeholdern.
Im Göppinger Ortsteil Faurndau konnten Bürger für die Räumlichkeiten des dortigen "Alten Farrenstalls" Ideen erarbeiten sowie Maßnahmen für ein gutes Zusammenleben entwickeln und vernetzen. Die Zielgruppen waren dabei Menschen unterschiedlicher Herkunft und Menschen verschiedener Generationen.
Eine Steuerungsgruppe aus, für das Thema und für den Prozess, notwendigen Akteuren unterstützte die Nachbarschaftsgespräche. Sie übernahm vor allem Aufgaben in den Bereichen Ergebnissichtung und -sicherung.
Im Rahmen eines Workshops mit Vereinen und Initiativen vor Ort konnte zunächst eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden. In zwei weiteren Nachbarschaftsgesprächen waren Bürger gefragt, um Ideen und Maßnahmen bezüglich eines generationenübergreifenden und interkulturellen Angebots zu diskutieren.
Um Personen zu erreichen, die sich weniger beteiligen, wurde die Methode der Zufallsauswahl eingesetzt. Hierbei wurde unter anderem nach Zuwanderungsgeschichte und Alter gewichtet. In diesem Zuge wurden 640 zufällig ausgewählte Faurndauer durch das Einwohnermeldeamt ausfindig gemacht und offiziell angeschrieben.
In den Göppinger Ortsteilen Ursenwang und Manzen entwickelten Bürger unterschiedlicher Herkunft und verschiedener Generationen neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements. Vorrangiges Ziel war es, die stetige Vernetzung der verschiedenen Akteure in den Ortsteilen sowie das nachbarschaftliche Miteinander zu stärken. Dies sollte über das Initiieren von generationenübergreifenden Projekten passieren. Auch war es der Stadt Göppingen ein Anliegen Willkommensräume im Quartier zu stärken.
Aufgrund der Corona-bedingten Situation wurde die ursprüngliche Planung, die auf Präsenz-Veranstaltungen aufbaute, über Bord geworfen. Für die weitere Planung traf sich zunächst eine Steuerungsgruppe, die über das Vorhaben informiert und um ihre Mitwirkung gebeten wurde. An dem Treffen wurden außerdem die Ziele für das weitere Vorgehen verabredet und erste Ideen für das Konzept zusammengetragen. Auf dieser Basis wurde beim nächsten Treffen das Konzept für die Nachbarschaftsgespräche sowie die Mitwirkung der Akteure besprochen und abgestimmt.
Das Konzept für die Nachbarschaftsgespräche sah eine sehr niederschwellige Form der Information und der Aktivierung in Form einer Postkarten-Aktion vor. Dafür wurde eine einfache Info- und Abfragepostkarte über die Mitglieder der Steuerungsgruppe verteilt. Es gab ein Set an zwölf Boxen zum Einsammeln der Karten in Ursenwang und in Manzen.
Nach der Postkartenumfrage wurde eine kurze Plauderrunde von ca. eineinhalb Stunden angeboten, um den Kontakt bis zu den weiteren Nachbarschaftsgesprächen nicht abreißen zu lassen. Nach einem Kennenlernen über ein digitales Speeddating konnten ein paar Einblicke in die Ergebnisse der Postkartenumfrage gegeben werden. Das Herzstück des Treffens war ein Kleingruppen-Austausch über die Frage: Welche Themen sind Ihnen für das nächste Nachbarschaftsgespräch wichtig?
Die weiteren zwei virtuelle Nachbarschaftsgespräche richteten sich an unterschiedliche Zielgruppen und hatten eine Dauer von etwa zwei Stunden. Das Ziel war es, darüber zu informieren, welche Mitgestaltungsmöglichkeiten anvisiert wurden und herauszuarbeiten, was den Teilnehmern für ein gutes Zusammenleben aktuell fehlt. Ebenso sollte herausgefunden werden, bei welchen Aktivitäten sich die Teilnehmer selbst gerne einbringen würden. Schließlich wurde gemeinsam darauf geschaut, wie die künftigen Umsetzungsschritte aussehen könnten.
Wie schon zum digitalen Plaudern richtete die lokale Schule auch bei den zwei weiteren virtuellen Nachbarschaftsgesprächen die Möglichkeit ein, dass Menschen ohne digitale Endgeräte entsprechend an den PCs der Schule teilnehmen konnten.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.
Das Projekt erarbeitet Erwartungen, Impulse, Lösungen und Maßnahmenempfehlungen für verschiedene Themenbereiche. Beispielsweise werden die Themenfelder Zusammenleben der Generationen Veränderung der Versorgungsstruktur weg von der Familie hin zur versorgenden Gemeinschaft;Nachbarschaft neu gedacht (Bereich Pflege, Begegnung, Tagesbetreuung, Infrastruktur, etc.); Pflege und Demenz – Neue Varianten des Wohnens; etc.; angesprochen und aufgearbeitet. Im Rahmen von offenen Bürgertischen werden unter externer Moderation Erfahrungen ausgetauscht, Bestehendes reflektiert und in kreativer, visionierender Weise Zukunftspläne und Maßnahmen entwickelt. Die Konzeptidee besteht darin, die durch einen öffentlichen Fragebogen ermittelten Themengebiete in zwei Bürgertischen à fünf Einzelveranstaltungen zu beleuchten und zusammen mit den Einwohner*innen der Gesamtstadt Hayingen Lösungsansätze zu erarbeiten und diese in einer Bürgerkonzeption zusammenzuführen.
Im Heidelberger Stadtteil Hasenleiser wurden die Themen „Integration“ und „aufsuchende Beteiligung“ im Rahmen des Förderprogramms auf vielfältige Weise an neuen und spannenden Orten umgesetzt.
Es konnten sich Menschen von Jung bis Alt in mehreren moderierten Nachbarschaftsdialogen in Rohrbach zu verschiedenen Themen von Religion über Migration bis hin zu ehrenamtlichem Engagement, Jugendpartizipation und weiteren Säulen des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Rohrbach-Hasenleiser austauschen. Um diesen Austausch zu ermöglichen, wurden bewusst niederschwellige und experimentelle Begegnungsorte und -formate gewählt: Zum Beispiel das Fastenbrechen in der mongolischen Quartiersjurte, ein Speeddating am Rohrbacher Marktplatz und ein Jugendworkshop mit Graffitikunst im Raumfänger des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Bei der Abschlussveranstaltung berichteten Teilnehmer von ihren Eindrücken der Veranstaltungen. Zudem diskutierten sie miteinander über die Bedeutung des nachbarschaftlichen Dialogs und zivilen Engagements für die Stärkung der demokratischen Gesellschaft.
Die Stadt Heidenheim hat die vernetzenden, aktivierenden und Strukturen schaffenden Ansätze von Stadtteilarbeit mit all ihren synergetischen und ressourcenorientierten Vorteilen bereits in verschiedenen Stadtteilen eingesetzt. Ein Stadtteil, der sich von den bisherigen deutlich unterscheidet, ist die Innenstadt. Mehrere innerstädtische Entwicklungen fallen zeitlich zusammen. Viele davon sind auf die Attraktivität der Innenstadt als Zentrum im Landkreis ausgerichtet. Stadtteilarbeit in der Innenstadt fokussiert im Ausgleich zur Sanierung und Förderung des Handels die Interessen der Anwohnerschaft. Wohngebäude sind räumlich über die gesamte Innenstadt verteilt. Die Entwicklung nachhaltiger Beteiligungsstrukturen stärkt die Identität der Bewohnerschaft und die Identifikation mit der Innenstadt als Wohnort. Die besondere Herausforderung liegt in der Zwitterfunktion der Innenstadt. Sie ist Arbeitsort mit großem Einzugsgebiet und Besuchermagnet.
Ehemalige Nachbarschaftsstrukturen sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ihre Neuentstehung muss unterstützt werden. Die hier lebenden Menschen benötigen Strukturen und Netzwerke, um ihre Belange zu formulieren.
Generationengerechtigkeit bedeutet in der Heidenheimer Oststadt, kulturell und religiös sehr heterogen, zwingend das Thema Integration mit zu denken. In allen Bevölkerungsgruppen sind alle Generationen gleichermaßen vertreten und nur gemeinsam können die Herausforderungen für Alter und Pflege gemeistert werden. Die Stadtteilarbeit in der Oststadt knüpft an die im Rahmen des städtebaulichen Sanierungsprojektes "Soziale Stadt" begonnene Arbeit an, sichert Nachhaltigkeit, greift erfolgreiche Ansätze auf, unterstützt, ergänzt, bündelt, koordiniert die Arbeit und sucht weitere Akteure und bezieht sie mit ein. Ziel ist es, Teilhabe zu fördern, der Segregation im Stadtteil entgegen zu treten und eine lebendige, gut funktionierende Nachbarschaft zu fördern, die Vielfalt und Unterschiede als Ressource begreift. Medium zur Umsetzung kann ein "Kulturbasar" sein, in dessen Rahmen die Stärken, die sich aus der Vielfalt ergeben, sichtbar werden und gegenseitige Unterstützung ermöglichen.
Unter dem Motto „Älter werden im Quartier“ führt die Stadt Heilbronn ein Pilotprojekt im Bereich Quartiersentwicklung durch: Ein ehemaliges Bahngelände Heilbronns, das Südbahnhofareal, bietet aufgrund seiner Neubebauung und sozialen Vielfalt ideale Möglichkeiten für die Erprobung einer intensiven, bedürfnisorientierten und attraktiven Quartiersentwicklung. Ziel ist es, den Menschen das Älterwerden im Quartier zu ermöglichen und über diverse Beteiligungsformen die Bedarfe der Quartiersbewohner zu erheben. Dies geschieht in Form einer Haushaltsbefragung mit Hilfe von interkulturellen Interviewern und mit eigens für die Nachbarschaftsgespräche entwickelten Moderationsformaten. Unter Einbindung der Quartiersakteure ist es der Stadt Heilbronn ein Anliegen, zum bürgerschaftlichem Engagement zu motivieren, Ideen zur Verbesserung des Miteinanders zu sammenln und anschließend Maßnahmen umzusetzen.

Im Heilbronner Stadtteil Böckingen mussten die Nachbarschaftsgespräche aufgrund der Corona-Pandemie neu gedacht werden: Über Spaziergang-Aktionen sollte es gelingen, im Vorfeld der Hauptaktionen mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. So wurden Fotospaziergänge unter dem Motto "Böckingen Bewegt" durchgeführt. Über Social Media der Stadt Heilbronn und des Quartierszentrums Böckingen, über städtische Zeitungen, über Flyer und Plakate wurden Einwohner eingeladen, mit einzelnen Vertretern aus dem Projektteam durch den Stadtteil spazieren zu gehen. Sie sollten dabei Gelegenheit haben, ihre Lieblingsplätze sowie ihre unbeliebten Plätze zu zeigen, sie zu fotografieren und etwas dazu zu berichten. Die Bilder aus den Spaziergängen wurden für das spätere Vorhaben eingesetzt - als sogenannte "Aufhänger".
Die weiteren Gespräche sollten in einer lockeren, vertrauensvollen Atmosphäre durchgeführt werden. Bei der Auswahl der Plätze, an denen Nachbarschaftsgespräche stattfinden sollten, wurde der Bezug zu den Fotospaziergängen und den dabei genannten Lieblingsplätzen hergestellt. Insgesamt wurden an sechs Orten Nachbarschaftsgespräche durchgeführt: An diesen Orten führten mehrsprachige Interviewer Befragungen mit zufällig vorbei laufenden Einwohnern durch. Die Aktionsplätze wurden mit Bildern und Plakaten aus den Fotospaziergängen gestaltet, die an mehreren faltbaren Infowürfeln angebracht wurden. Neben den Plakaten war ein großer Stadtplan von Böckingen an den Würfeln angebracht, der die Gespräche unterstützen sollte. Darüber hinaus wurden 14 Gartenzwerge aufgestellt, die Schilder mit verschiedenen Sprüchen in unterschiedlichen Sprachen in der Hand hielten. Die Zwerge und die Schilder sollten die Aufmerksamkeit von Passanten wecken und sie dazu bewegen, mit den Interviewern ins Gespräch zu kommen.
Im Anschluss wurden drei weitere digitale Gesprächsrunden mit Böckingern geplant und durchgeführt. Hierfür wurde zum Beispiel der "Internationale Tag der Muttersprache" und die "Internationale Antirassismus-Woche" als Anlass genommen.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.
Das Gelände und Gebäude des ehemaligen ZG-Raiffeisenmarktes in Herbolzheim-Wagenstadt wurde Ende 2018 aufgegeben. Neuer Eigentümer ist die Stadt Herbolzheim. Dort soll ein multifunktionales neues Dorfzentrum mit Dorftreff für den Ortsteil Wagenstadt sowie alle fünf Bleichtalgemeinden entstehen. Im Konzept ist auch ein Dorfcafé, evtl. auch als Bistro mit Mittagstisch vorgesehen. Ebenso soll die Nahversorgung gestärkt werden. Das Gelände weist Potential für eine vielfältige Nutzung auf, die vor allem für generationenübergreifende Wohnangebote im sozialen, kommunikativen sowie pflegerischen Bereich genutzt werden kann.
Bürgerinnen und Bürger in Herbolzheim sind sozial sehr engagiert. Gleichzeitig plagt
die Träger öffentlicher Unterstützungs- und Hilfsangebote der Fachkräfte- und
Ressourcenmangel. Hier kann die Zivilgesellschaft in Herbolzheim Entlastung schaffen.
Für eine notwendige Bündelung und Vernetzung des sozialen Engagements fehlt
allerdings der Ort. Beides soll der "Quartierstreff Alte Post" erreichen, indem er sich in
zwei Jahren als Begegnungs-, Kooperations- und Netzwerkraum entwickelt. Dadurch
wird er als Ort etabliert sowie bekannt gemacht und kann seine entlastende Wirkung
entfalten und zugleich das soziale Engagement fördern. Schließlich können
Obdachlosigkeit, Altersarmut und -einsamkeit sowie Benachteiligung von Familien und
Jugendlichen in Herbolzheim bekämpft und verhindert werden.
Das Quartier Kernstadt ist der "urbanste" Stadtteil Herrenbergs: 15.700 Menschen aller Generationen, mit vielfältigen kulturellen & sozialen Hintergründen, manche tief verwurzelt, andere eher lose mit der Stadt verbunden, leben auf engem Raum und doch recht anonym nebeneinander. Die Folgen des demografischen Wandels sowie teifgreifende bauliche Veränderungen stellen das Quartier bereits heute, erst recht in Zukunft, vor große Herausforderungen. Intensive Quartiersarbeit trägt dazu bei, dass aus dem Nebeneinander ein Miteinander wird, Menschen aktiviert und vernetzt werden und sich ein Wir-Gefühl entwickelt. Im Rahmen der "Quartiersimpulse" sollen die Erfahrungen aus dem Modellprojekt "Altstadt" auf den größeren Bereich der Kernstadt übertragen werden, mit besonderem Fokus auf a) stille gruppen aller Generationen sowie b) die Stärkung des Stadtseniorenrats als Partner und Experte für intergenerationelle Projekte.
Die Große Kreisstadt Herrenberg besteht aus der Kernstadt und den sieben Stadtteilen
Affstätt, Gültstein, Haslach, Kayh, Kuppingen, Mönchberg und Oberjesingen. Rund
16.000 Menschen aller Generationen leben in den sieben Stadtteilen. Diese sind
dörflich geprägt und weisen auch viele Unterschiede auf. Die Folgen des
Demographischen Wandels sowie tiefgreifende bauliche Veränderungen stellen diese
Quartiere bereits heute, erst recht in Zukunft, vor große Herausforderungen.
Insbesondere ältere und ökonomisch-sozial benachteiligte Menschen müssen mithilfe
lokaler Versorgungsstrukturen und intergenerationaler Unterstützungsnetzwerke
aufgefangen werden. Genau da setzt das geplante Projekt an. In enger
Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern (OV) der Stadtteile soll ein durch alle
Stadtteile wandernder Treff für Senior*innen entstehen, der einen Impuls setzt für die
Etablierung fester Begegnungsstrukturen. Dabei sollen sowohl jüngere als auch ältere
Senior*innen angesprochen werden, um die diversen Bedürfnisse und Fähigkeiten der
unterschiedlichen Lebensalter synergetisch zu nutzen. Es sollen nachhaltige
Strukturen vor Ort entwickelt werden, auf die die Zielgruppe stets zurückgreifen kann.
In Holzgerlingen wurden die Nachbarschaftsgespräche durch das kommunale Integrationsmanagement initiiert. Das Ziel dabei war es, vor allem den Austausch zwischen der etwa 200 vor Ort lebenden Geflüchteten mit den Einheimischen zu intensivieren. Gegenseitiges Kennenlernen und das Verstehen der unterschiedlichen Kulturen standen hier im Mittelpunkt. Für die Ansprache der unterschiedlichen Zielgruppen und für die Gesprächsdurchführung wurden vorab vielfältige Kooperationspartner wie die Kirche, Vereine und informelle Gruppen zur Unterstützung ausfindig gemacht.
Den Startpunkt der Gespräche bildete eine Umfrage, in der zunächst Ideen und Impulse für ein Miteinander in Holzgerlingen unter anderem auf dem Wochenmarkt erfragt wurden. Vor diesem Hintergrund starteten die sechs Gesprächsrunden jeweils unter einem anderen Motto. Dabei waren die Termine stets zielgruppenorientiert konzipiert. Für die Gesprächsrunden wurden beispielsweise Orte aufgesucht, die bereits als Treffpunkt vor Ort genutzt werden. Auch wurde aufgrund einer möglichen Befangenheit der Teilnehmenden darauf geachtet, dass Gespräche teilweise geschlechtergetrennt stattfanden. So zum Beispiel im Rahmen des wöchentlichen Stricktreffs in einem Wolleladen vor Ort. Damit konnte ein Raum für offene Gespräche in gewohnter Atmosphäre geschaffen werden.
"Gut leben und älter werden in Beiertheim und Bulach" stellt gute Pflege und Versorgung im vertrauten Umfeld des Stadtteils ins Zentrum eines zweijährigen Projekts zur sozialen Quartiersentwicklung. Darin werden neue Lebensformen im Alter, vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung und Aktivität in den Blick genommen. Aufbauend aus das große Engagement der Initiative von Bürgervereinen, Kirchengemeinden und Bürgerschaft im Stadtteil, die sich aus ihrer Perspektive ebenso wie die Kommune mit der Zukunftsfrage des demografischen Wandels auseinandersetzt, findet ein wissenschaftlich begleiteter Lern- und Entwicklungsprozess statt. Innovative und nachhaltige Lösungen werden möglich, wenn zivilgesellschaftliches und kommunales Engagement und professionelle Hilfeangebote zielgerichtet ineinandergreifen und geeigente Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Die Nachbarschaftsgespräche sind in die Anfangsphase eines umfangreichen Stadtteilentwicklungsprozesses für Oberreut eingebettet. Mit dem Instrument der "aufsuchenden Beteiligung" in Form einer aktivierenden Befragung wurde der Bürgerbeteiligungsprozess vor Ort eröffnet. Die Befragung fand an verschiedenen öffentlichen Plätzen und im Rahmen von bereits bestehenden Angeboten in Oberreut statt. Hierüber sollten Interessierte für die weiteren Nachbarschaftsgespräche gewonnen werden. Auch die gezielte Ansprache von Bürgern durch Schlüsselpersonen des Stadtteils wurde miteingeschlossen.
Die relevanten Themenfelder für die weiteren Gesprächsrunden konnten im Zuge eines Akteurs-Workshops zunächst ausfindig gemacht werden. Daraufhin diskuteirten in den weiteren vier Nachbarschaftsgesprächen unterschiedliche Interessengruppen zu Themen wie "Treffpunkte für Jugendliche", "Angebote für Kinder und Familien", "Vorzeigestadtteil - soziale Entwicklung - Bildung - Kulturangebot" sowie "generationenübergreifendes Miteinander - Begegnungsräume". In den entsprechenden Workshops wurden Bedarfe ermittelt, Themen identifiziert, Maßnahmenideen diskutiert und erste Projektskizzen für mögliche Bürgerprojekte entwickelt.
Im Zuge einer abschließenden öffentlichen Veranstaltung im Stadtteilforum Oberreut konnten diese Ergebnisse schließlich zusammengeführt und verdichtet werden.
Mit „Unser Jesingen — Unsere Entscheidung... für mehr Teilhabe und Begegnung" startet ein Quartiersprojekt gegen Einsamkeit und soziale Isolation in Jesingen, einem Teilort von Kirchheim unter Teck (ca. 43.000 Einwohner*innen). Studien belegen, dass sich seit der Corona-Zeit immer mehr Menschen einsam fühlen und doch ist es ein schambehaftetes und tabuisiertes Thema. Im Projekt werden Maßnahmen erprobt, um einsame Jesinger*innen zu finden und deren Bedürfnisse für verbesserte Teilhabemöglichkeiten zu identifizieren. Gemeinsam mit einer engagierten Jesinger Akteurslandschaft startet so ein nachhaltiger Entwicklungsprozess, deren Erkenntnisse und geschaffene Angebote einen Beitrag leisten, die Erfahrungen mit Einsamkeit zu reduzieren sowie das soziale Miteinander und intergenerative Zusammenleben zu stärken.
"Wir im Quartier - Klimawandel hier und dort" - unter diesem Motto wurden in Konstanz die Nachbarschaftsgespräche durchgeführt. Dabei sollten die Themen Bürgerbeteiligung im Klimaschutz und die Integration von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verknüpft werden.
Die Gespräche fanden im Stadtteil Wollmatingen in der Anschlussunterbringung für Geflüchtete statt. Der Prozess begann mit einer Auftaktveranstaltung, zu der Personen verschiedenster Hintergründe, wie etwa "Alteingesessene" und Menschen mit Migrationshintegrund eingeladen wurden. In dieser Veranstaltung wurden Fragen gestellt wie: Was ist Klimawandel? Welche Fragen beschäftigen Sie hier (in Konstanz) und dort (wo Sie herkommen)? Was braucht es für ein gutes Leben?
Im Anschluss wurden zwei vertiefte Nachbarschaftsgespräche in Form von Workshops und Open Space-Formaten durchgeführt. Beispielhafte Fragen waren: Was heißt Klimawandel für Sie in Ihrem Heimatland und hier vor Ort? An was denken Sie bei Klimaschutz? Was macht der Klimawandel mit unserer Stadt und Ihrer Region? Was braucht es, um über kulturelle Unterschiede hinweg zusammen dem Klimawandel zu begegnen? Diese Fragen wurden in Gruppen diskutiert und in Form einer Fotoausstellung beantwortet.
Die Ergebnisse der Gespräche wurden anhand einer Fotodokumentation festgehalten.
Zum Abschluss war eine Eröffnung der Fotoausstellung geplant. Die Ergebnisse der Gespräche sollten in diesem Rahmen Verantwortlichen der Stadt, wie etwa der Integrationsbeauftragten und interessierten Gemeinderäten vorgestellt werden. Coronabedingt konnte diese Veranstaltung nicht stattfinden. Stattdessen wurde die Fotoausstellung online gestellt und im Energiepavillon der Mainau für die Projektteilnehmenden zugänglich gemacht. Die Ausstellung wurde gleichzeitig mit der Veranstaltung "Energiesysteme im Wandel" fertiggestellt und während dieser Veranstaltung beworben.
"Generationen-TALK - nicht übereinander, sondern miteinander" lautete das Motto bei den Nachbarschaftsgesprächen in Kornwestheim. Zentral war der Gedanke Bewohner unterschiedlicher Bevölkerungsschichten, Generationen und Kulturen, Neu hinzugezogene und Alteingesessene, die Möglichkeit zu bieten, über eigene Geschichten zu berichten und sich über Erfahrungen auszutauschen.
Im Rahmen von vier GenerationenTALKs wurden jeweils ein Zeitzeuge oder Personen eingeladen, die aus einer persönlichen Perspektive zum jeweiligen Thema berichten konnten. An den Veranstaltungen selbst war die Oberbürgermeisterin vor Ort. Nach einem Interview wurde das Publikum entsprechend aufgefordert im Zuge der Fishbowl-Methode mitzudiskutieren. Die Themen der vier Gesprächsrunden waren:
1.) "Krieg, Flucht, Vertreibung" in und um Kornwestheim zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
2.) Aufbruch, Aufbau, Zukunft - Die Nachkriegszeit in Kornwestheim
3.) Demokratie, Bürgerrechte, Meinungsvielfalt - Die sechziger Jahre und die Folgen
4.) Gesellschaft im Wandel: Gegenwart und Zukunft gemeinsam gestalten
Bei der Auswahl der Veranstaltungsorte war es der Stadt Kornwestheim ein Anliegen, auch die Räumlichkeiten den jeweiligen Generationen entsprechend auszuwählen. Ebenfalls wurde auf ein ausgeglichenes Generationenverhältnis geachtet. So fanden die Gesprächsrunden in Kooperation mit dem Jugendzentrum Kornwestheim sowie dem Ortsseniorenrat Kornwestheim statt. Zu jedem GenerationenTALK wurden zudem zufällig ausgewählte Bürger eingeladen.
Bei dem Projekt "Wie wollen WIR unser Quartier erleben" sollen alle Generationen und Kulturen am Quartiersleben teilhaben können. Hierfür wird mittels drei unterschiedlicher Beteiligungsformate aufgezeigt, was die Menschen im Quartier bewegt und welche Themen ihnen auf dem Herzen liegen. Mithilfe der Beteiligung kann im Anschluss ein Handlungskonzept/Maßnahmenkatalog entwickelt werden, um Leimen weg von einer Schlafstätte hin zu einem lebendigen Ort zu gestalten. Leimen ist geprägt von Bewohner*innen vieler unterschiedlicher Nationen. Um mit ihnen in Dialog zu treten soll unter dem Motto "wie geht multi-kulti in Leimen" ein Markt der Kulturen veranstaltet werden. Es soll dabei helfen aufzuzeigen, wie man sich in der Nachbarschaft einbringen und wie mehr Verständnis füreinander aufgebracht werden kann. unter dem Motto "deine Stimme - deine Zukunft" soll Jugendlichen ein Gehör verschafft werden. Mittels einem Sportevent soll die Neugier für das Thema Beteiligung geweckt werden. unter dem Motto "gemeinsam sind wir stärker" soll, mithilfe einer Tandemwerkstatt zwischen Jung und Alt, der Mehrwert von generationsübergreifendem Zusammenleben diskutiert werden.
Die demografische Entwicklung und große Neubauprojekte im Zentrum sind die Initialzündung für eine bürgerorientierte, partizipative Quartiersentwicklung für einen lebendigen Sozialraum mit starkem bürgerschaftlichem Engagement im Quartier Leonberg Mitte-Nordwest. In Beteiligungsprozessen sollen Wünsche benannt und Bedarfe insbesondere der sozialen Architektur im Quartier transparent werden. Die Bewohner*innen übernehmen für von ihnen initiierte Projekte Verantwortung, unterstützt von Hauptamtlichen. Dafür entsteht ein Bürgertreff als Raum fürs Quartier. Der Projekt-Fokus liegt konsequent auf vorhandenen Themen und Ressourcen der Bewohner*innen mit dem Ziel, Selbsthilfe, Selbstorganisation und solidarisches Handeln auch im Sinne eines Seniorennetzwerks für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu fördern. Gelingende Nachbarschaften sind Bausteine für mehr Lebensqualität, für selbstbestimmtes Altern im Quartier und intergeneratives Miteinander. Institutionen im Quartier vernetzen sich als lernenden Einrichtungen.
Lörrach möchte gemeinsam mit der Bevölkerung und zivilgesellschaftlichen Akteuren die Zukunft der Stadt und ihrer Ortsteile weiterentwickeln. In einem ersten Stimmungsbild wurde für die Ortsteile Brombach und Hauingen angemerkt, dass Angebote und Treffpunkte für ältere Menschen fehlen - ebenso generationenübergreifende Angebote sowie alternative Wohnformen. Eine repräsentative Bürgerbefragung unter Senioren - vorbereitet durch "Gut Beraten!" - soll dazu im August Bedarfe und Vorstellungen sowie persönliches Engagement und Mitwirkung gezielt abfragen. Die Ergebnisse bilden die Ausgangsbasis des Projekts, in dessen Mittelpunkt die Entwicklung und Umsetzung quartiersbezogener Maßnahmen und Angebote sowie die nachhaltige Vernetzung zivilgesellschaftlicher Akteure steht.
Das Projekt entspricht dem Wunsch der Stadt, die im November 2019 mithilfe von Fördermitteln aus dem Sonderprogramm einen ersten gesamtstädtischen Beteiligungsprozess zum Thema "Gutes Älterwerden in Lörrach" in Gang gesetzt hat.
Das Projekt soll dazu beitragen, die Lebensqualität im Quartier zu verbessern. Mit dem Aufbau nachbarschaftlicher Strukturen und einer offenen Begegnungskultur werden Ängste abgebaut und dem Alleinsein mit seinen vielfältigen Problemen entgegengewirkt, Entlastung geboten. Dies wird durch aufeinander abgestimmte pflegerische Versorgungsstrukturen, einer Vernetzung zwischen Bürgern, professionellen Hilfen sowie durch ein wertschätzendes Lebensumfeld erreicht. Das Quartiersbüro ist ein Ort der Begegnung und Beratung. Dort wird auch älteren Menschen ein niederschwelliger Zugang zu den Vernetzungsangeboten des Nachbarnetzes mit seiner Onlineplattform www.nachbarnetz-lb.de ermöglicht. Um mit dem Projekt nachhaltig wertvolle Impulse zu schaffen, werden alle Generationen einbezogen und soll auf ihre spezifischen Vorstellungen, Möglichkeiten und Bedarfe eingegangen werden. In dem Projektzeitraum werden tragfähige Strukturen zur Weiterführung des Quartiersbüros geschaffen.
Im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen bilden die Nachbarschaftsgespräche wichtige Grundsteine zur Vorbereitung eines breiter angelegten Beteiligungsprozess zur Fortschreibung des dortigen Stadtteilentwicklungsplans.
Im Rahmen von vier Kochnachmittagen mit dem Titel „Kochlöffel-Dialoge“ diskutierten die Teilnehmenden gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung zu unterschiedlichen Themenfeldern: Gesundes Neckarweihingen, Junges Neckarweihingen, Familienfreundliches Neckarweihingen, Altersfreundliches Neckarweihingen.
Vor dem Ziel möglichst unterschiedliche Personengruppen mit den Kochlöffel-Dialogen zu erreichen, enstchied sich die Stadt Ludwigsburg für einen Mix aus Zufallsauswahl, öffentlicher Einladung sowie direkter Ansprache. Für die zielgruppengerechte Ansprache wurden neben digitalen und klassischen Medien auch Flyer-Verteil-Aktionen vor beispielsweise einem Supermarkt umgesetzt.
Auch die Veranstaltungsorte sollten für die Gespräche möglichst im Stadtteil bekannt und einfach erreichbar sein. So fand zum Beispiel der Kochlöffel-Dialog zum Thema "Familienfreundliches Neckarweihingen" im Kinder- und Familienzentrum statt.
Ein Gesundheitscafé im Stadtteil soll niederschwelligen Zugang zu Angeboten der
gesundheitlichen Versorgung ermöglichen und perspektivisch die Lebensqualität aller
Quartiersbewohner*innen verbessern. Ein offener Cafétreff steht allen Menschen des
Stadtteils für gemeinsame, lockere Treffen zum Austauschen und Kennenlernen zur
Verfügung.
Das Gesundheitscafé bietet Unterstützung in folgenden Bereichen:
- Informationen über die Versorgungslandschaft
- Lotsenfunktion im Bereich der gesundheitlichen und sozialen Versorgung
- Angebote der Gesundheitsbildung, Prävention und Gesundheitsförderung für den
Stadtteil
- Beratungsangebote anderer Akteur*innen und Versorger *innen
- Gesundheitskompetenz im Stadtteil erhöhen
- Netzwerkarbeit im Stadtteil und mit Versorger *innen stadtweit
Mit dem Mannheimer Modell werden im "ältesten" Stadtteil Mannheims quartiersnahe integrierte Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen auf- und ausgebaut. Kernelement ist der dort ansässige und perspektivisch an zentraler Stelle im Stadtteil verortete, baulich ertüchtigte SeniorenTreff (Angebot der offenen Altenhilfe) unter professioneller Leitung. Weitere Bausteine sind die Errichtung eines zusätzlichen lokalen Pflegestützpunktes, das Wohnen mit Versorgungssicherheit, die mobile Sachbearbeitung mit aufsuchender Hilfe sowie die Stärkung des ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen Engagements von und für ältere Bürger*innen. Im Förderprojekt "Quartiersimpulse: Modellprojekt Vogelstang" werden die einzelnen Bausteine sinnhaft verknüpft. Damit eine nachhaltige Implementation sichergestellt werden kann, wird eine ständige Prozessbegleitung und Qualitätssicherung benötigt. Das Förderprogramm bietet die Chance, eine (zunächst befristete) Projektkoordination und wissenschaftliche Begleitung einzusetzen und unter Einbezug des Seniorenrats Mannheim e.V. als Projektpartner die Prozessbegleitung, Vernetzung und nachhaltige Implementation der Bausteine sicherzustellen.
Die Vision, eine Begegnungsstätte im Herzen Marbachs zu schaffen, die Generationen
verbindet und das soziale Miteinander stärkt, wird schon seit längerem verfolgt.
Diese soll allen Bürger*innen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Bildungsstand,
Alter, Einkommen und Gesundheitsstatus offenstehen. Vor ein paar Wochen ist in der
Fußgängerzone eine Ladenfläche freigeworden, die als Begegnungszentrum ideal
wäre. Das Ziel ist es, das Zusammenleben speziell vor dem Hintergrund der älter
werdenden Bevölkerung zu bereichern und Isolation vorzubeugen. Mit dem geplanten
Projekt "Treffpunkt Mitte" sollen Bürger*innen in der ganzen Breite eingeladen werden,
aktiv am Ausgestaltungsprozess teilzunehmen und sich an der Umsetzung zu
beteiligen. Ein Verein befindet sich aktuell in Gründung, um das Vorhaben zu
unterstützen und auch nach dem Förderzeitraum den Weiterbestand der
Begegnungsstätte zu gewährleisten. Im Fokus stehen vielfältige, niederschwellige
Angebote, die für zahlreiche Impulse der Vernetzung sorgen und eine Teilhabe aller
ermöglichen. Bürgerengagement und -beteiligung können mit den Quartiersimpulsen
so nachhaltig verankert werden. Der Wunsch ist ein Ort der "offenen Tür" für alle.
Vier Teilgemeinden von Mengen sowie die Stadt Scheer mit ihrer Teilgemeinde Heudorf knüpfen an die Quartiersentwicklung im Mengener Teilort Blochingen an. In engem Zusammenwirken von Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft werden die Impulse aus Blochingen auf ihre Übertragbarkeit hin überprüft und auf die Bedarfe des jeweiligen Quartiers angepasst. Pro Quartier entstehen eigene Begegnungstreffs. die am Ende zu einem interkommunalen Mehrgenerationenhaus zusammengefasst werden. Auf diese Weise werden für jedes Quartier passgenaue Lösungen entwickelt. Langfristiges Ziel ist die Anstellung einer interkommunal beauftragten MGH-Koordination, die die unterschiedlichen Quartiere fachlich unterstützt und miteinander vernetzt.
Gute Beteiligung lebt von der Bereitschaft zum Dialog. Sie beachtet die Themen aller
Akteur*innen. Dafür steht das Quartiersprojekt Beteiligungswerkstatt Kernstadt
Mengen. Es entsteht eine offene Beratungs- und Begegnungsstätte. Einzelpersonen,
Gruppen, Initiativen, Vereine, Schulen und andere Institutionen sowie alle
Wirtschaftsbetriebe finden in diesem Begegnungszentrum kompetente
Ansprechpartner*innen zu sozialen Fragen. Um allen Akteur*innen die Möglichkeit zu geben,
sich ihren Bedarfen entsprechend aktiv in die Gestaltung ihres Quartiers einzubringen,
entsteht ein Beteiligungsrat, unter dessen Dach alle Generationen und Gruppen ihre
Bedarfe formulieren und zur Diskussion mit Verwaltung und Politik vorbereiten
können. Über die Begegnung und den Austausch entstehen sorgende Gemeinschaften.
Die Bürger*innen von Blochingen haben in einer Umfrage im Jahr 2016 großen Bedarf an Begegnungsmöglichkeiten und sozialem Kontakt signalisiert. Deshalb soll in Zusammenarbeit von Gemeinde, Bürgerverein "Alt werden in Blochingen" und den Bürger*innen das Konzept für ein Begegnungszentrum erarbeitet werden, in dem sich alle willkommen fühlen und im Bedarfsfall auch Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen können. Hierzu wird eine enge Vernetzung mit Akteuren wie z.B. Sozialstattion, Nachbarschaftshilfe, Kindertagesstätte, Landratsamt, Vereinen, Gewerbetreibenden usw. angestrebt. Gleichzeitig sollen die Bürger*innen einen Raum vielfältiges, ehrenamtliches Engagement erhalten. Am Ende wird ein lebendiges und konstruktives Miteinander die Basis für eine unterstützende Dorfgemeinschaft bieten, die tragfähige und nachhaltige Lösungen zur Gestaltung des demografischen Wandels entwickelt.
Mit den "Mengener Nachbarschaftsgesprächen" sollte zur Stärkung der Gemeinschaft in allen Ortsteilen sowie zu einer Vernetzung aller Ortsteile beigetragen werden. Die Gespräche sollten in allen Teilgemeinden angeboten werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Nachbarschaftsgespräche nicht in analoger Form stattfinden. Auch der Aufbau der Steuerungsgruppe konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Vorgehen wurde angepasst und es wurden in intensiver Abstimmung mit den Ortsverwaltungen neue, kreative und für den jeweiligen Teilort passende Lösungen entwickelt.
In Beuren, Rosna und Rulfingen fanden digitale Nachbarschaftsgespräche statt. Das Catering erfolgte über direkte Verteilung an die angemeldeten Haushalte zu Beginn der Veranstaltung. Im Vorfeld dieser Gespräche wurden kleine Steuerungsgruppen gebildet, die sich jedoch analog zur ursprünglichen Planung so bald als möglich vergrößern sollen.
Der Ortsteil Blochingen hat auch während des Lockdowns intensiv an seiner Quartiersentwicklung weitergearbeitet, so dass in Abstimmung mit der Ortsverwaltung das für Blochingen geplante Nachbarschaftsgespräch im benachbarten Stadtteil Walke angeboten wurde. Die Walke besteht aus zwei Straßenzügen mit ca. 50 Haushalten, verteilt auf Einfamilienhäuser und vier Wohnblöcke. Der durch das Gespräch deutlich werdende Bedarf in diesem Stadtteil hat dazu geführt, dass dieser Stadtteil in der Quartiersentwicklungsstrategie einen eigenen Platz erhalten wird.
Im Ortsteil Ennetach besteht schon lange die sogenannte "Dorfgemeinschaft" - ein Verbund fast aller Vereine und Institutionen. Da diese aufgrund der Corona Verordnungen nicht tagen durfte, wurde hier in einer Ortschaftsratssitzung alle Vorbereitungen für ein Treffen getroffen und auch Akteure, die in diesem Kreis bisher fehlen, eruiert.
Fachstelle Bürgerengagement
Betreuung ehrenamtlicher, Gruppen, Initiativen und Vereine
Runde Tische und Bürgerdialoge
Ehrenamtsakademie
Quartiersentwicklung
Familienzentrum
Das Quartier Waldstadt ist ein in sich geschlossenes Wohngebiet. Es fehlen für die
Bewohner*innen Räume und Angebote für Begegnung, Austausch und
Freizeitgestaltung. Zu Bestandsgebäuden wurde keine Lösung gefunden. Der
erforderliche Neubau der Turnhalle Waldstadt soll genutzt werden, um im Rahmen
der begrenzt zur Verfügung stehenden Fläche ein Waldstadtzentrum zu entwickeln,
das flexible Nutzungsmöglichkeiten für örtliche Vereine, ehrenamtlich Engagierte und
die offene Jugendarbeit bietet. Ziel des Projekts ist es, alle Bürger*innen des Quartiers
zu beteiligen, insbesondere bislang nicht aktive Einwohner*innen. Das Wohngebiet
steht vor einem Generationenwechsel. Ältere Einwohner*innen benötigen
Unterstützung und Angebote vor Ort, um möglichst lange hier wohnen bleiben zu
können. Neue Einwohner*innen sollen durch die Möglichkeit, sich bei der Entwicklung
eines neues Quartierszentrums zu beteiligen, integriert und die Identifikation mit dem
Quartier ermöglicht bzw. gestärkt werden. Der bald fertiggestellte Integrationsplan
soll berücksichtigt werden.
Die Satdt Mössingen sieht in der Quartiersentwicklung des Nachbarschaftshilfe-Netzwerks eine gute Möglichkeit, den Anforderungen des demografischen Wandels aktiv zu begegnen. Mit dem Aufbau eines losen Dachverbunds der Nachbarschaftshilfe wird, unter Beteiligung von Stadt, Bürgern, Fachkräften und Initiativen ein Netzwerk aufgebaut. Dieses stellt den Menschen in den Mittelpunkt - mit seinen Potentialen gleichermaßen, wie mit seinem Unterstützungsbedarf. Der Teilort Öschingen dient dabei als Modell, wie mit einem breiten Bürgerbeteiligungsprozess, aus dem Ort heraus, nachbarschaftliche Hilfen im Bereich der häuslichen Versorgung und Betreuung aufgebaut werden können. Ein Konzept zum Thema "Wohnen im Alter" mit der dazu benötigten Infrastruktur wird schwerpunktmäßig erarbeitet und in die Umsetzung gebracht. Die gemeinsam herausgearbeiteten Rahmenbedingungen können auf andere Verbundspartner des Nachbarschaftshilfe-Netzwerks Mössingen übertragen werden.
Die Stadt Neresheim ist eine Flächengemeinde mit 8.000 Einwohner*innen und liegt im Ostalbkreis. Merkmal und gleichermaßen Herausforderung ist die Verteilung der Bürger*innen in den Teilorten der Stadt. 2.400 Neresheimer*innen sind über 60 Jahre alt - Tendenz zunehmend.
Das Projekt zielt darauf ab, die Lebensqualität für Menschen ab 60 zu steigern und der Vereinsamung präventiv zu begegnen. Im Kern steht der Aufbau eines integrativen Netzwerks, das Bewohner*innen, lokale Organisationen und die Stadtverwaltung vereint, um Neresheim als lebendige Gemeinschaft zu stärken. Durch gezielte Maßnahmen wie Sozialrezepte, Beratungsangebote und kulturelle Treffpunkte in allen Teilorten, angereichert mit individuellen Alleinstellungsmerkmalen, wird die gesellschaftliche Teilhabe und Aktivierung gefördert. Das Projekt schafft nicht nur Präventionsstrukturen gegen Einsamkeit, sondern aktiviert Ressourcen und Talente aller Generationen, um Neresheim zukunftsorientiert und lebenswert zu gestalten.
Es geht aber vor alle darum, ein Netzwerk aufzubauen, das Synergien erzeugt.
Der Nürtinger Stadtteil Braike ist ein Quartier mit einer hohen Dynamik. Dies stellt das Zusammenleben als Quartiersgemeinschaft vor große Herausforderungen, bietet aber gleichzeitig ein hohes Potential für ein vielfältiges, interkulturelles und interreligiöses Miteinander. Mit dem Ziel, Menschen aus dem Quartier zu erreichen und mit ihren Anliegen, Wünschen und Ideen zum Zusammenleben in der Braike zu Wort kommen zu lassen, starteten die Nachbarschaftsgespräche vor Ort.
Zunächst wurde eine Begleitgruppe für die Projektumsetzung aus etwa 12-15 Personen gegründet. Sie setzte sich aus Vertretern der Kirchengemeinde, der Grundschule, des Jugendgemeinderats, der Stadtseniorenvertretung, der Flüchlingsarbeit, der lokalen Vereine sowie Mitwirkender aus dem Integrations- und Inklusionskonzepts zusammen.
Um möglichst eine breite Bevölkerung vor Ort zu erreichen, wurden Aktionen an Orten geplant, an denen sich Menschen in ihrem Alltag aufhalten. So zum Beispiel ein Spielplatz, ein Einkaufszentrum sowie der Schulhof. Die hierbei aufkommenden Ideen wurden auf einer begleitenden, moderierten Online-Plattform dokumentiert. Auch konnten die Ideen und Anliegen direkt auf eine Pinnwand auf der Online-Plattform notiert werden.
Daran anschließend wurden Workshops durchgeführt. Um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bewohner zu generieren, wurden neben wichtigen Interessenvertretern Bürger per Zufallsauswahl zu ein bis zwei Workshopgesprächen eingeladen werden. Ziel war es dabei, die bis dato eingegangenen Ideen und Anliegen zu sichten, zu bündeln und konkrete Projektideen zu entwickeln. Ebenfalls waren Mitglieder aus der Verwaltung sowie des Gemeinderats bei den digital durchgeführten Workshops anwesend.
Seit 2005 unterstützt die ländlich gelegene Stadt Oberkirch das Seniorennetzwerk "Von Mensch zu Mensch" als zivilgesellschaftliche Organisation. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Netzwerkes bieten konstant Angebote für Senioren vor Ort in Oberkirch an. Die Anzahl älterer Menschen wird in den nächsten Jahren stetig steigen und somit macht der demografische Wandel auch vor Oberkirch nicht Halt. Oberkirch möchte eine zukunftsfähige und attraktive Stadt für alle Generationen sein. Hierbei gilt es jetzt schon, die Weichen für eine immer mehr "altersfreundliche" Kommune zu stellen. Gerade auch in den Ortschaften gibt es zum Teil keine Versorgungsmöglichkeiten mehr. Genau hier gilt es, Bedarfe mit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern festzustellen, um "frühzeitig" Strukturen zu entwickeln, sodass ein alters- und generationengerechtes Leben in Oberkirch auch in Zukunft möglich ist. Dies kann nur in einem gemeinsamen Prozess und mit allen Beteiligten und vor allem mit den in Oberkirch lebenden Menschen geschehen. Durch ein gemeinsam erarbeitetes Handlungskonzept können weitere Unterstützungsangebote, lebendigere Quartiere und Nachbarschaften entstehen.
Mit den Nachbarschaftsgesprächen in Oberndorf am Neckar sollte vorwiegend ein Grundgerüst für das Mehrgenerationenhaus Linde 13 erarbeitet werden. Hierfür wurde das Projekt auf dem Wochenmarkt vorgestellt sowie zufällig ausgewählte Personen angesprochen, um auf das Projekt an sich aufmerksam zu machen. Im Katholischen Gemeindehaus vor Ort fanden acht Kochrunden statt, an denen zwischen sechs bis zehn Teilnehmende anwesend waren. An den Terminen wurde anhand von Leitfragen über das soziale Zusammenleben und über die Stadtentwicklung mit einem Schwerpunkt auf das Mehrgenerationenhaus Linde 13 diskutiert. An den Terminen wurden unterschiedliche Eintöpfe mit Blick auf unterschiedliche Nationalitäten gekocht. Auch der Bürgermeister war an ein paar Terminen mit am Tisch und konnte den Anwesenden auf drängende Fragen direkt antworten. Die Vielzahl an Ideen, die in diesem Kontext entstanden sind, wie beispielsweise intergenerative Angebote in der Linde 13 sowie praktische Ideen wie ein „offenes Wohnzimmer“ wurden anschließend im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats öffentlich vorgestellt. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern des Projekts, den Teilnehmenden der Kochrunden sowie der interessierten Öffentlichkeit wurden die Nachbarschaftsgespräche im neuen Generationenhaus Linde 13 beendet.
Soziales Netzwerk, solidarisches Miteinander, stabile Nachbarschaften, Begegnungsräume, wohnortnahe Beratung und Begleitung, Bürgerbeteiligung - für die Entwicklung stabiler nachbarschaftlicher Netzwerke im Neubauquartier Mühlbachareal, zur Gestaltung von Prozessen, die das soziale Miteinander und bürgerschaftliches Engagement unterstützen und begleiten, sind innovative Impulse und Ideen nötig. Das erfordert die frühzeitige Einbindung von Bewohnern und Nutzern. Verbindliche Formen der Zusammenarbeit sichern Transparenz und Kontinuität - und das von Anfang an. Im Mühlbachareal sollen innovative Ideen "von unten" im Mittelpunkt stehen und umgesetzt werden. So entstehen Dialoge, Denkanstöße, Diskussionsgrundlagen, neue Ideen und Verbindungen.
Das Projekt "Gesundheitsförderung in einer Caring Community" zielt auf die
Entwicklung einer Sorgenden Gemeinschaft im Offenburger Quartier "In der Wann".
Im Zentrum stehen gesundheitsfördernde Maßnahmen für die ältere Bevölkerung, die
Initiierung von gemeinschaftlichen Wohnformen, der Ausbau und die Pflege von
Nachbarschaftshilfe sowie die Implementierung eines Senioren-Mittagstischs im
Stadtteil- und Familienzentrum Oststadt in enger Abstimmung mit den dort lebenden
Menschen. Um die weiteren Bedarfe der Bewohner*innen im Quartier zu
identifizieren und darauf adäquat reagieren zu können, soll auch eine bürgernahe,
aufsuchende Gemeinwesenarbeit etabliert werden. Die enge Zusammenarbeit mit
Netzwerkpartner*innen im Stadtteil (aktive Bürger* innen, Vereine,
Kirchengemeinden, Pflegeeinrichtungen) sowie mit dem Studierendenwerk,
Akteur* innen aus dem Gesundheitswesen und der Verwaltung soll den Aufbau und
die Etablierung einer Caring Community mit den Bürger* innen im Quartier
unterstützen.
Aktivierung, Generationengerechtigkeit und Integration sind Stichworte für die Entwicklung des neuen Quartiers Seidenfaden in der Offenburger Oststadt. An erster Stelle des Projekts "Seidenfaden - Miteinander verwoben und vernetzt" steht die Einbeziehung und Aktivierung der Bewohner dieses Stadtviertels. Dabei sollen die Themen und Ideen der Bewohner im Mittelpunkt stehen. Ebenso wichtig sind Beteiligungsstrukturen, die mit den Beteiligten entwickelt werden und Ihnen entsprechen. Darüber hinaus ist die Einbeziehung weiterer Akteure wie Vereine, Kirchengemeinden, Gewerbe, öffentliche Verwaltung und die Träger sozialer Einrichtungen für die gute Entwicklung des neu entstandenen Quartiers Seidenfaden zielführend.
"Zum Glück Albersbösch" - mit diesem Titel startet ein neues Projekt im Stadtteil.
Wichtigstes Ziel ist es, dass sich die Bewohner*innen für und in Albersbösch nach ihren Interessen und Möglichkeiten nachhaltig aktiv einbringen und teilhaben können.
Der Wunsch nach einer Interessenvertretung für den Stadtteil wurde von Bewohner*innen formuliert. Daher ist es Ziel des Projektes, diese soweit möglich gemeinsam auf den Weg zu bringen. Die Gruppe soll auch befähigt werden, von Menschen benannte Themen aufgreifen zu können. Alle Aktionen hierzu sollen von Anfang an generationengerecht und für alle chancengerecht sein. Da viele Familien mit Kindern, viele ältere und alte Menschen, sowie Menschen verschiedener Herkunft im Stadtteil leben, kommt diesen Gruppen eine besondere Bedeutung zu. Wir setzen auf eine möglichst barrierefreie Ausrichtung der Zugänge, Ansätze und Methoden. Es bedarf dafür Know-How, Ideen, Reflexion, verschiedene Zugangsformen und damit auch besondere Ressourcen. Mit den Quartiersimpulsen kann es gelingen, dass Menschen jeden Alters und verschiedener Herkunft teilhaben und sich für und in ihrem Heimatstadtteil aktiv einbringen.
In den beiden Stadtteilen Kemnat und in der Parksiedlung von Ostfildern wurden Nachbarschaftsgespräche unter dem Titel „Heimatgespräche“ mit Unterstützung des Freundeskreis Asyl Ostfildern durchgeführt. In einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung wurde der Öffentlichkeit das Konzept der Heimatgespräche vorgestellt. Daran anschließend fanden in den beiden Stadtteilen je drei Kochnachmittage mit einem durchmischten Teilnehmerkreis statt. Dieser setzte sich aus fünf Personen, die durch Multiplikatoren ausfindig gemacht wurden sowie aus zusätzlichen 15 zufällig ausgewählten Personen zusammen. Mit dieser durchmischten Gruppe wurde im Rahmen von 3 Stunden beim gemeinsamen Kochen eine Diskussion über das Thema „Heimat finden – die Rolle der Nachbarschaft“ geführt. Daran anschließend wurden die Ergebnisse der beiden Stadtteile in einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung dem Oberbürgermeister, der Verwaltung, den Gemeinderäten sowie den involvierten Multiplikatoren wie u.a. der Kirchen vorgestellt. Das Ziel an der Abschlussveranstaltung war es, eine Zwischenbilanz zum Thema „Integration“ zu ziehen.
Die Quartiersentwicklung Nellingen "Gutes Älterwerden in Nellingen - Wir gestalten unsere Zukunft" startete im September 2018 mit vier themenorientierten Bürgertischen an denen sich ca. 100 Bürger*innen beteiligten. Mit dem Projekt "Erarbeitung einer Konzeption zu Aufbau und Betrieb einer bürgergestützten, selbtsverantworteten ambulant betreuten Wohngemeinschaft" in Nellingen sowie mit der Initiierung eines "Zeitbank-Projektes" werden in einem ersten Schritt zwei bürgergestützte Projekte, die von Bürger*innen in den Bürgertischen favorisiert wurden, aufgebaut und umgesetzt.
Der Bürgerbeteiligungs-Prozess „Wir in der Parksiedlung (WiPs) besteht seit 2016 und wurde 2017 im Rahmen des Wettbewerbs „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gesatlten“ prämiert. Es wurden inzwischen eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, u.a. wurde der Prozess strukturiert. Nun soll der Bürgerbeteiligungs-Prozess ein Quartiersbüro an einem prominenten Platz im Stadtteil erhalten. Die räumliche Präsenz, in Verbindung mit weiteren Maßnahmen, soll anregen, sich an dem Prozess zu beteiligen. Die Quartiersentwicklung soll so auf eine breitere und nachhaltige Basis gestellt werden, wozu auch eine sozialpädagogische Fachkraft als Quartiersmanagerin eingesetzt wird. In den Räumlichkeiten sollen zudem die Angebote für ältere Menschen im Stadtteil verbessert werden sowie deren Teilhabe am Bürgerbeteiligungsprozess ermöglicht werden.
Zu Beginn der Nachbarschaftsgespräche wurde eine gemeinsame Begleitgruppe für die Stadtteile Dillweißenstein und Nordstadt eingerichtet. Diese bestand aus Akteuren der Verwaltung, Kooperations- und Netzwerkpartnern sowie aus einem Teilnehmer der Pilotgespräche aus 2017. Die Begleitgruppe wurde von einem externen Moderationsbüro unterstützt und traf sich drei Mal: vor der Auftaktveranstaltung, während der Vor-Ort-Gespräche und vor der Abschlussveranstaltung. Ihre Aufgabe war es den Gesamtprozess zu begleiten.
Vor der ersten Begleitgruppensitzung fand eine Auswahl von Zufallsbürgern statt. Hierzu wurden in der ersten Runde 200 Bürger zufällig aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt und mit einem Schreiben des Oberbürgermeisters zur Teilnahme an den Nachbarschaftsgesprächen eingeladen. Der Rücklauf in Dillweißenstein erfolgte sehr schnell und zeigte großes Interesse. Innerhalb kürzester Zeit erklärten sich 16 "Zufallsbürger" und vier im Stadtteil bereits Engagierte zur Teilnahme bereit. Die zuvor festegelegte maximale Gruppengröße wurde so erreicht.
Mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung der Stadtteile Nordstadt und Dillweißenstein starteten die Gesprächsrunden. In der Auftaktveranstaltung wurde das Pilotprojekt im Rahmen eines Interviews mit Teilnehmern des Pilots aus 2017 reflektiert. Exemplarisch wurden einzelne Ergebnisse aufgezeigt sowie der Ablauf der Nachbarschaftsgespräche vorgestellt. Im Anschluss fanden sich die Teilnehmer in ihren Stadtteilgruppen zusammen, lernten sich kennen und sammelten bereits erste Themen.
Aus der Erfahrung mit den Nachbarschaftsgesprächen entschied sich die Stadt Pforzheim für ein Projektbudget in Höhe von 3.000 Euro für die Umsetzung von im Rahmen der Gespräche erarbeiteten Projekten. Je Stadtteil wurde ein solches von der Stadt Pforzheim eingeplant.
Im ersten Dillweißenstein-Gespräch fand eine Fortführung der Themensammlung aus der Auftaktveranstaltung satt. Die Teilnehmer brachten weitere Ideen ein und ergänzten die Themensammlung. Im Laufe der Diskussion entstanden bereits erste Projektideen. Zudem hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, anwesende Verwaltungsvertreter zu verschiedenen Themen direkt zu befragen.
Im zweiten Gespräch kam die Themensammlung zum Abschluss. Durch die Bepunktung der Themen durch die Teilnehmer konnte die Gruppe gemeinsam einschätzen, welches die
wichtigsten Aspekte für den Stadtteil sind. Das so entstandene Meinungsbild diente als Grundlage für die Auswahl der Projektideen.
Diese Projektideen wurden in einer dritten Gesprächsrunde weiter bearbeitet. Es wurden Maßnahmen für die Projektideen entwickelt und entsprechend detaillierter bearbeitet. Hierzu wurden Kleingruppen von je zwei bis vier Teilnehmern gebildet. Es wurden sechs Projekte ausgearbeitet.
Nach den Gesprächen vor Ort fand eine gemeinsame Abschlussveranstaltung für beide Stadtteile statt. Es nahmen zahlreiche Amtsleitungen, Verwaltungsvertreter sowie (Ober-)bürgermeister teil. Nach einem kurzen Rückblick auf die gesammelten Themen in den Stadtteilen, wurden die ausgearbeiteten Projekte diskutiert. Die anwesenden Verwaltungsvertreter gaben hierzu eine Einschätzung zur Realisierbarkeit, Zeitplan, Kosten und den notwendigen Ämtern, die zur Umsetzung notwendig sind. Nach der Diskussion wählte die Stadtteilgruppe ihre Projekte für die Weiterarbeit aus.
Im Pforzheimer Stadtteil Au wurden zu Beginn des Projekts 500 Bürger zufällig aus dem Einwohnermederegister ausgewählt und mit einem Schreiben des Oberbürgermeisters zur Teilnahme an den Nachbarschaftsgesprächen eingeladen. In Kooperation mit den Integrationsmanagern wurde das Einladungsschreiben der bereits durchgeführten Nachbarschaftsgesprächsprojekte der zwei weiteren Stadtteile - Dillweißenstein und Pforzheim Nord - überarbeitet, stark vereinfacht und in leichte Sprache übersetzt. Zudem wurden mit Unterstützung des Familienzentrums Au und des Internationalen Beirats der Stadt Pforzheim auch nochmals Menschen persönlich angesprochen. Die zuvor festgelegte Gruppengröße von maximal 25 Zufallsbürger wurde in der Folge zunächst überschritten. Tatsächlich von Anfang bis Ende der Gespräche blieb eine Gruppengröße von etwa 15 Zufallsbürgern bestehen.
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung im Familienzentrum Au wurden die bisher stattgefundenen Nachbarschaftsgespräche reflektiert und exemplarisch Ergebnisse vorgestellt. Dann wurde der Ablauf der Gespräche in der Au vorgestellt. Im Anschluss konnten sich die Teilnehmer kennenlernen und sammelten erste Themen. Aufgrund eventueller Sprachbarrieren wurden hierfür kleinere Murmelrunden als Format gewählt. Nach der Auftaktveranstaltung fanden drei moderierte Veranstaltungen in der Au statt - wechselweise im Familienzentrum Au und im Quartierszentrum Innenstadt. Hier wurden die teilnehmenden Bürger von Netzwerkpartnern unterstützt und es kamen Vertreter von Politik und Verwaltung vor Ort, um ihnen zuzuhören, Themen aufzunehmen und Fragen zu beantworten. Beide Einrichtungen sind zentral und gut bekannt.
Im ersten Gespräch fand eine Fortführung der Themensammlung aus der Auftaktveranstaltung statt. Im zweiten Gespräch fand ein Austausch mit der Bürgermeisterin statt. Nachdem das QuarZ Innenstadt sein Angebot vorgestellt hatte, konnten die Bürger weiter an den erarbeiteten Ideen in Projektgruppen mit Hilfe von Projektblättern weiterarbeiten. Im dritten Nachbarschaftsgespräch richtete sich der Fokus auf den Rückblick bisher zusammengetragener Themen und Projektideen sowie auf die Rückmeldung hierzu aus der Verwaltung. Schließlich fand eine Abschlussveranstaltung mit Amtsleitungen, Vertretern der Verwaltung sowie dem Sozialbürgermeister statt. Unter anderem konnten hier offene Punkte zum weiteren Vorgehen besprochen werden.
Die Ergebnisse wurden aufgrund der Corona-bedingten Situation in Form eines Videofilms von teilnehmenden Bürgern im Gemeinderat vorgestellt. Eine Dokumentation wurde ebenfalls verschickt.
Zu Beginn der Nachbarschaftsgespräche wurde eine Begleitgruppe eingerichtet. Diese bestand aus Akteuren der Verwaltung, Kooperations- und Netzwerkpartnern sowie aus einem Teilnehmer der Pilotgespräche aus 2017. Die Begleitgruppe wurde von einem externen Moderationsbüro unterstützt und traf sich drei Mal: vor der Auftaktveranstaltung, während der Vor-Ort-Gespräche und vor der Abschlussveranstaltung. Ihre Aufgabe war es den Gesamtprozess zu begleiten.
Vor der ersten Begleitgruppensitzung fand eine Auswahl von Zufallsbürgern statt. Hierzu wurden in der ersten Runde 200 Bürger zufällig aus dem Einwohnermelderegister ausgewählt und mit einem Schreiben des Oberbürgermeisters zur Teilnahme an den Nachbarschaftsgesprächen eingeladen. Da der Rücklauf in der Nordstadt auch nach Erinnerung und Ermunterung zur Teilnahme in der ersten Runde gering war, wurden in einer zweiten Runde nochmals 200 neue Bürger zufällig ausgewählt und angeschrieben. Insgesamt erklärten sich 15 "Zufallsbürger" sowie fünf im Stadteil bereits Engagierte zur Teilnahme bereit. So wurde die zuvor festgelegte maximale Gruppengröße erreicht. Dennoch blieben zwei Personen trotz Anmeldung den Gesprächen fern.
Mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung der Stadtteile Nordstadt und Dillweißenstein starteten die Gesprächsrunden. In der Auftaktveranstaltung wurde das Pilotprojekt im Rahmen eines Interviews mit Teilnehmern des Pilots aus 2017 reflektiert. Exemplarisch wurden einzelne Ergebnisse aufgezeigt sowie der Ablauf der Nachbarschaftsgespräche vorgestellt. Im Anschluss fanden sich die Teilnehmer in ihren Stadtteilgruppen zusammen, lernten sich kennen und sammelten bereits erste Themen.
Aus der Erfahrung mit den Nachbarschaftsgesprächen entschied sich die Stadt Pforzheim für ein Projektbudget in Höhe von 3.000 Euro für die Umsetzung von im Rahmen der Gespräche erarbeiteten Projekten. Je Stadtteil wurde ein solches von der Stadt Pforzheim eingeplant.
Im ersten Nordstadt-Gespräch fand eine Fortführung der Themensammlung aus der Auftaktveranstaltung satt. Die Teilnehmer brachten weitere Ideen ein und ergänzten die Themensammlung. Im Laufe der Diskussion entstanden bereits bereits erste Projektideen. Zudem hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, anwesende Verwaltungsvertreter zu verschiedenen Themen direkt zu befragen.
Im zweiten Gespräch kam die Themensammlung zum Abschluss. Durch die Bepunktung der Themen durch die Teilnehmer konnte die Gruppe gemeinsam einschätzen, welches die wichtigsten Aspekte für den Stadtteil sind. Das so entstandene Meinungsbild diente als Grundlage für die Auswahl der Projektideen.
Diese Projektideen wurden in einer dritten Gesprächsrunde weiter bearbeitet. Es wurden Maßnahmen für die Projektideen entwickelt und entsprechend detaillierter bearbeitet. Hierzu wurden Kleingruppen von je zwei bis vier Teilnehmern gebildet. Es wurden fünf Projekte ausgearbeitet.
Nach den Gesprächen vor Ort fand eine gemeinsame Abschlussveranstaltung für beide Stadtteile statt. Es nahemn zahlreiche Amtsleitungen, Verwaltungsvertreter sowie (Ober-)bürgermeister teil. Nach einem kurzen Rückblick auf die gesammelten Themen in den Stadtteilen, wurden die ausgearbeiteten Projekte diskutiert. Die anwesenden Verwaltungsvertreter gaben hierzu eine Einschätzung zur Realisierbarkeit, Zeitplan, Kosten und den notwendigen Ämtern, die zur Umsetzung notwendig sind.

Im Pforzheimer Sozialraum Sonnenberg, Sonnenhof und Wacholder bestehen derzeit nur wenige Strukturen und Angebote, die das Knüpfen sozialer Kontakte und damit das Entstehen eines lebendigen Miteinanders unterstützen. Der Aufbau eines ZWAR-Netzwerks - "Zwischen Arbeit und Ruhestand" - soll diese Lücke füllen. Das Netzwerk richtet sich schwerpunktmäßig an Personen zwischen 60 und 75 Jahren. Das Projekt umfasst die Gründung, Begleitung und Qualifizierung des selbst organisierten Netzwerks. Kernelemente bilden die regelmäßigen Treffen einer Basisgruppe sowie der Zusammenschluss verschiedener Interessengruppen wie etwa einer Lauf-, einer Gartengruppe oder auch einer Boule-Gruppe. ZWAR-Netzwerke folgen einem basisdemokratischen Ansatz und basieren wesentlich auf Selbstorganisation. Daher ist das Netzwerk weder als Verein organisiert noch parteiisch oder konfessionell gebunden. Auch Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben. Dieser Ansatz ermöglicht eine niederschwellige Ansprache von Bürger*innen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen und unterschiedlicher kultureller Herkunft.
Ziel des Projektes ist es, in Möggingen eine generationsübergreifende, verlässliche und zukunftsgewandte Nachbarschaftshilfe zu initiieren,die durch eine breite Bürgerbeteiligung getragen und weiterentwickelt wird. Die Bürgerinitiative "Zukunft Möggingen" ist ein Projekt der Bürgerbeteiligung und arbeitet seit 2017 an verschiedenen Projekten zur Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Lebens im Dorf.
Im Rahmen der ersten Mögginger Dorfwerkstatt und weiterführender Bürgerbeteiligungsprojekte ist der Wunsch der Bürger*innen nach einer verlässlichen Nachbarschaftshilfe klar geworden. Diese verlässliche Nachbarschaftshilfe soll eine Verschränkung der Generationen ermöglichen, ein gemeinschaftliches Leben im Dorf unterstützen und eine Entwicklung des Dorflebens nachhaltig fördern und absichern. Diese Initiative kann beispielhaft sein für die weiteren fünf außerhalb des Zentrums liegenden Ortsteile.
Das Rastatter Bahnhofsviertel verändert sich und wird dies auch weiter tun. Die Frage ist wie?!
Um diesen Veränderungsprozess zu begleiten, Einfluss zu nehmen und unterschiedliche Interessen sowohl von Bewohnern als auch von Gewerbetreibenden aufzunehmen und in Einklang zu bringen, wurden Nachbarschaftsgespräche durchgeführt.
In diesem Zusammenhang wurden Bedarfe vor Ort erfragt. In der Bahnhofstraße sowie an Plätzen im Viertel wurde hierfür zunächst mit einem mobilen Stand Präsenz gezeigt. Die Aktion hatte zum Ziel, den Passanten zuzuhören und möglichst niederschwellig mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Teilweise wurden auch Gespräche an der Haustüre oder über den Balkon durchgeführt. Aus diesen Gesprächen heraus konnten vier Themenbereiche für die weiteren Nachbarschaftsgespräche heraus gefiltert werden: Wohnen und Wohnumfeld, Gewerbe und Dienstleistungen, Sozialer Zusammenhalt und der Bereich Sicherheit.
Aufgrund der Corona-bedingten Situation musste bei der Projektumsetzung immer wieder flexibel geplant werden. Schließlich war es möglich, eine Pop-up Aktion in einem zu renovierenden Ladenlokal durchzuführen und hierbei mit Menschen im Viertel vertieft ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls wurde eine Fotoaktion auf dem "roten Sessel auf der Straße" angeboten, um den Anwohnern Gelegenheit zu geben, ihre Geschichte zum Bahnhofsviertel zu erzählen und über ihre Themen ins Gespräch zu kommen. Die Bilder sollten beim "großen Nachbarschaftsgespräch" zum Abschluss gezeigt werden und eine Verbindung ins Viertel herstellen. Dies konnte in der Form nicht durchgeführt werden - die Abschlussveranstaltung musste digital stattfinden.
Während des gesamten Projektes wurden Termine und Zwischenergebnisse stets über die örtliche Presse, die städtische Homepage und soziale Medien kommuniziert. Geworben und eingeladen zu den Gesprächen wurde aber auch ganz klassisch über Plakatierungen, Briefkasteneinwürfe sowie eine persönliche Ansprache.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.
Wie funktioniert gutes Zusammenleben im Rastatter Stadtteil Rheinau-Nord? Was bewegt die Bürger im Sinne einer guten Integration?
Um die Gemeinschaft der unterschiedlichen Menschen im Stadtteil zu stärken und um Rheinau Nord noch lebenswerter zu gestalten, wollte die Stadt Rastatt die Bewohner motivieren, sich für ihr Wohnumfeld zu engagieren. Dafür sollten Gespräche gemeinsam mit Vertretern aus Politik und aus Verwaltung stattfinden. Hierbei sollten Vorschläge diskutiert und verbindliche Maßnahmen für das künftige Zusammenleben vor Ort vereinbart werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich sowohl die Voraussetzungen als auch die Umsetzung grundlegend geändert. Es konnte weder eine Großveranstaltung durchgeführt werden, noch waren nach den ersten beiden Treffen der Projektgruppe weitere Präsenztreffen möglich, bei denen sich Projektteilnehmer hätten kennenlernen und niederschwellig austauschen können.
Das Kernteam musste den Plan mehrmals an die aktuellen Gegebenheiten anpassen und einigte sich nach Erörterung aller Möglichkeiten letztlich auf eine digitale Version des Nachbarschaftsgesprächs.
Die Erwartungen mit dem Nachbarschaftsgespräch neue und vor allem auch stille Gruppen zu erreichen wurden somit nur teilweise erfüllt. Es zeigte sich, welche Hürden digitale Veranstaltungen mit sich bringen und dass sie selbst mit unterschiedlichsten Angeboten - technische Unterstützung, betreute Internetplätze - nicht gänzlich aufzuheben sind. Einzelnen Personen konnten durch diese Angebote jedoch eine Teilnahme ermöglicht werden. Die Möglichkeiten, durch vorheriges Kennenlernen Berührungsängste abzubauen und persönliche Kontakte herzustellen, waren jedoch nur sehr eingeschränkt möglich.
Trotzdem waren im Stadtteil persönliche Gespräche mit Bewohnern vor Ort möglich. Unter dem Motto "Mein Herz schlägt für die Rheinau" waren die Mitglieder der Projektbegleitgruppe mit einem Stand an unterschiedlichen Plätzen im Stadtteil präsent. Außerdem wurden Gespräche bei der Einschulung, nach dem Gottesdienst vor der Kirche sowie bei Stadtteilrundgängen geführt. Die Herzpostkarten ermöglichten einen guten Gesprächseinstieg. Außerdem konnten die Bewohner notieren, welche Themen ihnen auf dem Herzen liegen. 130 Herzpostkarten wurden ausgefüllt im Stadtteiltreff abgegeben und über 200 Gespräche wurden geführt und Interessierte über einen Rundbrief auf dem Laufenden gehalten.
Abschließend wurde ein Online-Nachbarschaftsgespräch durchgeführt, an dem Bewohner des Stadtteils, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie der Oberbürgermeister mit dabei waren.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.

Die Quartiersentwicklung im Teilort Oberzell soll eine alters- und generationengerechte Gestaltung des Lebensumfeldes und einen Sozialraum für die gesamte Ortschaft schaffen. Bestehende Angebote, insbesondere in den Bereichen gemeinwesenorientierter Institutionen und im öffentlichen Nahverkehr sollen optimiert und ausgebaut werden, Infrastrukturen und Hilfsangebote für ältere Bürger sollen durch gezielte Maßnahmen etabliert und entwickelt werden. Die Lebensqualität älter werdender Bürger soll nachhaltig verbessert werden, der Unterstützungsbedarf ist daher zu ermitteln und muss bedarfsgerecht ausgerichtet werden, um die Integration ins soziale Umfeld zu unterstützen. Ziel ist es gemeinsam mit den Bürgern der Ortschaft ein Gesamtkonzept zu entwickeln, den Bedarf an Plätzen für betreutes Wohnen, stationäre/teilstationäre Pflegeangebote sowie ambulante Pflege zu konkretisieren und darüber hinaus ein Zentrum mit Begegnungsmöglichkeiten und begleitenden Angeboten aufzubauen.
Reicheneck ist eine Bezirksgemeinde von Reutlingen mit 900 Einwohner*innen. In der Regel kennt im Dorf jeder jemanden, der besondere Fähigkeiten und Talente hat. Man hilft sich gegenseitig, wenn Bedarf ist. So war das zumindest früher. Heute sind diese Nachbarschaftshilfen nicht mehr so selbstverständlich, da sich die Bürger*innen durch Zuzug von Neubürger*innen und die Entfremdung der Arbeitswelt vom Dorf immer weniger begegnen und kennen.
Für eine lebendige Gemeinde ist aber gerade die Kommunikation und gegenseitige Unterstützung unabdingbar. 2016 gründete der Förderverein "Dorfmitte Reicheneck" einen Genossenschaftsladen, der nicht nur die Dorfmitte reaktivierte, sondern auch ein Bewusstsein für ein neues verantwortliches Miteinander schuf. Daran anknüpfend, will der Förderverein nun eine koordinierte Nachbarschaftshilfe aufbauen, die Angebote und Anfragen miteinander verknüpft und Nachbarschaftshilfe dadurch wieder zum Bestandteil des alltäglichen Lebens macht.
Mit den Nachbarschaftsgesprächen wollte die Stadt Reutlingen Bürgern, die oft nicht gehört werden, ein Ohr leihen und ihnen eine Stimme geben. Die Stadt Reutlingen wollte Mut machen, sich im Gemeinschaftsleben aktiv zu beteiligen und die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einzubringen. Es sollten Brücken zwischen den verschiedenen Milieus und zwischen unterschiedlichen Menschen geschlagen werden. Mit den Nachbarschaftsgesprächen sollte damit die Lebensqualität der Menschen gestärkt sowie das Wohnquartier Ringelbach qualitativ weiterentwickelt werden.
Aufgrund der Corona-bedingten Situation musste das Vorhaben mehrfach neu geplant werden. Schließlich wurde auf digitale Nachbarschaftsgespräche umgestellt.
Um auch Menschen, die weniger Erfahrung mit digitalen Formaten haben, eine entspannte Teilnahme zu ermöglichen, wurde angeboten, dass man sich bereits 30 Minuten vor Beginn des Online-Treffens digital trifft und eine technische Einführung erhält.
Im Rahmen der digitalen Treffen konnten Themen für die Weiterarbeit vor Ort ausfindig gemacht werden. Diese betrafen u.a. Müll, Verkehr, Parken sowie Begegnung und Sicherheit. In Kleingruppenarbeit konnten die Themen vertieft besprochen und erste Vorschläge gesammelt werden. Diese Kleingruppen wurden während eines Nachbarschaftsgesprächs von Mitgliedern der eingerichteten Steuerungsgruppe moderiert.
Während der Nachbarschaftsgespräche kamen Fragen auf, die während der Treffen nicht direkt beantwortet werden konnten. Diese Punkte wurden entsprechend bis zum nächsten Nachbarschaftsgespräch in die Verwaltung hineingetragen und Rücksprache gehalten. So konnten die offenen Punkte bereits in der nächsten digitalen Runde weiter angegangen werden.
Werfen Sie auch einen Blick in unseren Blogbeitrag.

Unter dem Motto "Wir fürs Quartier" sollen die Bewohner*innen des Stadtteils Hohbuch/ Schafstall in ihrer Vielfalt gewonnen werden, bei der Gestaltung eines guten und generationengerechten Zusammenlebens mitzuwirken. In einem fortlaufenden, breiten Beteiligungsprozess soll ein Konzept für eine passgenaue und partizipative Quartiersarbeit entwickelt werden. Es soll eine zentrale Anlaufstelle, ein Stadtteilbüro mit Koordinator*in, eingerichtet werden, wo Bedarfe gesammelt, Ideen gebündelt und Aktivitäten gemeinsam geplant und umgesetzt werden können. Die Engagement-Strukturen vor Ort sollen gefestigt und weiter ausgebaut werden. Nach einer Auftaktveranstaltung sollen verschiedene niederschwellige Angebote konzipiert und realisiert werden, die auf Austausch, Begegnung und Teilhabe zielen. Die Räumlichkeiten bietet u.a. das Evangelische Gemeindezentrum, das zu einem Quartierszentrum "für alle" weiterentwickelt werden könnte. Durch das Projekt wird das soziale Miteinander gefördert und die Lebensqualität im Stadtteil gesteigert. Es wird durch eine Steuerungsgruppe realisiert und vom Arbeitskreis Hohbuch/ Schafstall, einer Stadtteilrunde aus lokalen Einrichtungen und Akteur*innen, begleitet.
Das Projekt "Quartier im Wandel - gemeinsam gestalten" beschreibt einen Entwicklungsprozess für die Quartiere in der Kernstadt Rheinfeldens. Mit dem Ausbau der bestehenden Quartiersarbeit und der Erstellung eines Rahmenkonzeptes wollen wir Integration und Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen in strukturierter und lokal angepasster Weise fördern. Das Ziel ist die langfristige Verbesserung und Sicherung des sozialen Zusammenhalts, der Lebensqualität und der Identifikation mit dem je eigenen Umfeld im Zusammenleben der verschiedenen Generationen und unabhängig von der eigenen Herkunft. Zentral ist dabei ein partizipatorischer Ansatz, der die Einrichtungen und Vereine vor Ort zu einem Netzwerk Quartier aktiviert und die lokale Bevölkerung zur Mitarbeit an der Planung und Umsetzung des Projekts und damit an der Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelt motiviert.
Im Rahmen der Stadtkonzeption 2030 der großen Kreisstadt Rottenburg, welche im September 2019 startete, wurde die Ortschaft Seebronn als Pilot-Quartier zum Themenbereich "Leben und Wohnen im Alter" ausgewählt. Unter dem Motto "Zuhause in Seebronn - wir gestalten Zukunft" gestalten Bürger, soziale und kulturelle Akteure der Ortschaft nun ein Zukunftskonzept mit den Themen/ Anliegen/ Visionen vor Ort und konkreten Handlungsfeldern. Ein Ortschaftsmodell soll entwickelt werden, in welchem die aktuelle Situation erhoben, reflektiert und neue, spannende Ziele und Maßnahmen gestaltet werden. Impulse, Projektideen und Beteiligungsmöglichkeiten sollen in die städtischen Leitgedanken einfließen.
In Rottweil sollte im Zuge der Nachbarschaftsgespräche die aktuelle Situation vor Ort betrachtet und diesbezüglich Bilanz gezogen werden. Hierfür haben sich etwa 40 Teilnehmer zusammengefunden. Gemeinsam mit dem Berater des Projekts wurden diese methodisch durch ein dialogorientiertes Ideenworkshop-Format in die Lage versetzt, innerhalb eines Nachmittag eine Ist-Analyse der Integration vor Ort durchzuführen. Verbesserungspotentiale, Probleme und Angebotslücken sollten erkannt, Ideen hierfür erarbeitet und in ersten Ideenkonzepten festgehalten werden. Dies geschah in vier Themengruppen: "Wohnraum/Situation auf dem Wohnungsmarkt", "Begegnung und Freizeit", Schule und Ausbildung/Arbeit" sowie "Sprache". Die Anwesenden konnten sich den Gruppen nach eigenem Interesse zuordnen. Jeder Themenbereich beschäftigte sich intensiv mit folgenden Fragen:
- Wo stehen wir in Rottweil mit der Flüchtlings-Arbeit? (Ist-Stand)
- Wo wollen wir hin?
- Welche weiteren Schritte müssen geplant werden? (Ideensammlung)
Am Ende des Tages war so ein Überblick erarbeitet worden, welche Themen in Rottweil noch Änderungs- und Verbesserungsbedarfe in sich bergen und was bereits gut läuft. Auch entstanden in den Gruppen konkrete, tragfähige Ideen und Aufgaben, um Stolpersteine bei der lokalen Integrationsarbeit zu beseitigen oder auch neue Impulse zu setzen.
Die Wiesenstraße ist ein Industrie- und Wohngebiet im Schorndorfer Norden, das von einer vielfältigen Bürgerschaft geprägt ist. Zum Zeitpunkt der Förderung befand sich das Wohngebiet in einer großen Umbruchphase aufgrund einer Umstrukturierung und neuen Bebauung.
Die Stadt Schorndorf wollte mit den Nachbarschaftsgesprächen vor Ort Bürger dafür gewinnen, sich für ihren Stadtteil einzubringen. Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Partnern und politischen Akteuren sollten Konflikte und verbindende Elemente zur Sprache und die Nachbarn vor Ort gemeinsam ins Gespräch gebracht werden.
Aufgrund der Corona-bedingten Situation sowie personeller Veränderungen konnten die Gespräche nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Fokus der Befragung vor Ort richtete sich auf bauliche Veränderungen und die Lebensqualität vor Ort. Die umliegenden Gebäude wurden alle mit Handzetteln zum Vorhaben informiert, um das Interesse zu wecken und die Beteiligung an der Befragung zu fördern. Die Befragungen wurden mit entsprechendem Abstand aufgrund des Infektionsschutzes durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung wurden zusammengetragen und für ein gemeinsames digitales Treffen mit allen Beteiligten aufbereitet.
Geplant war eine Online-Veranstaltung, die jedoch aufgrund sehr geringer Zusagen abgesagt werden musste. Ziel war es, die Bürger über das geplante Vorhaben und die Zugangsmöglichkeiten zu den entstehenden Wohnungen zu informieren. Die Informationen wurden schriftlich gesammelt und den Bürgern über einen Schaukasten und weitere Aushänge vor Ort zur Verfügung gestellt.
Die Ergebnisse sollen bei weiteren Veranstaltungen wieder aufgenommen werden.
L(i)ebenswertes Schorndorf - Die Remstal-Gartenschau 2019 bringt Schorndorfer*innen auf eine ganz neue Art zusammen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und gemeinsames Gestalten gehen Hand in Hand. In diesem Schwung entsteht ein neues Quartiersprojekt. L(i)ebenswertes Schorndorf ist ein gestalterisches und schöpferisches Projekt. Ausgehend von dem Sozialraum Au werden kreative Beteiligungsformen mit integrierter Sozialplanung kombiniert. Ausgehend vom Zentrum für internationale Begegnungen entwickelt sich eine neue nachbarschaftliche Perspektive für die Menschen vor Ort, die ihre Anliegen thematisieren und aktiv gestalten.
"Gut alt werden in den eigenen vier Wänden und im Ortsteil" - das ist der grundlegende Gedanke der städtischen Konzeption der Seniorenarbeit in Schwäbisch Gmünd. Seit 2015 wurden in den Stadtteilen Sorgenden Gemeinschaften als Netzwerke installiert. Seit 2017 baut man mit dem Projekt Weitblick unterstützende Netzwerke für pflegende Angehörige auf.
Mit CARING POINT soll in zwei Ortsteilen von Schwäbisch Gmünd, Großdeinbach und Rehnenhof-Wetzgau, quartiersbezogen ein Beratungs- und Vermittlungsknoten aufgebaut werden. Der CARING POINT soll zum einen durch aktiv geplante Hausbesuche Versorgungslücken bei älteren Bürger*innen aufdecken und Unterstützung vermitteln, zum anderen Informationsveranstaltungen vor Ort rund um das Thema Fürsorge und Pflege gemeinsam mit ansässigen Netzwerkpartnern planen und organisieren. Das Projekt ist Teil der quartiersbezogenen städtischen Seniorenarbeit.
Die Leitideen des Vorhabens – die Entwicklung einer Caring Community, das Stärken der Sorgekultur, die Etablierung eines Palliativnetzwerkes mit dem Umsetzungsansatz der Bürgerbeteiligung – reichen weit über die bestehende professionelle Versorgung hinaus. Sie erfordern eine neue partnerschaftliche Sorge im Miteinander und Füreinander mit einem Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen, in welches auch bedürftige Menschen und vulnerable Zielgruppen als wertvolle Partner einbezogen werden.
Die geplanten Maßnahmen und Impulse verfolgen mit den partizipativen Formaten der Beteiligung, Einbindung und Information – als sog. Bürgerprojekt – das Ziel, das Hospiz in seinem Umfeld der Quartiere von Schwäbisch Gmünd und den 23 Kommunen der Raumschaft bereits während Bauphase als wichtiges Angebot zu etablieren und in bestehende Sorgenetzwerke zu integrieren. So kann es nachhaltig gelingen, dass ein stationäres Hospiz von Anfang an von den Kommunen und ihrer Bürgerschaft unterstützt wird.
In Schwäbisch Gmünd wurden im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche die Fragen nach dem Funktionieren des gemeinsamen Zusammenlebens in einer Stadt gestellt. Damit verbunden ist die Frage, nach den Werten, die die Einwohner als Stadtgesellschaft zusammenhalten. Dafür wurde ein Format erarbeitet, durch das möglichst viele Einwohner in den Prozess involviert werden. In einem nächsten Schritt war es das Ziel, ein gemeinsames Wertesystem zu erarbeitet, das von allen Einwohnern gemeinsam getragen wird: Die „Charta der Gemeinsamkeiten“.
In der ersten Phase „Charta on Tour“ wurden Empfehlungen zu den entwickelten Thesen gefunden. Mit Hilfe der Bewohner wurden in diesem Kontext die Lücken gefüllt, die bezüglich dieser Themen bestanden.
In der zweiten Phase wurden in allen Stadtteilen Nachbarschaftsgespräche durchgeführt. Hierzu wurden Fragen gestellt wie: „Wie könnte eine Charta aussehen?“ „Was fehlt euch am ersten Vorschlag?“ Der gesamte Prozess wurde dabei von einem Charta-Beirat begleitet.
Abschließend wurde die "Charta der Gemeinsamkeiten" vom Gemeinderat verabschiedet sowie der Öffentlichkeit vorgestellt.
In Schwäbisch Gmünd fanden die Nachbarschaftsgespräche als Teil des Prozess „Gmünder Charta der Gemeinsamkeit“ statt. In dem Beteiligungsprozess werden die von der Verwaltungsspitze im Jahr 2017 formulierten Themen, wie zum Beispiel „eine sorgende Gemeinschaft“, diskutiert und konkretisiert. Im Stadtteil „Altstadt“ kommt das Format „Salz und Suppe“ zum Einsatz. Die Projektidee "Salz und Suppe" stammt von der Landeshauptstadt Stuttgart.
Eine Vorbereitungsgruppe bestehend aus vier Mitarbeitern des Projektteams hatte vor Beginn des Nachbarschaftsgesprächs ein Probekochen durchgeführt. Hierbei wurde das Projekt vorbereitet und insgesamt getestet wie die Idee hinter Salz und Suppe funktioniert. Nach der Vorbereitungsphase und einer Schulung der Moderatoren für die Kochgruppen fand eine Auftaktveranstaltung statt. An dieser Veranstaltung haben sich in einer zwanglosen Atmosphäre Teilnehmer für die vier Kochgruppen gefunden.
Für jeden der Kochabende wurde eine eigene Aufgabe gestellt:
1.) Was macht das Zusammenleben in der Altstadt manchmal schwierig?
2.) Was könnte in der Innenstadt anders und was könnte besser sein?
3.) Wählen Sie eine dieser Ideen zur Verbesserung des Zusammenlebens aus und konkretisieren Sie diese.
4.) Vorbereitung der Präsentation für die Abschlussveranstaltung.
Die Kochgruppen begannen stets mit einem Spaziergang zu einem jeweils anderen Ort im Stadtteil. Dadurch wurden die Altstadtorte im Prozess präsent. Danach wurde beim gemeinsamen Vorbereiten der Zutaten und anschließenden Kochen über die oben genannten Aspekte gesprochen. Am Ende der jeweiligen Kochabende wurden die besprochenen Punkte auf Papieren festgehalten.
Die Kochgruppen präsentierten ihre Ideen auf einer Abschlussveranstaltung. Auch hier war entsprechend dem Format ein schwäbisches Buffet vorzufinden.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.gmuendercharta.de/nachbarschaftsgespraeche.

Zwischen den Quartieren Oststadt (67 % Migrationshintergrund (MH)) und Hardt (69 % MH, Housing Area 95 % MH) soll eine moderne Allmende in Form eines essbaren Wildpflanzenparks mit einem Schulungs- und Begegnungszentrum entstehen. Mit dieser zukunftsorientierten Flächennutzung wird eine bisher artenarme Wiese nachhaltig aufgewertet: als neuer sozialer niederschwelliger Treffpunkt und Ort der Begegnung, für den sozialen Ausgleich, für die Bildung für nachhaltige Entwicklung, sowie für den Natur- und Artenschutz. Durch die frühzeitige Einbindung der Menschen vor Ort, diverser Gruppen und zivilgesellschaftlicher Akteure in die Planung in einem Bürgerbeteiligungsprozess haben diese die Möglichkeit, sich das Projekt zu eigen zu machen. Als Experten für ihre Bedürfnisse für die späteren Nutzung können sie innerhalb von vorgegebenen Leitplanken die Infrastruktur des Parks gestalten, später anlegen und pflegen. Insgesamt führt dies zu einer stärkeren Vernetzung vieler Akteure und Gruppen und ihrer Verortung und Identifikation mit dem Stadtteil.
Die Stadt Sigmaringen wollte mit den Nachbarschaftsgesprächen Bürger miteinander und mit der Stadtverwaltung selbst ins Gespräch bringen. Hierfür wurden alle Einwohner aus allen Stadt- und Ortsteilen öffentlich eingeladen. Weitere 500 Bürger wurden per Zufallsprinzip postalisch angeschrieben. Schließlich kamen etwa 40 Personen zur Auftaktveranstaltung. Sie beschäftigten sich in vier Gesprächsgruppen mit den Themen: "Baum des Lebens", Projekt und Kommunikation", "Begegnung" und "Sicherheit".
Jede Arbeitsgruppe wurde von einem Moderator unterstützt. In einem weiteren Schritt wurden Termine für Folgetreffen vereinbart, um die neuen Gedanken und Impulse weiter zu verfolgen. Die Gruppen arbeiteten entsprechend weiter. Die Ergebnisse wurden an die enstprechenden Stellen weitergegeben.
Aufgrund eines entsprechenden Antrags von vier Fraktionen des Gemeinderates beschloss der zuständige Ausschuss im Januar 2020, dass die Quartiersarbeit ein ressortübergreifender Handlungsschwerpunkt der Stadt Singen wird. Der Verein InSi e.V. erstellt dazu in Kooperation mit der Stadt Singen ein ganzheitliches Grundlagenkonzept. Dieses soll Basis für weitere Entscheidungen des Gemeinderates im Oktober/ November 2020 über räumliche und inhaltliche Schwerpunkte sowie Prioritäten sein. Auf dieser Grundlage sollen dann in einem oder maximal zwei ausgewählten Stadtteilen Prozesse der Bürgerbeteiligung und Sozialraumanalyse beginnen. Bereits vorhandene sozialräumliche Handlungsansätze werden dabei weiterentwickelt und in das Gesamtkonzept integriert. Die Quartiersarbeit soll in mehreren Schritten weiter ausgebaut werden. Ziel ist die Etablierung einer ganzheitlichen Quartiersarbeit mit tragfähigen Strukturen der Nachbarschaftshilfe und des bürgerschaftlichen Engagements.
Am Wiener Platz, direkt am Bahnhof in Stuttgart-Feuerbach gelegen und neues „Tor zu Feuerbach“, soll nach Instandsetzung der Fläche ein altersgerechtes, innovatives, nachhaltiges und multifunktionales Quartier entstehen. Das Quartier mit Mischgebietscharakter (ca. 30% gewerblicher Anteil) soll sich durch ein lebendiges und aktives Gemeinwesen sowie Innovationselemente im Bau und im sozialen Miteinander auszeichnen. Um das zu erreichen, arbeiten alle Projektpartner eng zusammen. Neue Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen in der Zivilgesellschaft sollen in Kombination mit einem guten Älterwerden erprobt werden. Neben Wohnraum werden soziale Einrichtungen, vor allem auch für Pflege und Unterstützung (z.B. Tagespflege, ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaften, Kita) eine Heimat finden. Miet- und Eigentumswohnungen für verschiedene Zielgruppen (teilweise mit Unterstützungsbedarf) werden durch verschiedene Akteure ((Mieter-)Baugemeinschaften, Genossenschaft, Bauträger) geschaffen.
Ein gesamtstädtischer Treffpunkt für Engagementförderung & Bürgerbeteiligung wird analog in der Sulzer Innenstadt aufgebaut und mit einer digitalen Mitmachzentrale und Beteiligungsplattform kombiniert. Eine DENKWERSTATT mit partizipativen Elementen des Design-Thinking wird integriert. Der Einsatz digitaler Technik wird für Engagierte, Senioren, Zuwanderer, Menschen mit und ohne Handicap sowie ihre Angehörigen erschlossen. Mit Qualifzierungsprogrammen und einem Technik-Assistenzpool wird die Anwendung (Smartphone, Tablet, Videotelefonie, digitale Mitmachzentrale, Beteiligungsplattform) für Interessierte, Gruppen und Einzelpersonen in Kooperation mit der Zivilgesellschaft zugänglich gemacht. Eine Telefonkette für ALLE sowie ein "Skype-Projekt" für Menschen mit Behinderung sind geplant. Aufsuchende Beteiligung, Bürgerrat mit Zufallsbürgerauswahl, eine Zukunftswerkstatt und ein begleitendes Online-Cafe begleiten den Aufbau.
Unter dem Motto „Heimat, Sole und Kultur“ wurden die Nachbarschaftsgespräche in Sulz am Neckar vor dem Ziel durchgeführt, die Bürger aktiv in die Entwicklung für ein attraktives und vitales Quartier „historische Altstadt“ einzubinden.
Hierfür wurde eine Begleitgruppe eingerichtet, die sich unter anderem aus Vertretern des Arbeitskreises Flucht und Asyl, des Kultur- und Heimatvereins Sulz und auch des Kernstadtbeirats zusammensetzte. Sie übernahm im Prozess eine reflektierende Rolle.
Im Zuge von Markplatzgesprächen wurden Bürger in der historischen Innenstadt an unterschiedlichen Plätzen direkt angesprochen. Das Ziel dabei: mit unterschiedlichen Personengruppen ins Gespräch kommen und auf die geplanten Bürgerwerkstätten aufmerksam machen. An den Bürgerwerkstätten selbst wurden die Schwerpunkte auf folgende Themen gelegt: Mobilität, öffentliche Plätze und Handel, gute Nachbarschaft. Dabei übernahmen Bürger, die sich im Vorfeld im Zuge einer Qualifizierung zu „Bürgermoderatoren“ ausbilden lassen hatten, die Moderation von Kleingruppen.
Die dabei erarbeiteten Aspekte stellten im Weiteren die Basis für die Treffen zum Thema „Handwerkskunst und Bürgerbeteiligung“ dar. Hierbei war die Aufgabe der Teilnehmenden, die Erfahrungen und Ergebnisse aus den zuvor geführten Gesprächen weiter zu verarbeiteten.
Die erarbeiteten Maßnahmen wurden an die entsprechenden Stellen weitergegeben und teils bereits in die Umsetzung gebracht.
Innerhalb der Nachbarschaftsgespräche sollte ein integratives und praxisorientiertes Quartierskonzept für die künftige Gemeinwesenarbeit entstehen. Auch war damit verbunden, den neuen Quartierstreff gemeinsam zu entwickeln. Der Stadt Tettnang war es dabei ein Anliegen, dass sich die Vorhaben eng an den Interessen und an den Bedürfnissen der Bewohner aus St. Anna sowie der anliegenden Nachbarschaft orientieren.
Aufgrund der Corona-bedingten Situation konnte das Vorhaben nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Dennoch konnten erste Schritte in Richtung Quartierskonzept gegangen werden. So bildete sich eine Begleitgruppe, die sich auch über das Projekt hinaus weiterhin trifft.
Die Nachbarschaftsgespräche wurden als Quartiersspaziergänge durchgeführt. Dies war unter Pandemie-Bedingungen möglich. Des Weiteren konnten sogenannte "Hausumtrunke" stattfinden, die dazu dienten, erste Kontakte untereinander zu knüpfen und Bedarfe vor Ort ausfindig zu machen. Hierfür wurden in die Häuser des Wohnquartiers Flyer in deutscher und englischer Sprache eingeworfen, um so auf das Angebot aufmerksam zu machen.
Im ersten Schritt der Quartiersentwicklung unter dem Motto "Unterjesingen.gut.leben - in jedem Alter" ging es um die Entwicklung des Teilortes Unterjesingen mittels Bürgerbeteiligung und Aktivierung unter dem Fokus Wohnen, Leben und Pflege im Alter und mit besonderem Blick auf das Zusammenleben aller Bewohner*innen. Ziel ist eine ausreichende Versorgung mit vollstationärer Pflege und die Entwicklung des Teilortes, sodass ein Leben zu Hause bzw. im Stadtteil so lange als möglich erreicht werden kann. Im bisherigen Verlauf des Beteiligungsprozesses wurden von den Bürger*innen verschiedene Projekte identifiziert und favorisiert. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, die Projekte auszuarbeiten, zu konkretisieren und umzusetzen. Ein weiteres Ziel stellt die Verstetigung der Bürgerbeteiligung dar.
Das Projekt begegnet aktuellen Herausforderungen sozialer Arbeit, die insbesondere in Zeiten von Corona zu Tage traten. In der Verknüpfung analoger und digitaler Lösungen wird diesen Herausforderungen Rechnung getragen und die digitale Kluft zu benachteiligten Personengruppen überwunden. Dabei steht Diglusion in einem erweiterten Verständnis des Zusammenspiels "inklusiv und digital".
Nach dem Motto "so analog wie möglich (im persönlichen Kontakt zu den Menschen) - so digital wie nötig" werden neue Formen professionellen Handelns erprobt und benachteiligte Personengruppen gezielt im Umgang mit digitalen Techniken gefördert und unterstützt. Durch die zielführende Weiterentwicklung der bestehenden raumbezogenen Fachdienste als Kümmerer vor Ort sowie der bestehenden Quartierszentrale zu einem diglusiven Ort der Begegnung werden nachhaltig wirksame Sorgestrukturen im Nahfeld der Menschen entwickelt, die in die gesamte Stadt übertragen werden können.
Das Nachbarschaftsgespräch fand im Rahmen des Projektes „Internationale Botschaft“ statt. Für das Projekt „Internationale Botschaft“ schuf die Stadtverwaltung einen festen Ort in der Stadt Ulm. Dafür wurde ein Pop-up Raum (Container in schick) als temporäre Architektur für zwei Wochen auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz gegenüber des Ulmer Rathauses installiert. Der Hans-und-Sophie-Scholl-Platz ist ein zentraler und belebter Teil des öffentlichen Raumes im Sozialraum Mitte/Ost. Der Sozialraum Mitte/Ost war aufgrund seiner Bedeutung als Stadtmitte besonders geeignet, um die vielfältige und breite Stadtgesellschaft an einem Ort der Begegnung zu erreichen.
Die Bürgerbeteiligung fand im Projekt „Internationale Botschaft“ auf mehreren Ebenen statt. Hier Beispiele:
1) Es wurde versucht eine möglichst niederschwellige Zugangsmöglichkeit zum Bürgerdialog zu schaffen. Dies gelang, indem die „Internationale Botschaft“ als ein Ort der Begegnung, als Anlaufstelle, als Beratungsstelle und Treffpunkt im Ulmer Stadtgebiet verortet wurde. Ziel war es auch junge Menschen für die Beteiligungsformate zu gewinnen, was durch die unkonventionelle und moderne Gestaltung des Pop-up Raumes erreicht wurde. Durch die Schaffung eines Platzes der Zusammenkunft und durch verschiedene Veranstaltungsformate gelang es den informellen Austausch zwischen der Stadtgesellschaft untereinander aber auch zwischen der Stadtgesellschaft, Stadtpolitik und Stadtverwaltung anzuregen.
2) Die „Internationale Botschaft“ wurde bespielt, um eine tiefere Ebene der Bürgerbeteiligung zu erreichen. Innerhalb eines Kulturell-/ Künstlerischen- Programmes hatten verschiedene Akteure die Möglichkeit die temporäre Architektur einen Tag, im Rahmen eines vom jeweiligen Akteur individuell gestalteten Konzeptes, für Aktionen zu nutzen. Die Koordinierungsstelle Internationale Stadt und der entsprechende Berater des Projekts waren zusätzlich täglich vor Ort. Wann möglich auch der zivilgesellschaftliche Partner ZEBRA e.V. Ziel war es die Akteure innerhalb der Stadtgesellschaft bekannter zu machen sowie eine leichtere Zugangsmöglichkeit zu den jeweiligen Akteuren zu schaffen.
3) Das Nachbarschaftsgespräch/der Bürgerdialog fand innerhalb der partizipativen Aktion „inter(national)personal Ad“ statt. Das Format „inter(national)personal Ad“ wurde zusammen mit der Agentur „Hahn15“, ZEBRA e.V. und der deutsch-amerikanischen Community-Künstlerin Carly Schmitt entworfen und umgesetzt.
Idee: Aktion - Inter(national)personal Ad
Angelehnt an die Idee der Kontaktanzeige haben Menschen unterschiedlicher Herkunft mit und ohne internationale Wurzeln miteinander kommuniziert - zu Themen des Miteinanders in der Internationalen Stadt Ulm. So wurde eine Teilhabemöglichkeit für alle Mitglieder der Ulmer Stadtgesellschaft geschaffen. Dies funktionierte wie eine Art Tauschbörse über die Abgabe von Angeboten und Gesuchen. Die Angebote und Gesuche konnten ein breites Spektrum umfassen und sowohl abstrakt als auch konkret sein. Thematisch stand jedoch die nachhaltige Entwicklung im Sinne eines kulturellen, sozialen, inklusiven und generationenübergreifenden Miteinanders im Vordergrund. Vor allem junge Menschen wurden bei der Aktion an der Frage beteiligt, wie die Gestaltung des Zusammenlebens in einer internationalen Stadtgesellschaft gelingt.
Den Rahmen bildeten immer die Kernfragen der Internationalen Stadt. Diese wurden in 7 Labels übersetzt, mit denen die jeweiligen Kontaktanzeigen versehen wurden. Jedes Angebot/ Gesuch bezog sich also automatisch auf eines dieser Labels:
1. Internationales Lebensgefühl / International Lifestyle
2. Gesellschaftlicher Dialog / Social Dialogue
3. Engagement / Involvement
4. Beruf / Profession
5. Glaube / Beliefs
6. Demokratie / Democracy
7. Digitales Leben / Digital Life
Der Bürgerdialog „Inter(national)personal Ad“ war sowohl digital als auch analog angelegt. Die Ergebnisse beider Arten des Bürgerdialoges wurden sowohl digital als auch analog dokumentiert und gesichert.
Ziel des Projektes ist, das in der Stadt Vellberg vorhandene soziale Kapital, im Sinne einer "Sorgenden Gemeinschaft", zu bündeln und die Akteure (Bürger*innen sowie Vereine und Institutionen) auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens zu vernetzen.
Dazu werden sich zum einen die örtlichen Vereine und Institutionen, die rund um die Themen Daseinsfürsorge und soziales Miteinander aktiv sind, im Vellberger Bürgerforum zusammenschließen, um die einzelnen Angebote zu koordinieren und besser bekannt zu machen. Zum andere soll eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden, die allen Bürger*innen für sämtliche Fragen im sozialen und gesellschaftlichen Leben offen steht, über vorhandene Aktivitäten informiert, sie unterstützt und berät sowie bedarfsgerechte Dienstleistungen und Angebote vermittelt. Die Anlaufstelle soll darüber hinaus Menschen mit Ideen zusammenführen und sie bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen.
Die Nachbarschaftsgespräche in Villingen-Schwenningen wurden an fünf Projektabenden innerhalb von sechs Monaten durchgeführt. Dafür wurden zunächst 240 Bürger zufällig angeschrieben. Nachdem die Resonanz hierauf nicht ausreichend war, wurden weitere 240 Bürger angeschrieben. Zusätzlich wurden im Zuge der aufsuchenden Ansprache Personen vor allem mit Migrationshintergrund erreicht. So fanden sich etwa 16 Personen an den Treffen zusammen. Nachdem zunächst Empörung über Aspekte in Villingen-Schwenningen geäußert wurde, konnten über den gemeinsamen Austausch mit der Stadtverawaltung daraus bearbeitbare Anliegen gefiltert werden.
Die Treffen der Nachbarschaftsgespräche wurden stets von der Teilnehmern aus der eingerichteten Begleitgruppe moderiert. Die Treffen fanden alle im Neckarforum statt. Dies ist ein im Stadtgebiet zentral gelegener Veranstaltungsraum. Von hier aus konnte am zweiten Treffen auch ein Stadtteilspaziergang erfolgen, zu den für die Teilnehmer wichtigen Orte. Die Ergebnisse der Gespräche wurden dokumentiert. Der Wunsch danach besteht, dass sich die Teilnehmer nach einem Jahr wieder treffen, um die Arbeit an den Themen bis zu diesem Zeitpunkt auszuwerten.
Der in den 70er Jahren entstandene Stadtteil Korber Höhe bietet Menschen vieler unterschiedlicher Nationalitäten eine Heimat. Das Projekt „Gemeinsam auf der Höhe – für ein gutes Miteinander“ hat das Ziel, eine gute Gemeinschaft und ein selbstbestimmtes Älterwerden in der vertrauten Umgebung im Stadtteil zu fördern. Im Rahmen von „Quartier 2020“ wurden mit großer Bürgerbeteiligung viele Projektideen entwickelt. „Quartiersimpulse“ soll der Umsetzung und Verstetigung dienen und das Quartier mit neuem Engagement beleben. Zwischen den interessierten Bürger*innen, den lokalen Initiativen und der Stadtverwaltung sollen die Themen „Nachbarschaftskontakte und Netzwerke“, „Öffentlichkeitarbeit und Image“ sowie „öffentlicher Raum und Grün“ im Stadtteil gestärkt werden. Dazu zählt auch die programmatische und räumliche Weiterentwicklung des „Forum Nord“, eine Begegnungsstätte für die Bewohner*innen des Stadtteils, welche Unterstützungsstrukturen und Vernetzung bietet.
Unter Beteiligung der Bevölkerung wird im Waldkirchner Stadtteil Kollnau ein Quartierstreff entstehen. Ziel ist es, ein Ort der Begegnung und des Miteinanders für und mit der Bevölkerung zu schaffen. Besonders angesprochen werden hierbei Senior*innen, Menschen mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge, Familien und die Nachbarschaft des Hauses. Auch verschiedene schon bestehende Gruppierungen und Vereine aus Kollnau werden in diesem Haus ein Zuhause finden können. Der gesamte Prozess wird durch eine extern moderierte Begleitgruppe gestaltet und evaluiert. Durch eine niedrigschwellige Auftaktveranstaltung, Multiplikatoren und aufsuchende Werbung wird die Bürgerschaft Kollnaus frühzeitig in das Projekt eingebunden. Weitere Feste und Projektveranstaltungen sind geplant. Ein Quartierssekretariat wird die Arbeit im Stadtteil und im Treff selbst koordinieren.
Im März 2019 soll mit einer Bürgerbeteiligungsmaßnahme für Senior*innen eine zunächst auf anderthalb Jahre angelegte Maßnahme beginnen, welche die Entwicklung und Umsetzung von alters- und generationengerechten Angeboten in Weil am Rhein zum Ziel hat. Hierbei stehen neben der Angebotsentwicklung und -umsetzung auch die nachhaltige Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Akteure im Mittelpunkt. So werden von einer zunächst stadtweiten angelegten Bürgerbeteiligung quartiersbezogene Maßnahmen und Angebote entwickelt, die die gesellschaftliche Teilhabe von Senior*innen unterstützt und fördert. Der Prozess wird durch eine Lenkungsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates, Vertreter*innen des zivilgesellschaftlichen Partners sowie Mitgliedern der Verwaltung, begleitet.
In der Weiler Innenstadt soll ein BürgerTreff entstehen. Aus einer von der Stadt initiierten Zukunftswerkstatt wurde von den Bürgern der Wunsch vorgetragen, in Weil der Stadt einen BürgerTreff zu schaffen. Eine aus der Bürgerschaft entstandene Projektgruppe hat sich drei Jahre intensiv mit einer möglichen Konzeption und mit der Suche nach passenden Räumlichkeiten beschäftigt. Eine Beteiligung aller Bürger war über den gesamten Untersuchungszeitraum möglich und wurde seitens der Stadt über die Fachstelle "Bürgerschaftliches Engagement" eng bekleidet. Der zukünftige BürgerTreff in Weil der Stadt soll sich zu einem sozialen Mittelpunkt der Stadt entwickeln. Dort sollen vielfältige Beratungs- und Informationsmöglichkeiten für alle Bürger generationenübergreifend möglich sein. Der zukünftige BürgerTreff wäre eine zusätzliche Anlaufstelle für alle Ehrenamtlichen der Stadt. Jede Person oder Gruppe, die kostenfrei etwas für andere Weil der Städter anbietet, soll hierfür den BürgerTreff nutzen
Im Quartier zu Hause zu sein ist das Zusammenleben, die Begegnungen von Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Familienstands und Herkunft. Kontakte schaffen Identität.
Das Evangelische Gemeindehaus soll in Zukunft als „Gemeinschaftshaus“ fungieren, bei dem die bisherige kirchliche Trägerschaft und Nutzung in den Hintergrund tritt, stattdessen soll es als Zentrum des öffentlichen Lebens in Lützelsachsen genutzt werden. Es soll Räume für Zusammenkünfte und Veranstaltungen unterschiedlichster Art für die Bewohner*innen und Organisationen in und um Lützelsachsen bieten.
Es soll ein möglichst vielfältiges Angebot an Unterstützung, Aktivitäten und Events entstehen, das viele Bedürfnisse der Menschen in Lützelsachsen erfüllt. Menschen sollen aufgrund gemeinsamer Interessen und Angebote unabhängig von Vereinszugehörigkeit, Konfession, Milieu, etc. zusammenfinden, soziale Kontakte knüpfen und damit eine lebendige Dorfgemeinschaft bilden können.
Die zwei Aspekte des Hauses: zum einen "Vermietung" zum anderen "gemeinnützige Projekte" sollen ineinandergreifen und sich gegenseitig befruchten.
Aktuell ergibt sich eine große Chance, das ehrenamtliche Engagement der Wernauer Bevölkerung neu aufzustellen. Im inhaltlichen Zusammenhang mit dem Neubau eines Pflegeheimes mit integrierter Kita unmittelbar angrenzend an ein Neubaugebiet und ein großes Schulzentrum und auch der Nachnutzung des bisherigen Pflegeheimstandortes soll die Bevölkerung dazu ermuntert werden, Ihre Bedürfnisse für das Wohnen und Leben im Alter zu artikulieren und neue Aufgabenfelder für das Ehrenamt zu entwickeln. Durch die Teilnahme am Förderprogramm "Quartiersimpulse" soll ein starker Impuls gesetzt werden in Richtung des Ausbaus und der Schaffung schon vorhandener ehrenamtlicher und altersübergreifender Strukturen insbesondere mit Blick auf die Generation 60+. Dabei sollen auch Menschen in den Fokus genommen werden, die sich normalerweise nicht einbringen und/oder ehrenamtlich engagieren würden (Betroffene, Angehörige und Menschen mit Behinderungen).
Das Projekt soll die Möglichkeiten und die Bedeutung öffentlicher kommunaler Büchereien und Bibliotheken bei Beteiligungsprozessen in der Gemeinde entwickeln
Die Initiative knüpft mit dem Projekt an die Verbindung von Kultur, Nachhaltigkeit und globaler Verantwortung an Bestehendes an und erarbeitet mit Hilfe von öffentlichen Workshops und einer Einbeziehung unterschiedlicher Akteure der Stadt und des Stadtteils neue Chancen für die Stadt. Die Initiative erhält die Beratung für das Herausarbeiten einer gemeinsamen Vision, Formulierung einer Strategie, welche mit den vorhandenen Ressourcen in einem überschaubaren Zeitraum umsetzbar ist, aktuelle Stärken, konkretes Fassen von geplanten Vorhaben, Aktivierung von Akteuren, Risiken der Projektdurchführung und Kommunikationsstrategie.
Erarbeitung von Empfehlungen zur Bürgermitwirkung in der Kommunalpolitik
Ziel des Projektes ist es, gesunde Lebensmittel zu produzieren und die teilnehmenden Bürger/innen Wissen über Permakultur und Gartenbau zu vermitteln. Es soll eine Gemeinschaft über Generationen- und kulturelle Grenzen hinweg entstehen, die etwas für eine nachhaltige ressourcenschonende Stadtentwicklung beiträgt. Dabei steht auch die Wissensvermittlung an Kinder im Vordergrund.Die Beratung eines professionellen Gartenbauexperten gewährleistet die sachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Bebauung des 3000 m2 grossen Geländes am Rhein.
Neben diesem Gemeinschaftsgarten entstehen weitere Projekte rund um das Thema „urbane Gardening“ und essbare Stadt“, z.B. Spalierobst an der Stadtmauer.
Die Bühleninitiative ist eine Gruppe von Menschen aus unterschiedlichen Altersstufen, Lebensphasen und Berufen. Anlass für die Gründung der Initiative war die Schließung der letzten Einkaufsmöglichkeit im Viertel. Das gemeinsame Ziel ist das Viertel zu beleben, zu vernetzen und u.a. auch wieder eine Nahversorgung zu gewährleisten. Die Initiative möchte mit allen Bürgern eine gemeinsame Perspektive entwickeln, wie sie sich das Zusammenleben im Viertel vorstellen und gestalten möchten.
Die Gruppe „Gemeinsam in Stadelhofen" organisiert ein autofreies und integratives Stadtteilfest in Konstanz-Stadelhofen. Den Anwohnern und Festgästen bietet das Fest die Möglichkeit, sich auf den Stadelhofener Straßen kennenzulernen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Der entstehende autofreie Raum wird für einen Tag den Bürgern zur Verfügung gestellt. Alle Bewohner werden im Vorfeld des Fests durch eine Flyeraktion eingeladen, sich am Fest zu beteiligen. Jeder erhält damit die Möglichkeit, ein eigenes Projekt im Rahmen des Stadtteilfests vorzustellen. Dazu können die Besucher in einem „Straßenatelier" ihren Wunsch an die Stadt Konstanz richten - in künstlerischer Darstellungsform. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit für das Stadtteilfest anfallen.
Die Stadtteilvernetzer Stuttgart sind ein Forum für alle, die in Stuttgart in der Quartiers- und Nachbarschaftsvernetzung engagiert sind - ob als Freiwillige, städtische oder gemeinnütziger Mitarbeiter*innen, Gewerbe- und Handelsverband, Wirtschaftsunternehmen. Mit unseren Treffen und der alle zwei Jahre stattfindenden NetzWerkStatt bieten wir Quartiersvernetzer*innen einen Raum zum Wissensaustausch über Organisations-, Fach und Sektorengrenzen hinweg. Unser partizipativ erarbeiteter \"Werkzeugkoffer für Netzwerk- und Nachbarschaftsinitiativen im Quartier\" hilft Bürger*innen beim Aufbau und der Pflege eines stadtteilbezogenen Netzwerkes/Projektes.
Die Stadtteilzeitschrift BB-Kurier ist ein ehrenamtliches Medienprojekt im Freiburger Stadtteil Brühl. Die Zeitschrift erscheint vier Mal im Jahr und wird an insgesamt 4000 Haushalte verteilt. Der BB-Kurier sorgt für ausgewogene Stadtteilinformationen sowie die Beteiligung der Quartiersbewohner. Das Redaktionsteam, das von der Quartiersarbeit Freiburg-Brühl betreut wird, verfasst selbst Artikel und lädt weitere Bewohner des Stadtteils zum Verfassen von Artikeln oder Bekanntmachungen ein. Auch das Austragen der Stadtteilzeitschrift erfolgt ehrenamtlich. Im BB-Kurier ist Meinungsbildung und –äußerung zu verschiedenen Themen im Stadtteil möglich. Dazu dient das Projekt als Inkubator für Stadtteilentwicklungsprojekte. Die Redaktionssitzungen finden zwei bis drei Mal im Voraus des Erscheinens einer Ausgabe statt und werden partizipativ und an den Bedürfnissen und Themeninteressen der ehrenamtlichen Redakteure ausgerichtet. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für den Druck der Stadtteilzeitschrift anfallen.
Der Badisch-Kamerunische e.V. fördert vor Ort den kulturellen Austausch verschiedener Gesellschaftsgruppen. Ein Projekt sind die "Stände der Vielfalt" auf dem Forster Weihnachtszauber. Zusammen gestalten dort Asylbewerber und Vereinsmitglieder thematische Stände zu den verschiedenen Herkunftsnationen und Kulturen der in Forst untergebrachten Asylbewerber. Durch die Darbietung von traditioneller Kaffeeröstung oder spezieller Tänze werden Barrieren zwischen Asylbewerbern und Forstern abgebaut. Parallelstrukturen werden mit dieser Maßnahme aktiv bekämpft und die bekannte Veranstaltung um ein spezielles Angebot erweitert. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für den Aufbau und die Gestaltung der Stände anfallen.
Die Nachbarschaftshilfe Schlier verfolgt das Ziel alte, beeinträchtigte und alleinstehende Menschen sowie Familien darin zu unterstützen, so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung zu leben. Sie ist ein unterstützender Dienst in der Pflege und im Alltag, der auf ehrenamtlicher Basis erfolgt. Die organisierte Nachbarschaftshilfe leistet mit ihren alltagspraktischen Angeboten einen wichtigen Beitrag in der kommunalen sozialen Daseinsvorsorge in Baden-Württemberg.
Mit der Einführung der Nachbarschaftsplattform nebenan.de möchte die Nachbarschaftshilfe neue Helfer gewinnen und die Unterstützungsangebote organisieren. Darüber hinaus wird die Nachbarschaft belebt und die Gemeinschaft gestärkt durch gegenseitiges Unterstützen.
Im Zeitalter der Digitalisierung erscheint die Plattform als geeignet, um schnell und einfach in der Nachbarschaft zu kommunizieren und vor allem auch jüngere Bürger anzusprechen.
Der Verein Betreutes Wohnen Generationen Netzwerk Hohberg e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, eine stärkere Vernetzung und Kooperation bereits bestehender Pflege- und Betreuungsangebote zu realisieren. Beratung erhält der Verein zu den Fragen, was Seniorenarbeit und gute wohnortnahe Betreuungs- und Versorgungsangebote benötigen, um eine intensive und nachhaltige Zusammenarbeit aller Akteure vor Ort gewährleisten zu können.
Die Bürgergemeinschaft etabliert zur Organisation verschiedener bürgerschaftlicher Unterstützungsangebote und zur Gewinnung weiterer Helfer eine „Bürgeronlineplattform“ in Grünkraut. Damit stärkt die Gruppe die bürgerschaftlich getragenen Angebote und optimiert die Informationsweitergabe an Ehrenamtliche und weitere Interessierte in der Gemeinde im ländlichen Raum. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Einrichtung der Online-Plattform anfallen.
START vergibt Stipendien an talentierte Jugendliche mit Migrationserfahrung,
wir begleiten unsere Stipendiat*innen im Rahmen eines dreijährigen Bildungs- und Engagementprogramms in ihrer persönlichen Entwicklung und bestärken sie darin unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Hierbei bieten wir ihnen ein starkes Netzwerk, eine individuelle Betreuung und finanzielle Unterstützung. Durch Erfahrungslernen, Erlebniswerkstätten und Engagementprojekte schärfen die Jugendlichen ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten und lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Durch eine Potentialanalyse für PV fiel der Initiative auf, dass die Trinkwasserversorgung, insbesondere die Hochbehälter, aufgrund der UV-Anlagen zur Keimbeseitigung einen permanenten Stromverbrauch haben und sich für vier der Hochbehälter aufgrund ihrer Lage PV-Module zur ergänzenden Energieversorgung anbieten. Dadurch leistet das Projekt einen positiven Beitrag zum Ausbau Erneuerbarer Energien und beeinflusst positiv die CO2-Bilanz.
Ziel des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung und die Förderung der Bildung und Erziehung. Zum 10-jährigen Jubiläum ist eine Feier inklusive einem Theaterprojekt über den Integrationsweg in Deutschland geplant. Das Stück soll gemeinsam entwickelt und von Vereinsmitgliedern sowie Mitbürgern dargestellt werden. Viele Kosovaner sind in den 90er Jahren aus dem Kriegsgebiet geflohen und haben sich gut in der Stadt integriert. Sie befanden sich in der ähnlichen Situation wie die Geflüchteten heutzutage und wollen diesen Weg künstlerisch reflektieren. Beratung erhält der Verein bei der professionellen Umsetzung des Theaterstücks.
Mehrere Bürgerinitiativen haben sich zu einem Regionalbündnis zusammengeschlossen, das sich gegen den Ausbau einer Bundesstraße und für eine umwelt- und klimafreundliche Verkehrsalternative einsetzt. Ihr Ziel ist es, eine Strategie zu erarbeiten, um in eine konstruktive Diskussion mit Straßenbefürworter und weiteren Bürger für eine klimafreundliche Verkehrslösung zu kommen. Dabei sollen Visionen für eine zukunftsfähige Mobilität entwickelt und Bürgerbeteiligungsformate vorbereitet werden. In einem moderierten Workshop kommen Bürger aus den Bürgerinitiativen zusammen und bereiten einen weiteren konstruktiven Bürgerdialog vor.
Treffpunkt Freiburg e.V. engagiert sich seit 1997 als Dachverband für Engagierte, die Unterstützung in Form von Räumen, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Erfahrungsaustausch benötigen. Ziel des Projekts ist es, einen Weiterentwicklungsprozess auf der Basis einer breiten Akteursbeteiligung zu initiieren. Die Vertreter der Zivilgesellschaft, die Fachleute aus Engagementförderung und –forschung sowie die Stadtverwaltung analysieren auf der Grundlage einer Umfrage unter Vereinen und Gruppen den Unterstützungsbedarf und entwickeln bedarfsorientierte neue Engagementförderungsangebote. Der Beratungsgutschein wird für die konzeptionelle Projektentwicklung angewendet.
Durch die Initiative wird Gründung einer Organisation vorangetrieben, die den Erhalt und die Weiterentwicklung der Streuobstwiesen rund um Herbolzheim zum Ziel hat. Die Organisation ist partizipativ und auf Dauer ausgelegt, so dass ihr Bestehen langfristig garantiert wird. Durch breite Öffentlichkeitsarbeit wird das Projekt in der Umgebung bekannt gemacht, so dass es die nötige Unterstützung in Form von Flächen, Helfern und Abnehmern erhalten kann. Eine lange Kooperation mit Gemeinden, Bevölkerung und Landnutzer*innen wird dabei angestrebt. Eine Beratung erfolgt zur Projektentwicklung, -organisation und -umsetzung.
Der Initiative Zukunft Streuobst liegt der Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft insbesondere der Streuobstwiesen am Herzen. In Zeiten von Klimawandel, Insektensterben und Verlust der Biodiversität ist dies ein Beitrag zur nachhaltigen Zukunft. Die Initiative setzt sich für die fachgerechte und umweltfreundliche Pflege der Wiesen und den Streuobstbäumen ein, um den Biotop Streuobstwiese mit seiner Artenvielfalt zu erhalten.
Mit dem Projekt Streuobstpflege mit der Sonne werden solarbetriebene Geräte für die Streuobstpflege angeschafft sowie eine mobile Ladestation für die E-Geräte. Ziel ist es, effiziente und umweltfreundliche Streuobstpflege zu erreichen, Vorbild für umweltbewusstes Wirtschaften zu sein und andere Menschen bei der klimafreundlichen Streuobstpflege einzubeziehen.
Das Bürgerprojekt „Streuobsterlebnis Herrenberg“ entstand aus einem Beteiligungsaufruf der Stadt 2012. Seitdem hat das Bürgerprojekt Streuobsterlebnispfade etabliert und möchte 2016 die ersten Herrenberger Streuobsterlebniswochen durchführen. Hierbei soll zum einen ein Bewusstsein für den Wert der Streuobstwiesen und der regionalen Produkte geschaffen werden, zum anderen soll das Projekt aber auch die Vernetzung der unterschiedlichen Bürgergruppierungen vor Ort vorantreiben. Beratung erhält das Bürgerprojekt zu Marketingaspekten.
Die Slow Food Initiative ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich für eine ressourcenschonende Ernährung und den Schutz von alten Obstsorten einsetzen. In die Projektarbeit werden Kindergartengruppen, Schulklassen, andere Gruppen oder Einzelpersonen einbezogen und gemeinsam alte Baumbestände gepflegt, Streuobst geerntet, verarbeitet und neue Bäume gepflanzt. Die Teilnehmenden entwickeln ein Bewusstsein für die Natur und erfahren eine ganzheitliche Prävention durch Achtsamkeit mit sich selbst und der Umwelt. Die Teilnehmenden sind in unterschiedlichen Gruppen zu den Themen Streuobst-Produkte herstellen, Naturküche, Aufstrichkollektiv und Solarküche organisiert.
Die Südstadt Heidelberg verändert sich stark aufgrund der Entwicklung ehemaliger US-Flächen zu Wohngebieten. Die Zahl der Einwohnerschaft hat sich verdoppelt. Die Initiative Transition Town setzt sich für eine lebendige Nachbarschaft von Alt- und Neubürgern ein, die die ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit bewusst angeht, insbesondere die Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Heidelberg. Ein umweltfreundliches Quartier könnte eine bundesweite Signalwirkung auslösen und gesellschaftlichen Wandel beschleunigen. Das Potenzial besorgter und aktiver Bürgerschaft sowie notwendige Verhaltensänderungen sind Gegenstände der Beratung.
Die Bürgerinitiative Tauschhütte Waldstadt engagiert sich in unterschiedlichen Projekten und setzt sich damit für ihren Stadtteil ein. Sie bringt Menschen zusammen und fördert Nachhaltigkeit im Stadtteil. Mit dem Projekt Tauschhütte möchte die Initiative einen Ort schaffen, an dem gebrauchte und funktionsfähige Gegenstände getauscht werden können. Dadurch wird der Ressourcenverbrauch reduziert und die soziale Gemeinschaft gestärkt. Die Tauschhütte fungiert als Begegnungsort als auch als Ort für praxisorientierte Umwelt- und Sozialbildung für Kinder und Jugendliche. Hier können Kooperationspartner und die Bürgerinitiative gemeinsame Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit, Nachbarschaft und Mehrgenerationen durchführen.
Der Verein Herz-Werk e.V. plant ein nachhaltiges Pop-Up-Projekt. Der Fokus liegt auf dem Tauschen, Verschenken, Leihen und Upcycling von Gegenständen. Abgehalten werden soll dies in Form eines Tausch-Cafés, einer Upcycling-Werkstatt sowie einzelner Aktionstage wie bspw. einer Langen Nacht der Nachhaltigkeit mit Flohmarkt. Menschen aus dem Ort sowie der näheren Umgebung werden zum Aufbau und zur Ausgestaltung der Räumlichkeiten sowie zu gemeinsamen Werkstatt-Tagen eingeladen.
Der Seniorenkreis Au am Rhein möchte Themen rund um die Seniorenarbeit erarbeiten und durchführen. Dazu gilt es das bereits bestehende Angebot des Kreisseniorenbeirats auszuweiten und die Aktivitäten mit anderen Anbietern wie der Kirche, und Vereinen vor Ort abzustimmen. Beratung erhält der Seniorenkreis zur Verbesserung des Konzeptaufbaus und zur Programmentwicklung.
Das Bündnis Wir sind dran greift aktuelle Themen der ländlichen Räume in Baden-Württemberg in Tagungen auf. Mitwirkende Organisationen sind die Leader-Regionen im Südwesten, das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der evangelischen Landeskirche Württemberg, der Verband Katholisches Landvolk und der K-Punkt Ländliche Entwicklung.
Bisherige Tagungsthemen waren: Mobilität, Demokratie & Beteiligung, Gemeinwohlökonomie.
In 2022 hat die Tagung das Thema "Begegnung gestalten & Ehrenamt stärken".
Im Mittelpunkt steht die Vorstellung von Beispielen, die Menschen in ihrem Engagement stärken und dafür Begegnungsangebote als wesentliches Element verwenden.
Ein zentrales Instrument, das die Teilnehmenden in Austausch und Reflexion bringen soll,
ist die Mitgestaltung des integrativen Theaters Reutlingen "Die Tonne". Dabei werden die Zuschauenden mit Elementen zur Begegnung in das Stück einbezogen. Außerdem nehmen die Schauspielenden und die Regie auch an den Workshops und Diskussionen teil, um den Teilnehmenden Gehörtes und Erlebtes in einer Abschlussimprovisation zu spiegeln.
Das Projekt "Tiny House für Vauban als Sharing Haus für Soziales und Integration" ist ein Folgeprojekt vom Projekt "Tiny House für Vauban - zusammen gestalten". Im Erstprojekt wird bis Ende März 2021 das Grundgerüst des Tiny-Houses mit einem Tiny House Experten und geflüchteten Auszubildenden der Werkstatt P3 gebaut. Im Folgeprojekt wird das Tiny House weiter ausgebaut und verschiedene Nutzungsarten ausprobiert: als Rückzugsort, als Lernort, als Lesecafé oder Spielort, als Projektort und als Beratungsort. Zielgruppe des Projekts sind insbesondere junge Menschen mit Fluchterfahrung, aber auch andere Gruppen werden berücksichtigt. Die Nutzerorganisationen werden das Tiny House für 4 bis 6 Monate auf ihrem Gelände abwechselnd nutzen. In der Nähe des Quartiers Vauban befindet sich die Erstaufnahmestelle für Geflüchtete sowie eine weitere Flüchtlingsunterkunft. Die Initiative ermöglicht dabei die Begegnung zwischen Geflüchteten und anderen Bewohner*innen in einem attraktiven und neutralen Ort. Das Tiny House als Sharing Haus für Soziales und Integration stellt einen innovativen Ansatz für vielfältige Nutzung und Gestaltung im Quartier dar. Die Beratung erstreckt sich vom Fundraising für den zweiten Projektteil über die Konzepterarbeitung (Prüfung des Konzeptes auf Vollständigkeit) bis hin zu einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit.
Durch „Tiny unter Teck“ wird eine Tiny-House-Siedlung mit 15 Parteien entwickelt. Ziel ist ein nachhaltiges, zukunftsfähiges und erlebbares Wohnen und Leben in der dorfähnlichen Gemeinschaft. Die Beratung erfolgt zum Gruppenfindungsprozess, der Bürgerbeteiligung und der Rechtsfindung.
Realisiert wird durch das Projekt ein Quartier von Kleinwohnformen, wo Menschen verschiedener Generationen und sozialer Hintergründe gemeinsam leben können. Somit wird ein individuelles Wohnen mit gemeinschaftlichem Leben in einer dorfähnlichen Gemeinschaft ermöglicht, die zudem die nähere Umgebung integriert. Neben der Wohnmöglichkeit werden zudem gemeinschaftliche Flächen, ein Gemeinschaftshaus und eine kleine Werkstatt mitgedacht. Beratung erhält die Initiative speziell bei der Energieberatung für die fünfzehn Tiny-Häuser.
Die Initiative setzt sich in diesem Projekt für ein gemeinschaftliches Miteinander, individuelles Wohnen und das Leben in einer dorfähnlichen Gemeinschaft ein, um ein nachhaltiges, erlebbares und zukunftsfähiges Leben zu ermöglichen. Es entsteht ein Ort, an dem verschiedene Generationen, Menschen mit diversen sozialen Hintergründen in unterschiedlichen Lebensphasen gemeinsam zusammenleben können. Die Initiative erhält die Beratung und unterstützende Begleitung, um vom bisherigen Entwurfsstand in die konkrete Umsetzung zu gelangen.
Das Netzwerk Miteinander möchte einen offenen Treff mit internationalem Fingerfood als Ort der Begegnung und des Austausches für Geflüchtete, zugewiesene Personen und Einheimische in Schutterwald gründen. Es werden Events und thematische Vorträge geplant: Live Musik, ein Badischer Abend, ein Afghanischer Abend, Vorträge zu Asylrecht, Infoabende zu Fluchtprävention, Internationales kochen, Weihnachtsbacken und Erste Hilfe Schulung stehen dabei auf dem Programm.
Eine Bürgergruppe aus Isny engagiert sich für neue Ideen im Ort. Aktuell soll das historische „Appretur“ Haus wiederbelebt werden. Das Konzept für das Begegnungszentrum wird gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Gastronomie und Kultur-Boden für Veranstaltungen sind geplant. Beratung wird zu Begleitung bürgerschaftlicher Gemeindeprozesse benötigt.
Der Verein Freunde der Appretur Isny e.V. setzt sich für den Erhalt des historischen Hauses Appretur ein. Das denkmalgeschützte Gebäude bekommt als Treffpunkt für Jung und Alt eine vielfältige Nutzung unter dem Motto: „Ein Ort für alle! Gemeinschaftlich genutzt! Von vielen getragen! Heimisch werden im Appretur!“ Der Beratungsgutschein wird für die Suche nach der Rechtsform und für die Entwicklung eines Finanzierungsmodells verwendet. Die Form der Genossenschaft wird dabei geprüft. Das Haus Appretur wird mit Leben unter der aktiven Beteiligung der Bürgerschaft gefüllt.
Es handelt sich dabei um einen Folgeantrag. Die erste Bewilligung erfolgte im Oktober 2018 für die Erstellung eines Nutzungskonzepts.
Die Gruppe "Projekt Gemeinschaftshaus" erarbeitet ein Nutzungskonzept für das Gemeinschaftshaus in Türkheim, welches derzeit nur sporadisch genutzt wird und veraltete Räumlichkeiten aufweist. Mit der Beteiligung entstehen Ideen zur Umnutzung, Modernisierung und Einbeziehung der Dorfgemeinschaft und Vereine. Die Beratung erhält die Initiative für architektonische Lösungen und die klimafreundliche Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses.
„Tünews INTERNATIONAL“ ist ein Medienprojekt von und mit Geflüchteten im Landkreis Tübingen. Die Themen werden von den Geflüchteten im Projekt selbst gesetzt. Die Redaktion der „Tünews" besteht aus Redakteuren mit Flucht- und Migrationshintergrund, ehrenamtlichen Coaches sowie Hauptamtlichen zur Unterstützung. Das Medium bildet vor Ort einen Knoten in einem Netzwerk des bürgerschaftlichen Engagements, in das Verwaltung, Geflüchtete, Ehrenamtliche sowie weitere Einrichtungen einbezogen sind. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde zum Beispiel das Angebot „CoronaBreakingNews" entwickelt, das sorgfältig recherchierte Nachrichten in vier verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Arabisch, Dari/Farsi) einem Publikum mit Flucht- und Migrationserfahrung zugänglich macht. Folgende Medienkanäle werden dabei bespielt: Online (inklusive Social Media), Print und Radio. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für das technische Equipment des internationalen Redaktionsteams anfallen.
Der Verein „Jung & Alt Attraktives Dorfleben e.V. Stühlingen“ möchte eine alte Gaststätte im Ort in einen sozialen Treffpunkt und ein Mehrgenerationenhaus umgestalten. Da Mauchen sehr schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen ist, soll zudem ein Bürgerbusprojekt ins Leben gerufen werden. All dies soll mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung umgesetzt werden. Hierfür und für die Konzeptentwicklung der Gestaltung des Mehrgenerationenhauses braucht der Verein Beratung.
Zentrale Aufgabe des Arbeitskreises ist die Gestaltung des Prozesses zur Findung der gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse der Menschen (Bedarfsanalyse) und die Formulierung von zukünftigen Zielen, die das Haus für die Menschen in Buchen erfüllen. Das Ergebnis dient den Verantwortlichen der Kirchengemeinde und dem Architekten als Vorlage für den Umbau. Die Beratung erfolgt für die erfahrene und professionelle Hilfe im Arbeitskreis sowie in der Umsetzung des Projektes bei der Moderation des Ideenfestivals und bei den Ideenwerkstätten.
SoNo hat seit zwei Jahren die 24-Stunden-Betreuung der ambulanten Pflege-WG "Stochennest" für 12 Personen aus dem Ort übernommen. Verschärft durch die Pandemie zeigt sich nun, dass der Verein mit dieser Aufgabe personell und finanziell überfordert ist. Die Lösung sieht der Vorstand in einer strukturell stärkeren Verzahnung mit dem ortsansässigen Pflegedienst, der auch jetzt schon die Pflege in der WG leistet. SoNo garantiert dabei die Gründungsidee der Quartierseinbindung und bürgerschaftlichen Beteiligung, die Organisation jedoch wird auf ein breiteres und in der Verwaltung professionelles Fundament gestellt. Der Übergang erfordert vereinsrechtlich und vertragsrechtlich sowie in Anbetracht der Vorgaben des WTPG eine fachlich qualifizierte Beratung und Begleitung.
Der Bürgerverein Veringenstadt e.V. hat sich zur Absicherung der Nachhaltigkeit von Projekten und zur Stärkung des Bürgerschaftlichen Engagements gegründet. Innerhalb des Vereins ist die Engagierten-Gruppe „Veringen trifft sich“ angesiedelt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die alte Dorfschule im Ort zu erhalten und zu eine Dorftreffpunkt und Dorfladen auszubauen. Beratung erhält der Verein zu Fragen des Prozessmanagements.
Der Arbeitskreis Mobilität und Verkehr setzt sich seit mehreren Jahren für die Neuorganisation des ÖPNV ein und führt verschiedene Aktionen rund um das Thema Mobilität durch. Die Aktion „Fahr Rad“ wurde mit dem Verkehrs-Präventionspreis 2005 ausgezeichnet. Ziel des neuen Projektes „Ums Stöckle“ ist die Platzierung von Querungsmöglichkeiten, ggf. Zebrastreifen, zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs. Der Arbeitskreis erhält dafür die Fachberatung.
Die Initiativgruppe „Dorfladen Durlangen“ möchte in der Gemeinde ein genossenschaftliches Dorfladenprojekt umsetzen. In jeweils drei Arbeitskreisen arbeiten derzeit die Bürger an einem Konzept. Die Arbeitsgruppen stehen allen Interessierten offen. Eine ganzheitliche Beratung zur Erarbeitung des geplanten Konzeptes des Dorfladens erhält die Initiative vom Genossenschaftsverband, von einem Steuerbüro sowie Fachberatern für den Bereich Sortiment.
In Engstingen arbeitet eine Bürgergruppe mit mehr als 30 aktiven Personen an einem Umwelttag in der Gemeinde. Auf die Idee ist die Gruppe durch eine Veranstaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Gemeindeentwicklungsplan 2035 gekommen. In einer Bürgerwerkstatt arbeitete die Gruppe die konkrete Idee des Umwelttags mit verschiedenen Angeboten zu Themen wie nachhaltiger Mobilität, Energie oder Konsum weiter aus. Auf dem Umwelttag soll die interessierte Bevölkerung animiert werden, selbst mehr Engagement in Umweltthemen zu entwickeln oder sich bereits aktiven Gruppen im Themenfeld anzuschließen. Dazu können sich die Bürger an der Veranstaltung über bestehende Umwelt- und Nachhaltigkeitsansätze in Engstingen informieren und diese diskutieren. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten wie zum Beispiel die Raummiete finanziert, die durch den Umwelttag anfallen.
Stadtteilverein Weil am Rhein - Friedlingen e.V.


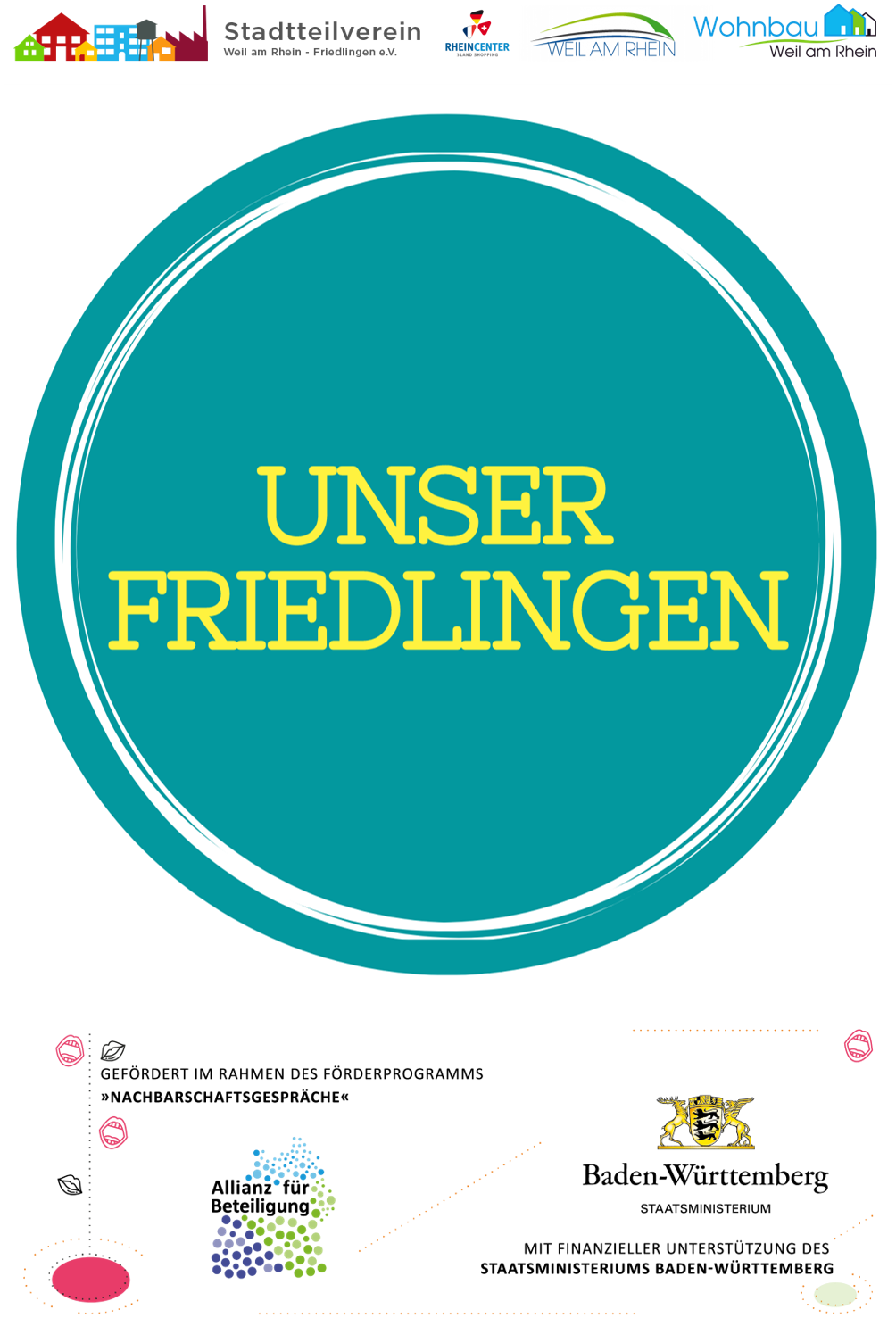

Unser Friedlingen – Einwohnerinnen im Dialog „Unser Friedlingen“ war ein Projekt, das Einwohnerinnen des Stadtteils Weil am Rhein – Friedlingen miteinander in den Dialog bringen sollte. Es sollte u.a. durch die Pandemie drohender Anonymität entgegentreten. Die Corona-Pandemie traf insbesondere den Stadtteil Friedlingen. Die Grenzlage im Dreiländereck hatte zur Folge, dass sich der Alltag durch Corona hier besonders spürbar veränderte. Grenzen, welche vor Corona kaum noch spürbar waren, schränkten plötzlich die Bewegungsfreiheit ein. Wie an anderen Orten auch, waren außerdem Treffen und Veranstaltungen nicht mehr möglich und die Lebendigkeit des Stadtteils wich einer „Lethargie“.
Es wurden trotz den Corona-Einschränkungen verschiedene Vorhaben geplant. Kernstück der Gespräche waren Orte im Freien. Sie wurden vorher bekannt gegeben und dann öffentlichkeitswirksam mit einem Lastenfahrrad angefahren. An den Orten wurden Freiluftsitzecken aufgebaut und Passanten aktiv zum Mitmachen angesprochen. Vor dem Start des Projekts wurden durch Befragungen bereits zentrale Themen herausgearbeitet, um die es dann in den Gesprächen ging. Es wurden verschiedene Methoden angewendet wie zum Beispiel ein Spiel mit extra angefertigten Themenkarten.
Da größere Veranstaltungen mit mehreren Menschen nicht mehr möglich waren, wurde versucht, Friedlinger Nachbarn durch Videoporträts vorzustellen. Diese werden nun weiter verarbeitet.
Als Treffpunkt wurde eine Urban Gardening Fläche mit dem Namen „Garten Eden – für Jeden“ genutzt. Hier treffen sich interessierte Bürger regemäßig, um diese Fläche zu bewirtschaften, sich auszutauschen und auch gemeinsame Veranstaltungen im Freien durchzuführen. Im Zuge der Nachbarschaftsgespräche werden nun Gespräche über die Errichtung weiterer solcher Flächen geführt.
Angebote in der Alten- und Behindertenarbeit, Familienhilfe.
Unter dem Projektnamen "Unser neues Quartier wächst zusammen" entsteht als gemeinschaftliches Wohnprojekt ein neues Wohnquartier auf einer Konversionsfläche in Mannheim. Die Teilnehmer*innen des Projekt sind Motor nachbarschaftlicher Prozesse und tragen zu einem nachhaltigen und sozialen Quartierskonzept bei. Zur Konfliktlösung und Entscheidungsfindung erhält die Initiative die Beratung.
Förderkreis, Freunde und Förderer für das Mehrgenerationenhaus
Gemeinsam mit vielen Akteuren im neuen Quartier der Heilbronner Nordstadt wurden Nachbarschaftsgespräche in Form von Zukunftswerkstätten durchgeführt. Per Zufallsgenerator wurden Einwohner der Nordstadt eingeladen, gemeinsam mit Stakeholdern wurden die verschiedenen Themen miteinander besprochen und bearbeitet. Dadurch wurde das Miteinander im Quartier befördert, aber auch Bedarfslücken wurden aufgedeckt und gemeinsam Lösungen dafür gefunden.
Unsere BrNachbarschaftsinitiative "Unsere Braike" Nürtingen









Die Braike ist ein Quartier in Nürtingen mit ungefähr 4.000 Einwohnenden. Immer weniger junge Menschen leben mit einer stets größer werdenden Zahl älterer Menschen im Quartier zusammen. Diese Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse und in der Regel wenig Berührungspunkte. Die Nachbarschaftsgespräche sollten dazu beitragen, dass die Quartiersgemeinschaft wieder stärker zusammenwächst. Die Gespräche fanden ihren Höhepunkt mit dem zweitägigen Braike Fest, an dem eine bunt gemischte Personengruppe zwei Tage zusammen das Zusammensein in der Braike feierte. Das Fest soll nach dem großen Erfolg zur Premiere nun jährlich stattfinden, was wiederum der Einsatz weiterer Ehrenamtlicher ermöglichen soll.
Der Mitmach-Garten Marbach ist ein offener Gemeinschaftsgarten, der ökologische und soziale Ziele verfolgt. Als Ort der Artenvielfalt, ist er genauso auch ein Ort der Begegnung, des Wissenaustauschs und des Teilens. Begleitet wird der Garten von einer Steuerungsgruppe, die größere Aktionen und Vorhaben plant und koordiniert.
Um Gartengeräte vor der Witterung zu schützen und sie dadurch langlebiger zu halten ist eine Gartenhütte geplant. Ressourcen können zudem über das Auffangen von Regenwasser über die Dachfläche geschont werden. Die Hütte wird in einer gemeinschaftlichen Aktion errichtet.
Wir wollen im Rahmen einer Genossenschaft den Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Kehl und der Umgebung Lebensmittel und Bedarfe des täglichen Lebens
unverpackt und regional anbieten. Die Umgebung der ehemaligen Martin-Luther-Kircher wollen wir zu einem Ort der Begegnung machen, in dem man regionale Speisen geniessen und verweilen kann.
Das Ziel des Projekts ist die Gründung eines umweltfreundlichen Unverpacktladens in der Innenstadt von Offenburg als Versorgungs- und Begegnungsstätte. Das Warensortiment umfasst ein Vollsortiment an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs sowie einen Non-Food-Bereich. Die Lebensmittel werden vorrangig saisonal und aus der Region bezogen, um lokale Betriebe zu unterstützen. Durch Kooperationen mit dem Seniorenbüro wird das eigentliche Ladengeschäft zur generationenübergreifenden Begegnungsstätte erweitert. Ältere Menschen können hier verweilen, ausruhen, einkaufen mit Begleitung, gemeinsam kochen nach Rezepten von der „Oma“. Qualifizierte Beratung erhält die Initiative für die Gründung einer Genossenschaft sowie für steuerliche und rechtliche Fragen rund um das Einrichten eines Unverpacktladens.
Die Initiative Unverpackt Offenburg arbeitet vor Ort an der Eröffnung eines Unverpacktladens im Stadtzentrum. Der Laden soll gleichzeitig auch die Funktion eines generationenübergreifenden Treffpunkts haben. Deswegen kooperiert die Gruppe mit dem Seniorenbüro der Stadt Offenburg. Hinter dem Konzept des Unverpacktladens steht eine heterogene Bürgergruppe, der das Thema Umweltschutz und regionale Lebensmittelversorgung am Herzen liegt. Die Idee des Ladens sowie die geplante Rechtsform als Genossenschaft wird in der Offenburger Innenstadt der breiten Öffentlichkeit an Infoständen präsentiert. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für den Druck von Flyern und Plakaten sowie weiteren Materialien zur Bewerbung des Projekts anfallen.
Im Rahmen der Agenda 2030 haben sich in Göppingen verschiedene Projektgruppen gegründet, eine davon ist die Projektgruppe Natur. Ihr Projekt Urban Gardening wurde bereits auf dem Klimagespräch diskutiert. Ziel ist es, Göppingen grüner und lebenswerter zu machen und dabei die Bürger*innen einzubinden. An verschiedenen Stellen sollen Hochbeete entstehen, die von Bürger*innen bepflanzt und gepflegt werden. Die Projektgruppe kümmert sich vorwiegend um den Aufbau der Beete und übergibt sie dann Bewohner*innen. Über das gemeinsame Gärtnern kommen Bürger*innen ins Gespräch. Ein Einweihungsfest gibt den Auftakt des Projekts.
Im Projektort Neckarbischofsheim entsteht ein touristisch geprägtes Bungalowdorf, welches generationenübergreifend als Seniorenwohnsitz genutzt wird. Die dort lebenden Menschen gestalten mittels eines Beteiligungsprozesses ihr eigenes Umfeld, indem sie sich in den Prozess der Versorgung, des kulturellen sowie sportlichen Angebots, der Verwaltung oder der Pflege einbringen. Die Beratung erhält die Initiative für einen Visionsworkshop, die Ermittlung kritischer Erfolgsfaktoren, die Finanzierung und Konzeption, sowie für das Projektmanagement, die Moderation und Kommunikationsstrategie.
Das Generationenbündnis Vellberg e.V. setzt sich dafür ein, dass Bürger möglichst lange und selbstbestimmt Zuhause wohnen bleiben können. Darüber hinaus bietet der Verein Raum für Begegnungen und Beziehungen und veranstaltet gesellige Veranstaltungen. Zur Stabilisation der Vereinsstrukturen und der Bedarfsanalyse für ein gemeinsames Netzwerk mit anderen Vereinen in der Gemeinde Vellberg erhält der Verein Beratung zu Fragen der Konzeptionierung.
Ziel des Vereins ist die gegenseitige Hilfe im Alltag für ein selbstbestimmtes Leben Zuhause. Darüber hinaus schafft der Verein einen Raum für Begegnungen und Beziehungen und bietet regelmäßige Veranstaltungen an. In einem Beteiligungsverfahren äußerten Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche zur Angebotsentwicklung. Nun sollen drei davon umgesetzt werden: zentrale Anlaufstelle für Hilfesuchende, Etablierung eines Vellberger-Sozial-Netzwerkes sowie Gründung von „Kochgemeinschaften“. Fachliche Beratung und Begleitung bei der Umsetzung werden benötigt.
fairNETZt ist eine Plattform für gesellschaftspolitisch aktive Menschen und Initiativen in Lörrach. Sie koordiniert gemeinsame Aktionen und die Zusammenarbeit verschiedener Gruppen, um den Wandel und das bürgerschaftliche Engagement zu stärken. Die Initiative möchte den in Lörrach laufenden Leitbildprozess begleiten, indem sie Impulsgeber zum Thema einlädt, die den Prozess durch theoretische Inputs untermauern sollen. So sollen Bürger, Verwaltung und Politik über das Thema Bürgerbeteiligung gemeinsam ins Gespräch kommen.
Ziel des Projektes ist es, einen Beitrag zur Mobilität als Ergänzung zum ÖPNV und allen anderen Verkehrsangeboten - auch Bürgerbussen und Taxis - zu leisten. Der ÖPNV fährt vorrangig zu Schwerpunkzeiten, eine zivilgesellschaftliche Lösung kann daher zur Verbesserung der Mobilität beitragen und die Gemeinde Hermaringen an die Zentren der Umgebung flexibler anbinden. Eine Erhöhung der Lebensqualität vor allem älterer Menschen ist damit verbunden. Der Beratungsgutschein wird für die Durchführung einer Bedarfsanalyse eingesetzt, daraufhin sollen konkrete Lösungsansätze im Brenztal gemeinsam erarbeitet werden.
Die Bürgerinitiative „Verbesserung der Nahversorgung in Kayh“ schafft eine Einkaufsmöglichkeit für Obst, Gemüse, Bachwaren und Dinge des täglichen Bedarfs. Hierzu entsteht die Gründung eines Dorfladens in Zusammenarbeit mit einem lokalen Nahversorger. Dieser Prozess erfolgt durch Begleitung der Vereinigung der Bürger- und Dorfläden in Deutschland e.V. als Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes im Bereichen der Finanzierung, der Aufbau und des Betriebs des Dorfladens. Die Beratung erfolgt zu den Themen Investitions-und Finanzierungsplanung, Auswahl der geeigneten Rechtsform, Durchführung von Veranstaltungen und Begleitung von Verhandlungen.
Gemeinsames Theaterprojekt der Schillerschule Aalen, dem Theater der Stadt Aalen, dem Haus der Jugend und weiteren öffentlichen Einrichtungen, die das Projekt unterstützen. Schüler/innen aus der Flüchtlingsklasse treffen sich in einer Gruppe regelmäßig mit Schüler/innen aus Regelklassen und aus anderen Schulen in und um Aalen, sowie weiteren Bürgerschaftlich Engagierten, um gemeinsam Theater zu spielen, dabei Deutsch zu lernen und bei der Bevölkerung inkludiert zu werden.
Die ARBES e.V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von etwa130 bürgerschaftlich engagierten Initiativen und Vereinen in Baden-Württemberg und unterstützt als Dachverband das bürgerschaftliche Engagement. Zur Weiterentwicklung der Verbandsarbeit und um weiterhin bedarfsorientierte Unterstützung den Mitgliedsvereinen anbieten zu können, erhält der Verein Beratung zur Neuausrichtung seiner Strukturen.
Der Gruppe kümmert sich um eine Ausstellung mit Fotos aus den 1930er Jahren aus dem baden-württembergischen Landesarchiv. Fokus ist das Erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus vor Ort in Bad Wildbad. Die Gruppe tritt dazu in Kontakt mit den Menschen, die etwas aus dieser Zeit erzählen können. Mit Hilfe dieser Ergänzungen findet dann in der Fußgängerzone und in der Stadtkirche in ungezwungener Atmosphäre ein Austausch über das Thema statt. Insbesondere Mittäter und Mitläufer sollen in diesem Dialogprojekt stärker in den Fokus rücken. Für deren Rolle wird ohne Schuldzuweisungen sensibilisiert. Abgerundet wird das Programm durch Vorträge, Lesungen und Filme zur Thematik.
In Ottersweier bestehen keine übergeordneten und organisierten Hilfsstrukturen für bürgerschaftliches Engagement, die sich u.a. der Kinder-und Jugendarbeit oder der Arbeit für Menschen mit Unterstützungsbedarf aller Generationen annimmt. Die Akteure vor Ort erhalten durch das Projekt die Möglichkeit der Vernetzung und der Treffpunkte sowie Begegnungsstätten. Durch die Beratung wird der Aufbau der Strukturen gefördert und die Begleitung der Beteiligung.
Der Klimaentscheid Schorndorf hat das Ziel die Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen. Durch einen Einwohnerantrag hat sich der Gemeinderat mit der Klimaneutralität befasst und den Antrag positiv entschieden. In enger Abstimmung mit der Stabstelle für Klimaschutz und Mobilität organisiert die Gruppe Veranstaltungen und treibt die Vernetzung von verschiedenen Akteuren voran. Auf Landkreis-Ebene ist die Vernetzung bereits mit anderen Klimaentscheid Gruppen erfolgt und das Ziel erreicht, dass sich auch der Landkreis für die Klimaneutralität bis 2035 ausgesprochen hat. Um auch auf der Ebene von Baden-Württemberg die Vernetzung der Gruppe zu ermöglichen ist ein Präsenztreffen mit 30-50 Personen aus den regionalen Klimaentscheid Gruppen geplant.
Der Förderverein Solar Regio Kaiserstuhl plant in Kooperation mit der klimafit-Initiative ein Projekt zur "Vernetzung Bürgerschaftliches Engagement im Klima- und Naturschutz im Landkreis Emmendingen". Beim regionalen Klimagespräch ist die Einrichtung einer Koordinationsstelle für bürgerschaftliches Engagement im Klima- und Naturschutz vorgeschlagen worden. Hier wurde Vernetzung und Austausch angestoßen, dieser soll verstetigt werden. Um eine Stelle zu implementieren werden Projektförderungen gestellt, Folge-Vernetzungstreffen, Workshop Kommunikation und Online-Fortbildungen organisiert. Bisher sind 16 Organisation für das Netzwerk im Landkreis involviert.
Die Dettenheimer Flüchtlingshilfe möchte im Rahmen verschiedener Projekte den demographischen Wandel vor Ort begleiten und erfolgreich gestalten. Durch unterschiedliche Kursangebote, Vortragsabende und Workshops für ehrenamtliche Bürger und interessierte Einwohner sollen Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten geschaffen werden. Beratung erhält die Dettenheimer Flüchtlingshilfe zur Konzepterstellung eines Beteiligungsprozesses.
Die Gruppe hat sich im Rahmen der Klimawerkstatt gegründet, um Dossenheim grüner und bunter zu machen und dabei Artenvielfalt vor Ort zu fördern. Dazu wird der Garten des Sprach-Cafés des Asylkreises als ein erstes Projekt umgestaltet. Der Garten steht der Öffentlichkeit als Ort der Meditation und Begegnung zur Verfügung und wird gemeinsam ökologisch aufgewertet. Durch Mitmachaktionen wird der Garten umgestaltet, dient als Beispiel für eine nachhaltige Gartenbewirtschaftung und als Inspiration für den eigenen Garten.
Im Frauenfreibad Lollo in Freiburg kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen muslimischen und nichtmuslimischen Frauen. Der Verein hat hierzu bereits eine Erhebung über die Ursachen unternommen. Um den Spannungen nun entgegenzutreten, möchte pro familia, die Vielfalt im Frauenbad fördern und gleichzeitig die Öffentlichkeit für Diskriminierung und den Umgang mit Interkulturalität sensibilisieren. Dazu sind Kunstprojekte geplant sowie das Empowerment von muslimischen und nichtmuslimischen Frauen.
Der Verein möchte die Vielfalt in Kehl deutlich machen und Begegnungen ermöglichen. Dazu sind Beteiligungsmaßnahmen geplant. In Arbeitsgruppen sollen Akteure der Inklusionsarbeit gemeinsam mit Geflüchteten Projekte entwickeln, die Begegnungen und Austausch in drei unterschiedlichen Sozialräumen ermöglichen. Die Ergebnisse sollen als Handlungsempfehlungen für ein vielfältiges Kehl formuliert und in einem Forum "Inklusion" mit Entscheidern der Stadt Kehl sowie Multiplikatoren_innen diskutiert werden. Die Ergebnisse sollen dann an den Bürgermeister der Stadt übergeben werden.
Als gemeinnütziger Verein engagiert sich die Allianz für WERTEorientierte Demokratie e.V. seit März 2017 für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte. Bisher führte der Antragsteller zum Beispiel folgende Beteiligungsformate in Freiburg durch: Haustür- und Marktplatzgespräche, Tag der Demokratie sowie das Freiburger Netzwerktreffen. Die Formate richteten sich bislang an ganz verschiedene Zielgruppen. Nun möchte der Antragsteller einen digitalen Jugendkonvent durchführen, da sich seiner Ansicht nach viele Jugendliche immer mehr aus konventionell geführten politischen Diskursen zurückziehen. Viele Debatten verlegen sich zunehmend in den virtuellen Raum, was Chancen und Risiken mit sich bringt. Mit Jugendlichen möchte der Antragsteller auf dem Onlinekonvent gemeinsam diesen Prozess aufgreifen und damit die demokratische Gesellschaft mitgestalten. Unter der Leitfrage: "#digitaldemocracy: Welche Veränderung der demokratischen Gesellschaft wünschen wir uns – in, durch & nach der Krise? Welche Rolle spielen dabei die Chancen & Risiken der digitalen Medien?" will der Antragsteller jungen Menschen in einem virtuellen Konvent ermöglichen, sich zu vernetzen, zu aktuellen Fragen auszutauschen & Ideen zu entwickeln. Der Konvent wird gemeinsam mit den Jugendlichen geplant und konzipiert. Wesentliches Ziel ist die positive Aktivierung junger Menschen, deren Vernetzung und das "Empowern" der Zielgruppe zur Realisierung eigener Projektideen.
Der Freundeskreis Asyl aus Gerlingen möchte seine Arbeit neu ausrichten und einen Prozess mit Beteiligung unterschiedlicher Zielgruppen (Jugendgemeinderat, Asylbewerber, etc.) zur inhaltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung des Freundeskreises durchführen. Ziel ist es, den künftigen Anforderungen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit besser gerecht zu werden und die eigenen Ressourcen optimal einbringen zu können. Beratung erfolgt zur Projekt- und Prozessweiterentwicklung.
Ziel der AG ist eine Positionsbestimmung der baden-württembergischen Volkshochschulen und damit eine deutliche Stellungnahme zur Rolle der Volkshochschulen in der Bürgerbeteiligung.
Der AK Asyl Filderstadt unterstützt in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und weiteren Akteuren vor Ort die Integration von geflüchteten Menschen. Im Arbeitskreis bringen sich Menschen mit verschiedenen Alters sowie Bildungs- und Motivationshintergründen ein. In Filderstadt führt der Arbeitskreis eine große Vollversammlung durch, um einerseits die rund 100 Engagierten zusammen zu bringen, aber auch weitere Menschen vor Ort in die Arbeit einzubinden. In einem World-Café werden aktuelle Themen diskutiert und die Arbeit des AK Asyls in der Zukunft geplant. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für das Honorar der Moderation und das Rahmenprogramm der Veranstaltung anfallen.
Der Bürgerbus Kressbronn e.V. möchte das Bürgerbusprojekt bei sich im Ort weiterentwickeln, da in der bisherigen Laufzeit u.a. neue Zielgruppen identifiziert wurden, die es fortan gilt miteinzubeziehen. Beratung erhält der Verein zu Fragen der Bedarfsanalyse, Öffentlichkeitsarbeit und Betreibermodells.
Der Freundeskreis Asyl Baiersbronn möchte einen Geflüchteten-Dialog mit dem Titel „Vom Flüchtling zum Mitbürger – Integration gemeinsam gestalten“ durchführen. Beratung erhält die Initiative zu Fragen und Organisation des Beteiligungsprozesses.
„Von Bürgerstiftung zur Mitmachstiftung – Menschen verbinden und die Zukunft in Dußlingen gestalten!“ Im Mittelpunkt des Projektes und als Ort des Mitmachens steht H13, das renovierte Fachwerkhaus. Die Bürgerstiftung Dußlingen initiiert dafür differenzierte Beteiligungsformate, um neue Perspektiven zu schaffen und den Dialog zu bereichern, inklusiv, generationsübergreifend und frei von Vorurteilen. Die ehrenamtlich getragenen und gemeinsam erarbeiteten Angebote stärken die soziale Gemeinschaft und erhöhen die Lebensqualität in der Gemeinde. Beratungsgutschein zur Konzeption und Planung der Beteiligung, zur Durchführung der Visions- und Ideenwerkstatt sowie zur zukünftigen Ausrichtung des Projektes.
Die Bürgergemeinschaft „Alter-Wohnen-Pflege“ setzt sich dafür ein, dass ältere Mitbürger auch bei hohem Pflege- und Unterstützungsbedarf, bei Demenzerkrankungen oder auch Vereinsamungstendenzen in der Gemeinde bleiben können. Das Ziel des Projekts ist es, einen bürgergestützten Quartiersprozess vorzubereiten, um ein Netzwerk an Angeboten, Diensten, Hilfen und eine betreute Wohn- und Pflegeeinrichtung zu entwickeln und umzusetzen. Der Beratungsgutschein wird für die fachliche Begleitung rund um die Projektkonzeption benötigt.
Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes in der Gemeinde Horben bei Freiburg, um den Einwohnern und Besuchern ressourcenschonende Alternativen zum eigenen PKW zu bieten. Als Inspiration dazu diente das Projekt "Vorfahrt für Jesberg e.V." - in Jesberg wurde die Mobilitätssituation analysiert und ausgehend von dieser Analyse unter Einbezug der Bürgerschaft ein ortsspezifisches Konzept entwickelt. Die Beratung wurde zur Datenerhebung und Konzeptentwicklung für ein vergleichbares Prozess in Horben genutzt.
Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes in der Gemeinde Horben bei Freiburg, um den Einwohnern und Besuchern ressourcenschonende Alternativen zum eigenen PKW zu bieten. Als Inspiration dazu diente das Projekt "Vorfahrt für Jesberg e.V." - in Jesberg wurde die Mobilitätssituation analysiert und ausgehend von dieser Analyse unter Einbezug der Bürgerschaft ein ortsspezifisches Konzept entwickelt. Dieses Prozesses soll in Horben durchgeführt werden. Die Beratung zur Datenerhebung und Konzeptentwicklung.
Ziel des Vereins ist der Aufbau und der Ausbau eines Netzwerkes für Leseförderung im Ortenaukreis. Dafür sollen zahlreiche Menschen mit und ohne Migrationshintergrund für die Leseförderung gewonnen werden. Während der Beratung wurde eine Strategien entwickelt, wie der Verein mehr Ehrenamtliche bei der Lesewelt gewinnen, einbinden, qualifizieren und betreuen kann. Der Beratungsgutschein wurde zur Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes benötigt.
Ziel des Vereins ist der Aufbau und der Ausbau eines Netzwerkes für Leseförderung im Ortenaukreis. Dafür sollen zahlreiche Menschen mit und ohne Migrationshintergrund für die Leseförderung gewonnen werden. Während der Beratung soll eine Strategie entwickelt werden, wie der Verein mehr Ehrenamtliche bei der Lesewelt gewinnen, einbinden, qualifizieren und betreuen kann. Beratung zur Entwicklung eines Konzeptes sowie der Projektumsetzung.
Seit 2005 entwickelt der Verein "Unser Netz" bedarfsgerechte Angebote für alle Generationen in der Gemeinde Lenningen. Dabei arbeitet er eng mit Kirchen, anderen Vereinen sowie sozialen Organisationen vor Ort zusammen. Mit der Zeit ist ein enges und zuverlässiges Netz der sozialen Versorgung entstanden. Gerade deshalb treibt den Verein das Thema des Miteinanders der Generationen weiter um. Mit einer Vortragsreihe zum Thema weckt Unser Netz mehr Verständnis und hofft perspektivisch auch auf noch größeren Unterstützungswillen der jüngeren Generation vor Ort. Insgesamt gibt es vier Vorträge unter anderem zum Thema „Resilienz - über Leben in schwierigen Zeiten". Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit des Vortragsprojekts anfallen.
Die Initiative erbaut ein Nahwärmenetz auf Basis einer CO2-freien Energieerzeugung in Form eines genossenschaftlichen Modells, um klimaneutrale Wärmeversorgung nachhaltig sicherzustellen. Beratung erfährt die Initiative zur Beratung einer Energiegenossenschaft, bei der Ausgestaltung einer angepassten Genossenschaftssatzung und bei der Begleitung des Prüfungsprozesses.
Die Akteur*innen des Arbeitskreises Hohbuch wirken seit Entstehung des Stadtteils Hohbuch und des später erschlossenen Schafbuchs dahin, gute Nachbarschaft und Bürgerbeteiligung unter den Bewohner*innen zu fördern. Dem stehen zunehmend das Gefühl der Überforderung vieler Bewohner*innen angesichts hoher Diversität gegenüber. Zu erkennen ist ein Generationenkonflikt zwischen einer in Teilen hochaltrigen Bewohnerschaft und der zunehmenden Zahl Studierender der Hochschule Reutlingen, sowie Verinselung und Vereinsamung. Zum einen erhält der Walter-Gropius-Platz die Funktion als zentralen Treffpunkt im Stadtteil Hohbuch/Schafstall mit der Perspektive einer attraktiven kommerziellen und nicht-kommerziellen Nutzung des Platzes. Zum anderen hilft ein mobiles Cafés dabei, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und dauerhafte Bespielung des Platzes anzuregen. Die Beratung erfolgt dazu, wie geeignete Zugänge und Maßnahmen bzgl. Methoden zur Jugend- und Bürger*innenbeteiligung, Grundsätze zur Quartiersentwicklung und Stolpersteine für die Umsetzung, entwickelt werden kann.
Das Esslinger Klimagerechtigkeitsbündnis setzt sich aus verschiedenen bestehenden Klima-Initiativen zusammen und hat die Verbesserung der Lebensbedingungen in der Stadt Esslingen zum Ziel. Sie beschäftigt sich mit der Zukunft der Stadt und möchte gemeinsam mit Bürger*innen eine lebenswerte Stadt von morgen entwickeln. Dabei spielen Themen wie Mobilität, soziale Gerechtigkeit, Ernährung, Klimaanpassung, Wohnen, Müllvermeidung u.a. eine zentrale Rolle.
Damit der Wandel zu einer lebenswerten Stadt gelingen kann, wenn Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mitwirken. Mit den Wandelabenden sollen Menschen interessiert werden an der Wandelinitiative mitzumachen. Regionale und überregional bekannte Impulsgeber*innen zeigen lokale Bezüge und Weitblicke auf.
Die Solawi Ettenheim wurde auf Initiative des LebensMittelpunkt Ettenheim e.V. gegründet und hat die Förderung einer nachhaltigen, sozialen und klimafreundlich produzierten Ernährung zum Ziel. Bei einer solidarischen Landwirtschaft wird der Erzeuger durch eine gemeinschaftliche Finanzierung vom Marktdruck befreit und ermöglicht eine nachhaltige Bewirtschaftung der Felder. Die Stadt hat der Initiative einen Acker mit Langzeitpachtvertrag zur Verfügung gestellt und die Struktur zwischen Produzenten-Verein-Mitgliedern ist aufgebaut. Über Infoveranstaltungen, einer Webseite und Kommunikationsplattformen sollen bis zu 120 Mitgliedern geworben werden.
Das Klimabündnis vereint die Organisationen wie BUND, ADFC, UNW, VCD, Fridays und Parents for Fututre und andere, um sich für die Förderung und Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zum Klimaschutz zu unterstützen. Die Bündelung des Engagements soll zu einem verstärkten Dialog mit der interessierten Bürgerschaft führen.
Als erstes Projekt des Klimabündnisses soll eine Webseite entstehen, auf der zum einen die Arbeit der Bündnis-Organisationen transparent gemacht wird und zum anderen vom Gemeinderat bereits beschlossene Klimaschutzkonzepte und Maßnahmen sichtbar zu machen. Anhand einer grafischen Aufarbeitung, wird der Erfüllungsgrad der Klimaschutzmaßnahmen deutlich in Bezug auf die Pariser Klimaschutzziele.
Der Verein plant die Entwicklung eines Theaterstücks mit Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen, die bereits Flucht und ihre Folgen erfahren haben. Eingeladen mitzumachen sind momentan Geflüchtete als auch Personen, die in Folge des Nationalsozialismus fliehen mussten. Es sollen aber auch Personen miteinbezogen werden, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Dabei sollen unterschiedliche Sichtweisen sowie Erfahrungen aus den verschiedenen Biografien miteinfließen und mit Elementen des Chors und der Bewegung dargestellt werden.
Die Corona-Kreativ-Taskforce Ostfildern entwickelt Projekte, die Corona-konform sind und Menschen u.a. aus den Religionsgemeinschaften, Mentoren für Geflüchtete und bürgerschaftlich Engagierte zusammenbringt. Auf einer Homepage hat die Initiative einen Ideenpool an Online-Spielen und Bastelideen zusammengestellt. Zu kirchlichen Feiertagen bieten sie Angebote in Form von Schnitzeljagd durch den Ort oder Aktivitäten für Zuhause.
Zur Weihnachtszeit plant die Initiative ein Bilderbuch zu entwickeln und es an Bürgern zu verteilen. Es soll aus Fotos bestehen, die in Ostfildern aufgenommen wurden und die Weihnachtsgeschichte kreativ darstellen. Ziel ist es, bürgerschaftlich engagierte Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten wie Schreiben, Fotografieren, Schauspielern, Technik zusammen zu bringen. Menschen mit Fluchterfahrung werden gezielt mit angesprochen, sich an der gemeinsamen Aktion zu beteiligen. Durch das Projekt wird der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Lebensumfeld gestärkt.
Der FC Esslingen ist aktiver Partner der Stadt im Entwicklungsprozess “Soziale Stadt“ der angrenzender Stadtteile rund um das Stadion in Esslingen-Weil. Die frisch sanierte Multifunktionshalle auf dem Gelände des Sportparks bietet neue Möglichkeiten soziales Engagement mit Sport zu verbinden. Ziel des Projektes ist es, die Sozial- und Gruppenräume in einem offenen Beteiligungsprozess inklusiv und partizipativ zu konzeptionieren und auszugestalten. Die Beratung erhält der Verein zu Beteiligung von Netzwerkpartnern, gemeinsame Arbeit von verschiedenen Generationen, Verknüpfung zur Quartiersentwicklung.
Der FC Esslingen ist aktiver Partner der Stadt im Entwicklungsprozess “Soziale Stadt“ der angrenzender Stadtteile rund um das Stadion in Esslingen-Weil. Die frisch sanierte Multifunktionshalle auf dem Gelände des Sportparks bietet neue Möglichkeiten soziales Engagement mit Sport zu verbinden. Ziel des Projektes ist es, die Sozial- und Gruppenräume in einem offenen Beteiligungsprozess inklusiv und partizipativ zu konzeptionieren und auszugestalten. Die Beratung zu Beteiligung von Netzwerkpartnern, gemeinsame Arbeit von verschiedenen Generationen, Verknüpfung zur Quartiersentwicklung.
Carsharing stellt einen Baustein zur einer umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Mobilitätswende dar. TeilAuto Schwäbisch Hall e.V. betreibt auf ehrenamtlicher Basis ein stationsbasiertes Carsharing-Angebot. Der Beratungsgutschein wird für nachhaltige tragfähige Entwicklung von Strukturen und für Professionalisierung eingesetzt. Dabei wird ein höherer Bekanntheitsgrad des Projektes und eine bessere Vernetzung in der Bürgerschaft angestrebt.
Mithilfe der Beratung wird Galgenberg aktiv weiterentwickelt, eine Gruppe aus Bürger*innen, die verschiedene Teilprojekte durchführen, um die Gemeinschaft zu stärken. Sie setzt sich für eine Stärkung des Ehrenamtes ein und inspiriert zur Mitarbeit. Die Beratung erhält das Projekt zur Organisation einer Gruppe ohne Rechtsform, zur Kommunikation, zum systemischen Konsensieren und zur Konfliktkompetenz.
Der Verein beschäftigt sich mit der Gestaltung des demografischen Wandels sowie mit dem Thema „Alterung der Gesellschaft“. Gemeinsam mit den Bürger werden aktuelle und kommende Unterstützungsangebote ermittelt und anschießend in die bestehenden Strukturen aufgearbeitet. Drei Bausteine sind vorgesehen: Unterstützung im Alter, Generationenbeziehungen, Teilhabe. Beratung wird zur Umsetzung von Veranstaltungen, zur Auswertung der Ergebnisse, zur Entwicklung neuer Angebote benötigt.
Aufbauend auf den Ideen und Anregungen des Projekts der Stadt Bad Saulgau Quartier 2030 werden gemeinsam mit den Verantwortlichen sowie weiteren Bürger*innen konkrete Handlungsmaßnahmen erarbeitet und festgelegt, inwiefern sich die Bürgerschaft in Zukunft für den sozialen und gemeinwesenorientierten Bereich einsetzen kann und wird. Beratung hierfür erhält die Initiative unter anderem für die Stärkung der Gemeinschaft, Einrichtung eines sozialen Netzwerktisches und eines Bürgerlotsen, sowie die Entwicklung von Begleit-und Unterstützungsangeboten zuhause und bei der häuslichen Pflege.
Die DENKBAR ist ein öffentliches Forum für die Bürger der Stadt Isny, mit der Möglichkeit sich am Stadtgeschehen zu beteiligen. Zahlreiche Projekte rund um die Bürgerbeteiligung wurden bisher umgesetzt. Aktuell steht das Projekt „Bürgerbeteiligung - Der Isnyer Weg“ im Fokus, um ein geregeltes und transparentes Miteinander zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern der Stadt Isny auf der Basis der gemeinsam erarbeiteten Spielregeln zu entwickeln. Beratung zu Prüfung der Wirksamkeit und die damit verbundene Weiterentwicklung des Konzepts der Bürgerbeteiligung.
Im Rahmen des Klimaforums werden konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz in der Gemeinde erarbeitet, um ein gutes Leben für Mensch und Natur jetzt und für kommende Generationen in Schallstadt zu ermöglichen. Beratung bei der Entwicklung und Organisation des Beteiligungsprozesses.
Der Verein Arche Nora wurde von alleinerziehenden Müttern zur gegenseitigen Unterstützung gegründet und hat sich über die Jahre zu einem Kinder- und Familienzentrum entwickelt. Zu ihrem Angebot gehören eine betreute Spielgruppe für Kleinkinder, Eltern-Kind-Treffs mit Themenschwerpunkten und ein Kinder Second-Hand Laden. Ein neues Angebot ist die digitale Eltern-Konferenz zum Thema Elternsein und Erziehung. In diesem Format werden Fragen und Herausforderungen der Eltern aufgegriffen, die in der Corona-Zeit stärker gefordert sind und teilweise dringende Unterstützung brauchen. Sie können sich online austauschen und vernetzen, Anregungen für ihren Alltag aufgreifen und ihre Fragen thematisieren. Mit der digitalen Eltern-Konferenz wird eine neue Form der Interaktion geschaffen, sodass im Falle eines zweiten Lockdowns, die Verbindung zu den Eltern aufrecht erhalten werden kann.
Das Welthaus-Projekt befindet sich in der Innenstadt von Nürtingen und bietet Platz für einen Weltladen und eine Weltküche, welche als Begegnungsraum für gemeinsame Kochabende, Integration und zur Gemeinschaftsbildung genutzt werden kann. Zudem bietet das Welthaus darüber hinaus auch Workshops, Besprechungen, Coachings, Lesungen und vieles mehr. Beratung erhält die Initiative zur Zusammenarbeit der beteiligten Initiativen und gemeinsamer Prozesse.
Die Initiative erhöht durch ihr Projekt die Qualität der Radinfrastruktur, indem sie sich u.a. für sichere und verkehrsarme Schulradwege, sichere Fahrradstellplätze und Bürgerbeteiligung zur Radinfrastruktur einsetzt. Darüber hinaus werden thematische Radtouren und Pannenkurse angeboten, sowie Aktionen wie STADTRADELN und Mit dem Rad zur Arbeit durchgeführt. Die Beratung erfolgt für die Pflege einer Website, den Einsatz von Methoden zur Bürgerbeteiligung, zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Datenschutz.
Das Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen setzt sich aus Mitglieder aus zahlreichen Initiativen zusammen, wie z.B. ADFC Esslingen, Fridays for Future, Foodsharing Esslingen, Bündnis Esslingen aufs Rad, Greenpeace. Das Bündnis bündelt die zivilgesellschaftliche Expertise im Bereich Klimagerechtigkeit und möchte damit die Herausforderung des Klimawandels auf kommunaler Ebene vorantreiben.
Um die Energiewende von unten voranzutreiben, haben sich zivilgesellschaftliche Organisationen wie Parents for Future und Fossil Free Karlsruhe zusammengetan und die Städtechallenge Wattbewerb/Faktor 2 entwickelt. Mit diesem Wettbewerb sollen Anreize geschaffen werden, den Ausbau von Photovoltaik voranzutreiben, um die Energiewende zu beschleunigen. Die Stadt Esslingen nimmt an diesem Wettbewerb teil. Das Klimagerechtigkeitsbündnis möchte dazu beitragen, dass die Beteiligung der Stadt Esslingen erfolgreich wird.
Die Werkstatt möchte Menschen mit und ohne Migrationserfahrung zusammenbringen und gemeinsam die Frage diskutieren: "Wie wollen wir wohnen?". Dabei sollen Beiträge zu Wohnformen, Stadt- und Quartiersentwicklung und Zusammenleben gesammelt und diskutiert werden.
Allianz für WERTEorientierte Demokratie setzt sich für die Erhaltung und Stärkung demokratischer Werte ein. Ihre Zielgruppe ist dabei sehr vielfältig und ebenso die Formate wie z.B. Tag der Demokratie, Demokratiekonvent, Jungedkonvent #digitaldemocracy. Ziel ist es durch Dialogbereitschaft der jeweiligen Parteien zu mehr Engagement in der Gesellschaft, interkulturellem Austausch, Toleranz und verstärkter Bürger*innenbeteiligung zu kommen.
Die Veranstaltung WERTE WÄHLEN: In welchem Deutschland wollen wir leben? hat das Ziel Aktivierung und Partizipation der Bürger, Stärkung der Selbstwirksamkeit, werteorientierten Dialog zwischen Bürger und Politik, Entgegenwirken der gesellschaftlichen Spaltung, Extremismus und Politikverdrossenheit. Das Konzept sieht vor, die Bürger in den Fokus zu stellen, die Politik nimmt die Vorschläge entgegen, stellt Verständnisfragen und ist angehalten keine Parteiwerbung zu machen.
Die Initiative führt eingängige Experimente mit ökologischen Zusammenhängen durch, die Kinder und Jugendliche an die Themenbereiche Energiebeschaffung und Energieeinsparen heranführt. Durch viele kleine, lokale Aktionen wird somit vermittelt, dass jede*r etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Weitere Themen der Reihe sind u.a. "Hilfe zur Selbsthilfe" in Entwicklungsländern und der Einsatz eines Solarkochers.
Der Begegnungsraum betreibt eine Begegnungsstätte, in der durch Aktivitäten Austausch und Vernetzung zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten ermöglicht wird. Ziel ist es, ein Stuttgart zu gestalten, in dem Vielfalt solidarisch gelebt wird und Zugewanderte sich schnell heimisch fühlen und Alteingesessene und Zugewanderte von einander lernen können. Um nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie den Raum wieder zu beleben, ist eine Werbekampagne und eine Kick-Off Veranstaltung geplant. Hier geht es um ein Kennenlernen, Ideenaustausch und -entwicklung. Geplant sind Dialogveranstaltungen zu kulturellen und politischen Themen, Infoabende, Kreativangebote, Diskussionsforen, Open Spaces etc.
Die Stadtgestalterei ist im Rahmen eines integrierten Stadtenwicklungsprozesses mit verschiedenen Projektgruppen entstanden. Die Projektgruppe Freibad Wiesensee setzt sich zusammen mit anderen Vereinen für den Erhalt des Freibads ein. Mit einem Aktionstag zur Saisoneröffnung möchten sie die Bürgern über das Freibad und den See als Naherholungsgebiet und seinen Erhalt informieren. Vereine können sich mit Informationsständen, Mitmachaktionen, Ausstellungen, Spiele und Wettbewerben einbringen und damit auf das Thema auf ihre Weise aufmerksam machen.
Das Stadtteilprojekt "Wir für Freiberg" ist im Februar 2022 mit dem Ziel gestartet, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Wertschätzung der Vielfalt im Stadtteil zu stärken, indem bestehende soziale Strukturen und Begegnungsmöglichkeiten unterstützt und ausgeweitet werden.
Dabei wollen zum einen die Wünsche und Anliegen aller Anwohner*innen erfahren und verstehen, was das Leben in Freiberg für sie noch lebenswerter machen würde. Zum anderen setzen wir uns für die Vernetzung zwischen allen aktiven Trägern im Stadtteil und für einen regelmäßigen Austausch - über spezifische Zielgruppen hinweg - ein.
Das Projekt wird vom Deutschen Hilfswerk gefördert, Kooperationspartner*innen sind u.a. die FLÜWO Stiftung, die Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. und Integrative Wohnformen e.V.
Bereits 2015 wurde das Projekt „Wir für Nehren – das Gasthaus bleibt im Dorf!“ als Leuchtturm der Bürgerbeteiligung ausgezeichnet. Mittlerweile wird das Dorfgasthaus in Form einer Bürgergenossenschaft gepachtet und betrieben. Das denkmalgeschützte Haus wurde von der Kommune aufwändig saniert. Das Gasthaus Schwanen ist zu einem Ort für Begegnungen und zum sozio-kulturellen Mittelpunkt des Dorfes geworden (Gaststätte, Hotel, Veranstaltungsort). Der Beratungsgutschein wurde für die Gründung einer Genossenschaft, für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit genutzt.
Das Projekt stärkt die Eisentaler Gemeinschaft und Infrastruktur hin zu nachhaltigen, klimafreundlichen Lebensbedingungen. Insbesondere steht hierbei die Umnutzung des ehemaligen Gasthauses Weinberg im Fokus, sowie Jugendprojekte, konkrete Klimaprojekte und die Stärkung des Ehrenamts. Die Beratung erfolgt zur Prozessbegleitung des Beteiligungsprojektes, zur Moderation und zur Entwicklung der Initiative zu einem Team.
Der Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel möchte mit dem Projekt „Wir gestalten Zukunft“ eine Strategie erarbeiten, die über die Einbindung möglichst vieler Menschen zukunftsfähige Strukturen für den Verein als Teil der Gesellschaft aufzeigt. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit sollen Konzepte für Kooperationen und Synergien entwickelt werden. Beratung erhält der Verein zum Prozessmanagement.
Das Projekt „Wir in Umkirch“ startete mit dem Ziel der Schwächung des bürgerschaftlichen Engagements nach der Corona Pandemie entgegenzuwirken. Das hat zunehmend Auswirkungen auf das soziale Zusammenleben in der Gemeinde. Besonders stark spüren dies aktuell die Vereine, die Schwierigkeiten haben bisher jährlich ausgerichtete gemeinsame Aktionen auf die Beine zu stellen. Die Beratung wird für einen Prozess zur Stärkung des Wir-Gefühls, zur Förderung und der Verbesserung der Zusammenarbeit der Engagierten in Umkirch sowie zur Motivation von bisher nicht Aktiven im Ort in Form von Bürgerworkshops genutzt.
Der Verein Duha begleitet Menschen mit Behinderung, damit sie ein selbstbestimmtes und autonomes Leben in der Gesellschaft führen könnten. Mit unterschiedlichen Angeboten ermöglichen sie eine gleichberechtigte Teilhabe und beraten und begleiten dabei kultursensibel. Das Thema Klimaschutz möchte Duha mit ihren Klient*innen vertiefen und niedrigschwellig erklären, wie wir gemeinsam das Klima schützen können. Gemeinsam mit einem Referent*in wird ein Workshop zum Gärtnern angeboten und dann in die Praxis eingestiegen. Schon bestehende Hochbeete können dafür verwendet werden, repariert und neu bepflanzt und gestaltet werden. Bürger*innen und ehrenamtliche Helfer*innen werden eingeladen den Gemeinschaftsgarten zusammen zu gestalten und dabei ins Gespräch zu kommen.
Der Türkische Arbeitnehmerverein Herrenberg hat Seminare mit Politikern und Parteien aus der Region durchgeführt, um Migranten darüber zu informieren, auf welchen lokalen politischen Entscheidungsebenen sie Einfluss nehmen können.
„Wir sind da“ ist eine Jugendinitiative des Freundeskreises Flüchtlingshilfe in Böblingen. Die Gruppe plant Nachmittagstreffen mit themenbezogenen Vorträgen im Rahmen des Café Culturé durchzuführen, um aktive Mitglieder aus Afghanistan, Gambia und Syrien zu stärken und ihnen eine Stimme zu geben. Es soll dabei um Themen wie Schulsystem, Gesundheitsvorsorge, Wohnen usw. gehen und vor allem um den Abbau von Vorurteilen zwischen den Geflüchteten und den Einheimischen. Konkrete Handlungsvorschläge werden in diesen Nachmittagen gemeinsam erarbeitet und an die Kommune weitergeleitet. Die Initiative erhält eine Prozessberatung und fachkundige Unterstützung in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit.
Aus dem Muhajer Cafè Asyl ist eine Gruppe aktiver Jugendlicher hervorgegangen, die sich regelmäßig trifft und sich „Wir sind da“ nennt. Die Gruppe besteht aus Geflüchteten aus Böblingen und Sindelfingen. Sie hat eine Jugendkonferenz in Sindelfingen und Böblingen zum Thema „Demokratie und Integration: Wie wollen wir zusammen leben?“ durchgeführt.
Der Regionalentwicklungsverein Donau(T)Raum Oberschwaben unterstützt die Strukturentwicklung im Ländlichen Raum. Der Verein stellt selbst Fördermittel zur Verfügung und engagiert sich im Rahmen von Netzwerken und Beteiligungsformaten vor Ort. Gemeinsam mit weiteren Partnern bietet der Verein die Tagung "Wir sind dran die Zukunft zu gestalten! - ökonomisch, ökologisch und sozial" im Kloster Heiligkreuztal an. Der Fokus der Tagung liegt auf der Frage, wie eine enkeltaugliche Zukunft im ländlichen Raum mitgestaltet werden kann. In verschiedenen Formaten in den drei Themenblöcken Wirtschaft/ Unternehmen, Bürgerschaftliche Initiativen/ Kommunen und Landwirtschaft wird an der Frage gearbeitet. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die für die Vergütung der Referenten anfallen.
Das Netzwerk "Willkommen Lauterbach" möchte durch ein Kunstprojekt die Gestaltung der Schulfassade mit einer integrativen Weltkarte durch die Lauterbacher Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund gestalten lassen. Begleitend sind sportliche Aktivitäten mit verschiedenen länderspezifischen Spielen geplant. Das Ergebnis soll auf die Schulwand gesprayt werden und ist durch die Lage der Schule gut im Ort für alle BewohnerInnen sichtbar.
Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit erfordert mehr Beteiligung der Jugend. Zukunftsfähigkeit ist eine Frage der Partizipation.
wirundjetzt hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in der Region Bodensee-Allgäu-Oberschwaben zu fördern und Menschen zu begeistern, selbst Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu übernehmen. Wir klären auf, vernetzen Interessierte, realisieren und stoßen konkrete Projekte an. Wieso der Name wirundjetzt? Wir sind als mündige Bürger die Akteure der Gesellschaft und Jetzt ist die Zeit, unsere Region und unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Wir definieren uns mittlerweile als Beziehungsnetzwerk, denn durch gelingende Beziehungen können wir gemeinschaftlich, aktiv und mit positiver Vision unsere Zukunft gestalten. Ein Leitmotiv das uns bewegt und begleitet ist die Kooperation statt der Konkurrenz!
Der Verein Nachhaltige Zukunft Waldstetten e.V. plant in Kooperation mit dem Dorfverein Wissgoldingen e.V. eine umfassende Veranstaltung zum Thema Klimaschutz. Zum Auftakt der breit aufgestellten Veranstaltung wird es einen Vortrag eines Klimaforschers mit anschließender Podiumsdiskussion geben. Darüber hinaus wird es Angebote auf einem Markt der Möglichkeiten geben. Dazu gehören ein Kinderprogramm zum Thema Nachhaltigkeit, eine Energieberatung sowie Tipps zu unterschiedlichen klimarelevanten Themen. Zudem sollen Insektenhotels gebaut und der alte Schulhof der Grundschule zu einem nachhaltigen Treffpunkt umgestaltet werden.
Der AK Asyl plant in der Kooperation mit der Gemeinde ein Beteiligungsformat für alle aktiven Helfer. Die bisherige Arbeit des Helferkreises soll dabei analysiert werden. Die zukünftige Arbeit wird auf Basis der Analyse neu ausgerichtet, um die integrative Wirkung der Angebote des Arbeitskreises zu verbessern. Beratung in Form der Prozessbegleitung (Planung + Moderation)
Vor allem ältere Menschen sind vom demografischen Wandel betroffen, da sie immer weniger auf familiäre Unterstützung zurückgreifen können. Generationsübergreifendes Wohnen, bezahlbarer Wohnraum, Barrierefreiheit und Stärkung sozialer Netzwerke sind heutzutage zentrale Ziele der städtischen Sozialpolitik. Zivilgesellschaftliches Engagement schafft Impulse für neue Formen des Zusammenlebens in Verantwortungsgemeinschaft. Beratung zur Gestaltung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sowie zur Stärkung von sozialen Strukturen und Teilhabe im Stadtteil wird benötigt.
Der Lindenhof e.V. als Initiative für eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz wurde von der Stadt eingeladen bei der Entwicklung vom gemeinschaftsorientierten und generationsübergreifenden Mehrgenerationenwohnen mitzuarbeiten. Das neue Wohnprojekt soll wechselseitige Hilfe und Unterstützung für das Haus selbst und für das Quartier ermöglichen. Der Beratungsgutschein wird für die fachliche Expertise rund um die Entstehung der neuen Wohnform benötigt.
Der Arbeitskreis „Miteinander Helfende Hände“ aus Oberreichenbach hat sich zum Ziel gesetzt, generationenübergreifend ein lebenslanges Wohnen in der Gemeinde zu ermöglichen. Um ein adäquates Konzept hierfür zu entwickeln, findet ein großer Beteiligungsprozess statt, in welchem über die mögliche Form diskutiert wird. Beratung benötigt der Arbeitskreis zu den Fragen: Wie kann das Ziel des Projekts, ein lebenslanges Wohnen in Oberreichenbach, am besten umgesetzt werden? Welche Alternativen gibt es und was wären die nächsten Schritte?
Das Ziel des Projektes ist die Realisierung eines genossenschaftlich organisierten gemeinschaftlichen Wohnprojektes in Schorndorf. Dabei wird der Wohnraum für Menschen jeden Alters mit einer integrierten ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaft geschaffen, die dem gesamten Quartier und der Stadtgesellschaft zugutekommt. Eine Kantine, ein Gästehaus, Coworking Space für Kleinunternehmen und StartUps, Mobilitätsangebote mit Carsharing, Fahrrädern, Lastenrädern sowie weitere Angebote im Sinne der Shared Economy gehören ebenfalls zum Konzept. Das Projekt wird unter Beteiligung der Nachbarschaft, relevanten Akteuren des Quartiers und der Stadtgesellschaft entwickelt. Beratung erhält die Wohnprojekt-Initiative RemstalLeben zur Gründung einer Wohngenossenschaft.
Die Wohnprojekt-Initiative möchte das erste genossenschaftliche organisierte gemeinschaftliche Wohnprojekt in Schorndorf umsetzen. Die Kernidee ist, dass das gemeinschaftliche Wohnprojekt in ein lebendiges, vernetztes Quartier eingebunden ist und mit Aktivitäten und Angeboten in das Quartier und die Stadt hinein wirkt. Das Projekt ist im Netz der Internationalen Bauausstellung und hat zum Ziel IBA-Quartier oder IBA-Projekt zu werden. Konzeption, Organisationsstruktur, Planung und Umsetzung der Angebote werden in einem vielfältigen Beteiligungsprozess mit den künftigen Bewohnern und Nutzern, der Nachbarschaft und relevanten Akteuren entwickelt. Ein vorhandenes, denkmalgeschütztes Gebäude wird saniert und klimaneutrale, bezahlbaren Wohnungen gebaut.
Um Netzwerkpartner und Akteure bei der Konzeptionierung und Umsetzung einzubinden sind Veranstaltungen geplant, wie z.B. Nachbarschaftsgespräche, Quartiersversammlungen, Interessenten-Treffen, Arbeitsgruppen.
Das Ziel des Projektes ist die Realisierung eines genossenschaftlich organisierten gemeinschaftlichen Wohnprojektes in Schorndorf. Dabei wird der Wohnraum für Menschen jeden Alters mit einer integrierten ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaft geschaffen, die dem gesamten Quartier und der Stadtgesellschaft zugutekommt. Eine Kantine, ein Gästehaus, Coworking Space für Kleinunternehmen und StartUps, Mobilitätsangebote mit Carsharing, Fahrrädern, Lastenrädern sowie weitere Angebote im Sinne der Shared Economy gehören ebenfalls zum Konzept. Das Projekt wird unter Beteiligung der Nachbarschaft, relevanten Akteuren des Quartiers und der Stadtgesellschaft entwickelt. Beratung erhält die Wohnprojekt-Initiative RemstalLeben zur Gründung einer Wohngenossenschaft.
Die Initiative Wohnen mit Anschluss hat sich aus dem Ideenwettbewerb Quartier 2020 der Stadt Ostfildern entwickelt. Bürgern haben sich hier zum Thema alternatives und gemeinschaftliches Wohnen zusammengeschlossen. Die Bürgerinitiative arbeitet an der Umsetzung eines Mehrgenerationen-Wohnprojekts mit gemeinschaftlichen und bezahlbaren Wohnformen. Ihr Ziel ist es, Vereinsamung entgegen zu wirken, Versorgung der wachsenden Gruppe Älterer zu gewährleisten und die Freude am Engagement und der Gemeinschaft erlebbar zu machen. Um weitere Mitwirkende und Bewohner zu finden, setzt die Initiative auf eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit.
Die Bürgerinitiative "Wohnen mit Anschluss" arbeitet an der Umsetzung eines Wohnprojekts mit dem Wunsch und Ziel, gemeinschaftliche Wohnformen in Form von bezahlbarem Wohnraum in Mietwohnungen oder auch Miet- und Eigentumswohnungen als Mehrgenerationenwohnungen in Ostfildern zu schaffen. Zur Begleitung der Umsetzung des Wohnprojekts erhält die Initiative weitere fachliche Beratung zu den Themen Projektfinanzierung sowie dem baulichen und organisatorischen Rahmen, um als Projektgruppe Gemeinschaft und solidarische Lebensformen entwickeln und praktizieren zu können.
BruderhausDiakonie Stiftung Gustav Werner und Haus am Berg
Das Quartier um die Karl-Olga-Altenpflege liegt im Stuttgarter Osten und bietet seit 1994 bedarfsgerechte Wohn- und Unterstützungsleistungen für Senioren. Im Zuge des Projekts wurden die Bewohner im Quartier eingeladen, sich mit ihrem Umfeld auseinanderzusetzen. Ziel war es, das Zusammenleben bedarfsorientiert zu gestalten. Dies sollte geschehen, indem soziale, kulturelle und generationenübergreifende Vernetzungs- und Angebotsstrukturen im Quartier geschaffen werden.
Der Verein „Flurstück 277" umfasst eine Gruppe von Menschen, die sich mit einem Areal nahe des Freiburger Hauptbahnhofs beschäftigt, in dem derzeit unter anderem die Szenediskothek „Crash" untergebracht ist. Mit Anwohnern hat die Gruppe in Workshops bereits an Ansätzen gearbeitet, wie das Gelände mit Nutzungen für Kleinkultur, geförderten Wohnbau oder Kleingewerbe ausgestaltet werden könnte. Diese ersten Ideen für das „Flurstück 277" möchte die Gruppe mit Interessierten aus dem Quartier nun in Informationsveranstaltungen und Workshops weiter ausarbeiten und diskutieren. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für das Catering bei Veranstaltungen und Workshops anfallen.
Der Verein greift den Wunsch der Bürger nach lebenslangem Wohnen in ihrem Stadtteil auf und plant die Gründung einer Seniorenwohnanlage mit verschiedenen Angeboten und einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz im Quartier Weststadt. Beratung wird zu Organisationsstrukturen, Einbindung im Quartier, Auswahl der Mietergemeinschaft und Angestelltenteams benötigt.
Die WohnWerkstatt möchte in Konstanz ein generationsübergreifendes, gemeinschaftliches Wohnprojekt realisieren. Die Kleingruppen haben sich bereits intensiv mit Wohnformen und Grundrissen auseinandergesetzt und ein Konzept für das gemeinschaftliche Wohnen entwickelt. Ziel der Initiative ist es, Angebote für das ganze umgebende Quartier zu schaffen. Beratung zu Analyse von Bedarfen im Quartier und Entwicklung von Ideen, die umsetzbar und integrativ sind sowie einen Mehrwert für das Quartier und die Stadtgesellschaft haben.
WOLKE ist eine Initiative für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt, die auf einem Grundstück in einem neuen urbanen Wohnquartier "Kleineschholz" in Freiburg das zukünftige Wohnkonzept entwickeln. Die Umsetzung erfolgt hierbei durch wöchentliche Treffen der 50 Personen, sowie regelmäßigen Wochenend-Workshops und die Beratung von zwei Berater*innen. Die Beratung erfolgt bei den Themenfeldern der partizipativen Entscheidungsmodelle, der Moderation von Gruppenentscheidungen, die Organisationsentwicklung i.S. agiler interner Arbeitsstrukturen und der Einbindung/Inklusion benachteiligter Gruppen.
Durch das Projekt wird der Tag der Nachbarschaft aus dem Jahr 2023 wiederholt und breiter aufgestellt. Durch einen Workshop entwickelt die Initiative eine Stärkung des gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Miteinanders sowie die Vernetzung in den Quartieren. Die Beratung erfolgt zu den Formaten der Quartiersprojekte, Erlernen von Kommunikationsstrategien und Strukturierung des Prozesses.
Die Initiative Murg im Wandel möchte die regionale Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen intensivieren und in Form eines Vernetzungsworkshops besser strukturieren. Dadurch sollen Synergieeffekte erzielt und Ressourcen im ländlichen Raum gebündelt werden. Die bereits bestehende Vernetzungsarbeit soll so erweitert, fortgesetzt und gestärkt werden.
Das Deutsch-Türkische Forum Stuttgart (DTF) fördert als Bürgerinitiative die Begegnung und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschen und in Stuttgart lebenden türkeistämmigen Menschen. Ein Angebot des Vereins ist das Stipendien- und Mentoringprogramm „Ağabey-Abla". Auf Basis der Idee des Vorbildlernens unterstützen Mentoren im Programm junge türkeistämmige Stuttgarter in ihrer schulischen und persönlichen Entwicklung. Zur Schulung der Mentoren führt der Verein ein Workshopwochenende für die Mentoren durch, um sie von professionellen Referenten schulen zu lassen. Dazu wird vor Ort das Kennenlernen und Netzwerken der Mentoren gezielt gefördert. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für das Honorar der Referenten anfallen.
Selbstbestimmt lernen für die Gesellschaft - die Welt für morgen verbessern.
Zahra Magazin ist ein Magazin von Mädchen für Mädchen. Es ist eine Plattform für die jungen Korrespondentinnen und Botschafterinnen gegenüber Publikum. Für das Zahra-Team werden verschiedene Workshops und Aktionen während des Schuljahrs angeboten. Die gedruckte Ausgabe erscheint jährlich im Oktober. Die Beratung bekommt der Verein zu strategischer Entwicklung, zu Social-Media-Design und Filme machen sowie zu Teammanagement. NISA Frauenverein e.V. hatte im Rahmen von „Gut Beraten!“ ein vergleichbares Projekt in Sindelfingen erfolgreich durchgeführt.
Das interkulturelle Redaktionsteam des Zahra Mädchen Magazins besteht aus Mädchen im Alter von 10-18 Jahren aus acht verschiedenen Herkunftsländern. In zehn Monaten lernen die Mädchen verschiedene Textdarstellungsformen (Portrait, Artikel, etc.) kennen. Dazu setzen sich die Mädchen mit verschiedenen Lebenshintergründen durch die Arbeit mit den anderen Teilnehmerinnen auseinander. Durch eigene Artikel zum Beispiel zur Kultur des Herkunftslands werden die Mädchen zu Botschafterinnen vor Ort. Sie leisten damit einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung. Mit dem Beteiligungstaler werden Druckkosten sowie das Honorar für eine Fachperson für das Magazinlayout finanziert.
Der Nisa Frauenverein aus Holzgerlingen möchte mit einer Gruppe junger Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund anhand eines Medienblogs den interkulturellen Austausch und das soziale Miteinander fördern. Beratung erhält der Verein zum Ausbau der Medienkompetenz, zur Erstellung des Jugendblogs und zu Maßnahmen zur Stärkung der Gruppendynamik.
Zaungäste ist ein soziokulturelles Projekt von Haus der Begegnung, Projektwerkstatt Kubus 3 und der Netzwerkgruppe KunstLandWasser. Die Netzwerkgruppe besteht aus kunstinteressierten und kunstschaffenden Bewohner*innen des Stadtteils Landwasser, sie übernimmt die inhaltliche Ausrichtung des Projekts. Die beiden anderen Projektpartner übernehmen die künstlerische und pädagogische Begleitung.
Der Abriss eines Einkaufszentrums im Stadtteil Landwasser reißt eine große Lücke in das Quartier, von der auch soziale Beziehungen betroffen sind, da Räume für Begegnung wegfallen. Für die Projektgruppe ist der Zaun Zeichen für Begrenzung und Absperrung, auch in Bezug auf Kultur und Miteinander. Die Projektgruppe Zaungäste inszeniert zusammen mit den Bewohner*innen ein Stück vom Bauzaun als Ort der künstlerischen Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Thema Ausgrenzung/Begrenzung. Vor Ort finden dazu Aktionen, Ausstellungen und Gespräche mit den Bewohner*innen statt.
Das Konzept ZEITBANKplus versteht sich als Initiative zur Sicherung und Förderung der Lebensqualität. Zeitgutschriften ermöglichen es, dass gegenseitiges Vertrauen entsteht und die Anonymität vor Ort abgebaut wird. Jeder kann helfen und kann Hilfe erhalten, womit das ehrenamtliche Engagement in Grenzach-Wyhlen und Rheinfelden gestärkt wird. Die Beratung erfolgt zu allgemeines Fragen des ZEITBANKplus-Modells und dem Aufbau des Netzwerks.
Der Arbeitskreis Zeitbankplus Sozialgemeinschaft Villingendorf möchte in der Gemeinde einen ZEITBANKplus Verein gründen, zur Verbesserung des sozialen Miteinanders vor Ort. Weiter soll der Verein dazu beitragen die Pflege von nachbarschaftlichen Beziehungen und Hilfestellungen zu befördern, so dass vor Ort eine wertschätzende Haltung und Solidarität mit hilfebedürftigen Menschen entsteht. Beratung benötigt der Arbeitskreis zur Initiierung eine ZEITBAKplus Vereins.
Die "Steuerungsgruppe ZeitbankPlus Karlsruhe" stärkt den sozialen Zusammenhalt, indem sie Jung & Alt zusammenbringen und die Möglichkeit schafft, dass sich diese gegenseitige Unterstützung bieten. Hierzu wird der Austausch in der Gemeinschaft, das Miteinander und das gegenseitige Geben und Nehmen gestärkt und ausgebaut. Die Beratung erfolgt zu allgemeinen Fragen zur ZEITBANKPlus, zu Zielen und Strukturen, zur Nutzung des EDV Programms und zur Kommunikation und Vernetzung über den örtlichen Verein hinaus.
DIE ARCHE, Förderverein für gemeinschaftliches Wohnen aus Waldkirch, möchte das „ZeitbankPLUS-Modell“ in ihrer Gemeinde einrichten, um die gegenseitige Unterstützung in der Gemeinde zu (be)stärken.
Das Zeltlager Baltersberg ist eine inklusive Sommerferienfreizeit in Bodnegg. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von zehn bis sechzehn Jahren - unabhängig von deren Herkunft, Geschlecht oder körperlicher oder geistiger Behinderung. Themen wie Interkulturelle Kompetenz, Diversität oder Mitbestimmung sind Teil des Programms der Freizeit. In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Kultureinrichtungen sowie der Integrationsbeauftragten des Landkreises Ravensburg werden Teilnehmer gezielt angesprochen, denen aufgrund von verschiedenen Hürden ein vergleichbares Angebot bisher nicht gemacht werden konnte. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für die Einrichtung der Infrastruktur des inklusiven Zeltlagers anfallen.
Beteiligung Älterer vor Ort. Gute Beispiele und wirksame Methoden - Kommune gemeinsam gestalten
Der Verein organisiert verschiedene Zirkusprojekte, Kurse und Aufführungen für Kinder, Jugendliche und Familien. Neben wöchentlichen Kursen werden in den Ferien die Freizeiten für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren durchgeführt. Hier lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur artistische Fähigkeiten, wie Akrobatik und Balance Techniken, sondern entdecken auch eigene neue Talente, werden Selbstbewusster und Mutiger. Dabei steigen ihr Verantwortungsbewusstsein für sich und andere sowie die Fähigkeit mit anderen zusammen zu arbeiten. Ein besonderes Anliegen des Vereins ist es, dass bei allen Projekten jede*r teilnehmen kann. Kinder mit Behinderung, Migrationshintergrund oder speziellem Betreuungsbedarf finden ihren Platz, erleben eine ganz besondere Zeit und lernen miteinander ihre Zeit zu gestalten. Die Aufführungen sind ohne Eintritt und für ein breites Publikum jederzeit zugänglich.
Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Konzepts zur Durchführung eines Bürgerbeteiligungsprozesses für altersgerechtes und generationsübergreifendes Wohnen in Seebronn. Die Bürgerschaft, bestehende Initiativen, Institutionen, Vereine und Einrichtungen werden in den Prozess aktiv eingebunden. Bisher standen zwei Themen im Fokus: Kinderbetreuung und Nahversorgung. Das „Kinderhaus Seebronn“ und der „Dorfladen Seebronn“ befinden sich derzeit in der Umsetzung. Nun wird das Thema „Zuhause in Seebronn“ priorisiert. Die Kommune stellt ein Grundstück in der Dorfmitte für ein alters- und generationengerechtes Wohnen zur Verfügung. Die Initiative erhält fachliche Begleitung für die Erstellung eines Quartierskonzepts.
Zuhause leben e.V. bietet im Gebr. Schmid Zentrum in Stuttgart-Heslach Menschen mit Behinderung und Angehörigen Beratung und Begleitung, ehrenamtlich, für ein selbststimmt eigenständiges Leben.Zuhause leben e.V. setzt Inklusionsprojekte um.
u.A. Inklusion & Kunst, Inklusion & Theater
Durch wöchentliche Veranstaltungen, immer montags, im Cafe Nachbarschaft versuchen wir die Gesellschaft zu sensibilisieren im Umgang mit täglicher Inklusion, insbesondere im gemeinsamen Miteinander mit Menschen mit und ohne Behinderung. Generationgsübergreifend.
Zuhause leben e.V. baut eine ehrenamtlich geführte Anlauf-und Beratungsstelle im Stuttgarter Süden auf für Menschen mit geringem Einkommen : Wie wollen wir leben und wohnen miteinander.
Die ehemalige Musikkneipe Krone steht seit Jahren leer. Jahrelang war sie ein beliebter Treffpunkt für die Bürger von Schabenhausen. Im Rahmen der Quartiersentwicklung der Gemeinde sind unter anderem Themen der Begegnung der Generationen und Mehrgenerationenwohnen angesprochen worden. Mit dem Beratungsgutschein wird darüber nachgedacht, ob und wie sich beide Aspekte und ggf. weitere für die Dorfgemeinschaft relevante Angebote auf dem großen Areal und in dem ehemaligen Gebäude realisieren lassen. Ebenfalls wird überlegt, wie sich die Bürger der Gemeinde in diesen Prozess einbinden lassen, sodass am Ende ein von vielen getragener Ort entsteht.
Seit 15 Jahren fungiert die Mediathek in Denkingen als wichtiger kultureller Begegnungsort. Sie wird ehrenamtlich betrieben. Es geht dabei um die Ausleihe von Medien sowie um Lesungen, Flohmärkte, weitere Events. In einem Beteiligungsprojekt soll die in die Jahre gekommene Mediathek zukunftsfähig gemacht werden, um diesen kulturellen und sozialen Begegnungsort attraktiv und nutzerfreundlich zu gestalten. Die Initiative erhält Beratung zu Methoden und Formaten der Bürgerbeteiligung sowie zur Angebotsentwicklung der Mediathek als Kultur- und Quartiersmittelpunkt.
In der kleinen Gemeinde Balgheim bildet das ehrenamtliche Engagement die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist das ehrenamtliche Engagement jedoch auf eine harte Probe gestellt worden. Im Projekt wird gerade aufgrund der großen Wichtigkeit des Themas für das gemeinschaftliche Zusammenleben vor Ort darüber nachgedacht und gesprochen, wie das Ehrenamt vor Ort neu geordnet und gedacht werden kann. Diskutiert wird im Rahmen von breit und flexibel angelegten Dialogveranstaltungen. Als Örtlichkeit wird die zentral gelegene Sport- und Festhalle in der Ortsmitte gewählt, die auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen barrierefrei erreicht werden kann. Auch der Termin liegt an einem Wochenende, um möglichst vielen Einwohnenden eine Teilnahme und ein Mitdenken zu ermöglichen.
Ziel des Projektes ist die Quartiersentwicklung für Eislingen Süd. Die Bahnlinie trennt die Stadt in zwei Bereiche. Auf der Nordseite liegen der Markplatz und ein schönes lebendiges Zentrum. Auf der Südseite soll ein Quartierstreff entstehen, um die Belange der Bürger direkt aufzunehmen und den Eislinger Norden zu beleben. Aktive Nachbarschaften und gemeinsame Projekte schaffen eine Plattform für bürgernahe Quartiersentwicklung im neu geplanten Quartier. Die Beratung wird zu Gestaltung und Begleitung eines Ideenworkshops zu Veranstaltungsplanung und Moderation benötigt.
Die Gemeinde Au liegt vor den Toren der Stadt Freiburg im Hexental. Für die Mehrheit der Bürgerschaft ist das eigene Auto das bevorzugte Transportmittel. Der Arbeitskreis Klimaschutz Au, jetzt! setzt sich für das Voranbringen von Alternativen zum individuellen PKW-Verkehr ein. Das Ziel des Projekts ist es, mittels Bürgerbeteiligung eine umweltverträgliche und zukunftsfähige Mobilität in Form von Mobilitätsstationen für E-CarSharing und E-Lastenräder und von Fahrgemeinschaften einzurichten. Der Arbeitskreis erhält hierfür eine qualifizierte Beratung.
Der „Arbeitskreis Klimaschutz Au, jetzt!" hat sich schon Anfang der 2000er Jahre mit dem Thema Verkehr in Au auseinandergesetzt. In dieser Zeit wurde ein Konzept mit mittlerweile umgesetzten Maßnahmen wie einem Tempo-40-Gebot auf der Dorfstraße oder der Markierung eines Fahrradschutzstreifens erstellt. Die Gruppe, der sich weitere Bürger angeschlossen haben, gestaltet nun einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Erarbeitung von Alternativen zum PkW-basierten Individualverkehr und zu einer Energiewende vor Ort in engem Kontakt mit der Gemeinde. Dazu werden auch die Möglichkeiten der interkommunalen Aufstellung von Mitfahrbänken, die Optimierung der Busverbindungen oder die Prüfung von partizipativen Ansätzen zur regenerativen Energiegewinnung im Beteiligungsprozess besprochen. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für das Catering an den Veranstaltungen anfallen.
Die Bürgergemeinschaft Hecklingen (BGH) hat sich zusammen gefunden, um die Dorfentwicklung mitzugestalten und Themen einzubringen. In diesem Rahmen hat sich die Mobilitätsinitiative zusammengefunden, die sich zum Ziel gemacht hat, Mobilitätsstationen aufzubauen. Diese umfassen Carsharing-Fahrzeuge, Lastenfahrräder und -anhänger und Fahrradstationen mit Werkzeug. Zudem soll eine Tauschplattform für Mobilitätsfragen aufgebaut werden.
Dazu werden Netzwerktreffen und Aktionen geplant, um das Thema weiter zu befördern.
Die Initiativgruppe in Kenzingen und Umgebung setzt sich für die umweltverträgliche, autoreduzierte und zukunftsfähige Mobilität ein. In einem Bürgerbeteiligungsprozess und in Kooperation mit der Kommune werden verschiedene Möglichkeiten abgefragt, um mit Blick auf die CO2 Minimierung dieses Ziel zu erreichen. Die Mobilität darf nicht an der Stadtgrenze aufhören, daher ist die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden dabei sehr wichtig. Den Beratungsgutschein erhält die Initiative zur Organisation von Beteiligungsveranstaltungen und zur Etablierung der Projektidee.
Die Aktion „Zukunftsimpulse für Schlierbach“ soll neue Ansätze zur Quartiersentwicklung in einem bevölkerungsschwachen Stadtteil in Randlage in Heidelberg stärken. Die Einrichtung eines Bürgerzentrums ist geplant. Prozessberatung für die gesamte Projektinitiierung wird benötigt, um eine solide Vorbereitung und Planung gewährleisten zu können.
Ziel des Projektes ist die Förderung der multimodalen Mobilität in Ettenheim. Die Bevölkerung wird für die Nutzung von Stadtbus-, CarSharing- und Lastenfahrrad-Angeboten in öffentlichen Veranstaltungen zur Zukunftsmobilität sensibilisiert. Beratung erhält die Initiative für die Organisation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung sowie zur Etablierung der Projektidee.
Die Initiative „Zukunftsmobilität Ettenheim“ arbeitet an einer multimodalen Mobilität in Ettenheim. Die Gruppe möchte die Bürger für Angebote wie den Stadtbus, das (E)-Carsharing und einen geplanten Lastenfahrradverleih gewinnen. Dadurch erhofft sich die Initiative auch eine Reduktion des privaten Individualverkehrs vor Ort und eine Luftverbesserung durch gesenkte CO²-Emissionen. Informiert werden die Bürger über die Angebote per Infoflyer, der zum Beispiel auch Neubürger und Touristen ansprechen soll. Dazu führt die Gruppe Ausprobieraktionen für die Mobilitätsangebote durch. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die zum Beispiel für den Druck der Infoflyer anfallen.
Der „Schwarzwaldverein e.V.“ engagiert sich bereits seit 1864 für Natur, Landschaft, Kultur und das Wandern in Baden-Württemberg. Im Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“, der in Form von Regionalkonferenzen aufgebaut ist, beschäftigt sich der Verein mit den Fragen der Zukunftssicherung und der Weiterentwicklung der verschiedenen Vereinsstandorte. Der Verein erhält Beratung zur Durchführung der Konferenzen.
Eine engagierte Gruppe führt vor Ort ein Beteiligungsprojekt durch, um die Spielplätze in Unterensingen fit für die Zukunft zu machen. In den Gesprächen können erste Ideen entwickelt werden, um zum Beispiel naturnahe, anregende und für Kinder und Jugendliche passende Spielplätze zu entwickeln. Neben der thematischen Auseinandersetzung möchte die Gruppe mit dem Beteiligungsformat auch die Gemeinschaft wieder zusammenbringen. Der Zusammenhalt ist für die Gruppe fühlbar durch mangelnde Aktionen und Begegnungen in der Pandemiezeit kleiner geworden. Hier möchte die Gruppe ansetzen und die Menschen vor Ort wieder ins (positive) Tun bekommen.
Der Verein „Unser Netz e.V.“ koordiniert soziale Aufgaben in der Gemeinde Lenningen und der Stadt Owen. Im Rahmen einer Klausurtagung sollen neue Herausforderungen professionell angegangen werden, um die Zukunftsfähigkeit des Vereins zu erhalten und zu stärken. Beratung erhält der Verein zu Fragen des Prozessmanagements.
Das Deutsch-Türkische Forum in Stuttgart führt eine moderierte Zukunftswerkstatt durch. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum des Stipendien- und Mentoringprogramms "Ağabey-Abla", das gezielt junge, türkeistämmige Schüler fördert. Zum Jubiläum kommen Stuttgarter Einwohner mehrerer Generationen mit und ohne Migrationshintergrund zusammen. Sie entwickeln Ideen für die Zukunft des Ağabey-Abla-Programms in der Zukunftswerkstatt. Dabei steht auch die Frage im Vordergrund, wie das Programm die Zusammenarbeit der Stuttgarter Stadtgesellschaft in den Themenfeldern Umwelt, Sozialraum und Armut befördern kann. Durch den Beteiligungstaler werden Sachkosten finanziert, die rund um die Ausrichtung der Zukunftswerkstatt anfallen.
Binningen Aktiv ist ein Zusammenschluss von Bürgern, die sich dafür einsetzen, dass ihr Ort auch in Zukunft so lebenswert und lebendig bleibt wie heute. Um die Themen Naherholung, Miteinander der Generationen und Wohnen sowie Infrastruktur mit einer breiten Bürgerbeteiligung und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven diskutieren zu können, lädt die Initiative zu einer Zukunftswerkstatt ein. Ziel ist eine breite Beteiligung, Einbeziehung von Vereinen, Integration von Neuzugezogenen in die Dorfentwicklung, Identifizierung der Anliegen der Bürgerschaft, Bildung von Arbeitsgruppen für Umsetzung und Formulierung einer Gesamtstrategie.
Auftakt des Beteiligungsprojekts ist ein Aktionstag, bei dem sich Bürger informieren, austauschen und gemeinsam erste Umsetzungsideen entwickeln können. Mit dem Ortschaftsrat wird in einem Zielworkshop Themen und Prozesse zuvor erarbeitet.
In Binningen engagieren sich die Bürger*innen dafür, dass der Ort auch in Zukunft lebendig bleibt. Es fehlt allerdings ein gemeinsamer Austausch der unterschiedlichen Bürgergruppen und Initiativen im Teilort, insbesondere in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Dorfes. Hier sorgt die Initiative dafür, dass in einer Zukunftswerkstatt aktive Bürgerschaft, Vereine und Initiativen zusammengebracht werden und gemeinsame Anliegen diskutiert werden, die Binningen lebenswert machen. Zur Umsetzung der ausgearbeiteten Maßnahmen wird auch die Gemeindeverwaltung und der Ortschaftsrat eingebunden. Die Beratung erfolgt zu Konzeption und Durchführung des Aktionstages sowie zu weiteren Beteiligungsformaten.
Ziel des Bürgervereins ist die Durchführung von Zukunftswerkstätten im Quartier Weststadt zum Thema der nachhaltigen Entwicklung des Viertels unter Beteiligung der Bewohner sowie anderer im Quartier ansässiger Akteure. Beratung erfolgt zur Prozessgestaltung und -begleitung, zur Schaffung sozialer Räume unter Einsatz identifikationsstärkender Formate.
Der Arbeitskreis engagiert sich seit 30 Jahren für die Asylarbeit in Weinheim. In den vergangenen drei Jahren hat sich viel verändert – neue Aufgaben, Differenzen zwischen Haupt- und Ehrenamt. Diese Veränderungen werden in einem moderierten Prozess analysiert, die Tätigkeit des Arbeitskreises wird dabei kritisch betrachtet und hinterfragt. Ziel des Prozesses ist die Optimierung der eigenen Organisation, des Angebots, bessere Vernetzung von Haupt- und Ehrenamt sowie die Neugewinnung von Ehrenamtlichen.
In der ländlichen geprägten Gemeinde Klettgau Erzingen wird der soziale Zusammenhalt wieder verstärkt in den Blick genommen. Der Entwicklung zu einem reinen Schlafort, aus dem die Menschen lediglich hinein- und herauspendeln zu ihrer Arbeitsstelle, wird bewusst ein zivilgesellschaftlich initiierter Beteiligungsprozess entgegengesetzt. In einer Bürgerumfrage, die On- und Offline beantwortet werden kann, werden aktuelle Bedarfe und Sorgen der Bürger erhoben, die auf Bürgerveranstaltungen in einem Folgeschritt besprochen werden. Übergeordnetes Ziel des Beteiligungsprozesses ist die Verbesserung der Lebensqualität in der ländlich geprägten Gemeinde und in diesem Zusammenhang die Identifizierung möglichst rasch umsetzbarer Maßnahmen. Jungen wie alten Menschen steht dieser Prozess offen. Mit der Zeit entstehen erste Ergebnisse für die Gemeine und möglichst auch eine Perspektive des gesellschaftlichen Miteinanders und der Kooperation verschiedener Akteure vor Ort.
Die Initiative Murg im Wandel ist eine der Transition Town verbundene zivilgesellschaftliche Initiative, die es sich u.a. zum Ziel gesetzt hat einen Beitrag zur sozialen Kohärenz in der Gemeinde zu schaffen. Zur weiteren Organisationsentwicklung und Ausrichtung der Arbeit der Initiative erhalten Sie Beratung.
Mittels Zukunftsworkshops erarbeitet die Initiative "Quartier 2030/Projektgruppe Familie" gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern in Au am Rhein konkrete Vorschläge und Maßnahmen zum zukünftigen Leben im Quartier. Bei dem Projekt erarbeiten Menschen aus unterschiedlichen Generationen ein integriertes Gesamtkonzept, um die Attraktivität, Lebensqualität und Familienfreundlichkeit weiter zu erhöhen. Beratung erhält die Initiative für die Umsetzung in Form von der Moderation der Workshops und dem gemeinsamen Erarbeiten des Konzepts.
Neben dem inklusiven Gemeinschaftsgarten in Freiburg-Vauban betreibt zusammen leben e.V. das Sozialcafé "zusammen kaffee" in der Freiburger Innenstadt. Denn Essen und Trinken verbindet: Der internationale Mittagstisch von Dienstag bis Donnerstag ist offen für Alle. Egal ob mit oder ohne Geld, hier kann lecker bio-regional und interkulinarisch geschlemmt werden. Außerdem gibt es Kochkurse, Workshops und eine lebhafte Café Community aus über 40 Ehrenamtlichen, vier Köchinnen und vielen Gästen. Der Beratungsgutschein wird für einen Beratungsprozess mit einem professionellen Steuerberater eingesetzt, um das erprobte Konzept auf zukunftsfähige finanzielle Beine zu stellen.
Pliensauvorstadt live organisiert in Kooperation mit Institutionen aus dem Stadtteil Veranstaltungen mit Live-Musik, wie z.B. Stadtteilfest, Osterbrunnen und Adventsfenster. Die Institutionen beteiligen sich mit Darbietungen, Aktionen und Verkaufsständen. Der Verein bietet den Rahmen für die Beteiligung und organisiert die Infrastruktur. Unter dem Motto ZUSAMMEN mehr erLEBEN entsteht unter Beteiligung Vieler aus dem Stadtteil ein buntes Programm, das zeigt, wie durch Gemeinschaft und Zusammenhalt etwas bewegt werden kann. Beteiligte wie auch Besucher können sich durch die Veranstaltungen mehr dem Stadtteil verbunden fühlen.
Der Arbeitskreis Asyl Owen strebt mit Hilfe eines Runden Tisches bessere Kommunikationsstrukturen zwischen den unterschiedlich agierenden Akteuren im Themenfeld „Flucht und Asyl“ an. Zudem ist ein auf Dauer angelegter Prozess der Zusammenarbeit geplant, der die freiwillig Engagierten, die Hauptamtlichen und auch Menschen mit Fluchterfahrungen aktiv einbindet. Beratung erhält der Arbeitskreis zu Fragen des Prozessmanagements.
Um die Nachbarschaftsgespräche organisieren zu können wurde zunächst eine Begleitgruppe eingerichtet. Diese bestand aus Vertretern der Stadtverwaltungen, der Beratung, Vertretern der Grundschule und des Bürgertreffs sowie Vertretern der Grundschule und des Bürgertreffs. Auch waren Vertreter des Bürgervereins und des Sportvereins Pattonville vertreten. Die Begleitgruppe erstellte vor den eigentlichen Gesprächsrunden eine Themenlandkarte und einen Zeitplan für die Nachbarschaftsgespräche.
Die Bevölkerung Pattonvilles wurde zu einer Auftaktveranstaltung in die Mehrzweckhalle der Realschule Pattonville eingeladen, um allumfassend über die aktuellen Themen und Projekte informiert zu werden. Die Vertreter der Stadtverwaltung standen hierbei für Fragen zur Verfügung. Es sollte eine Transparenz geschaffen werden sowie aufgezeigt werden, welche Gestaltungsspielräume und Handlungsoptionen für die Bürgerschaft bestehen. Zudem bekamen die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen sowie Frust, Ängste und Ärger loszuwerden.
Mit den Themen der Stadtverwaltung und den weiteren Themen aus der Bevölkerung startete in der Folge die Workshopphase. Diese fand im Mensatrakt der Realschule Pattonville statt. Im Rahmen einer Zukunftswerkstatt wurde herausgefiltert welche Themen für die Pattonviller von Bedeutung sind. An einem weitere Treffen wurden aus den Themenschwerpunkten Arbeitsgruppen gebildet, die weiter an ihren Projekten und Ideen arbeiteten. Es entstanden hieraus drei Arbeitsgruppen: Verkehr, Zusammenleben/Pattonviller Geist, Integration.
Durch die Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse im Gemeinderat Remseck und Kornwestheim wurde die Wichtigkeit der Nachbarschaftsgespräche hervorgehoben. Dies sollte auch eine Rückkopplung an die Bürger sein, wie mit den Anliegen weiter verfahren wird. Durch die Beteiligung sollte die Verantwortung der Bürger für die Entwicklung ihres Stadtteils gesteigert und gestärkt werden.

Die Arche Nora ist von Alleinerziehenden gegründet worden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mittlerweile hat sie sich zu einem Kinder- und Familienzentrum entwickelt. In dieser Begegnungsstätte können sich Eltern und Kinder in einer kindgerechten Atmosphäre austauschen und an unterschiedlichen Angeboten teilnehmen. Ein weiteres Angebot soll der Zwergentreff für 1-3 jährige Kinder mit ihren Eltern sein. Ziel ist es, dass sich Eltern mit Kleinkindern, die noch nicht in der Kita sind in einer offenen Atmosphäre austauschen können. Mit einem Rahmenprogramm werden Erziehungsfragen thematisiert und der Austausch dazu angeregt.